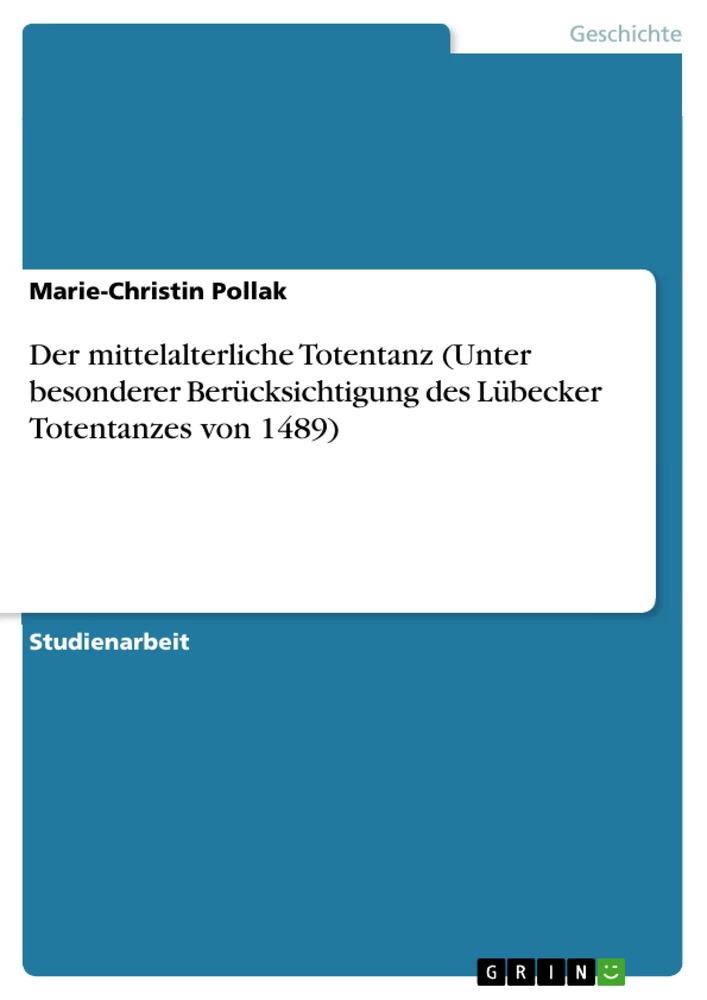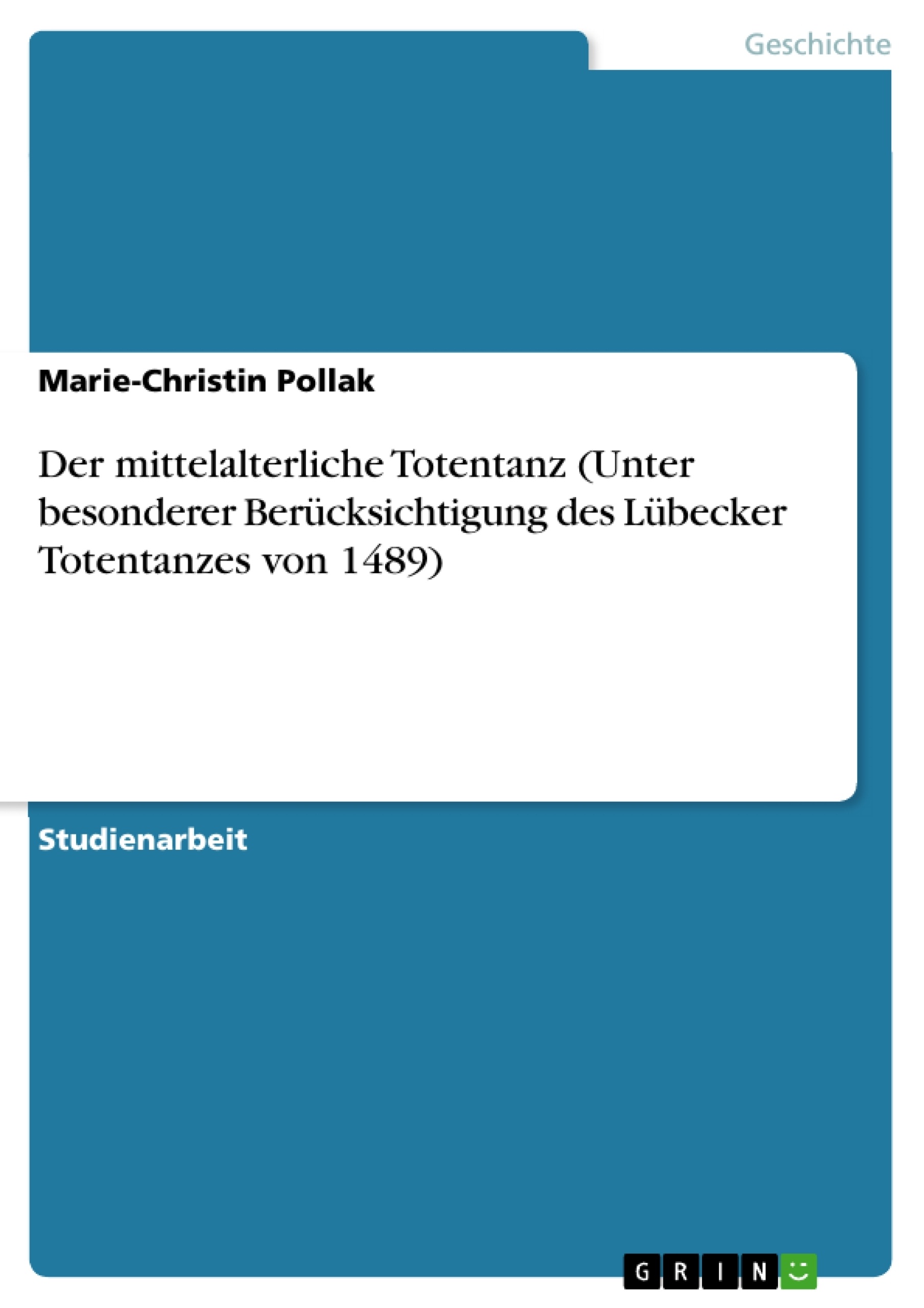Der Tod war im Mittelalter ein allgegenwärtiges Thema. Es dominierte im religiösen genau wie im profanen Bewusstsein. Die Lebensumstände der Menschen sowie ihr Umfeld ließen den Tod ständig gegenwärtig sein. Katastrophen wie zum Beispiel Unwetter, Kriege und Krankheiten, sowie die hygienischen Missstände unter denen die Menschen lebten und die harte Arbeit, die sie seit jungen Jahren zu bewältigen hatten, bedeuteten eine relativ geringe Lebenserwartung. Der Tod war auch durch die Religion allgegenwärtig. Das Leben wurde später nur noch als Übergangsphase zum Leben nach dem Tod gesehen, in der sich der Mensch dem Paradies würdig erweisen musste. Durch die Himmel-Hölle Theorie hatten die Menschen in gewisser Weise Angst vor dem Tod, allerdings nur weil sie die Hölle fürchteten. Der Umgang mit dem Tod war allerdings ein anderer als heute. Man starb sozusagen aktiv. Man bereitete sich sorgfältig auf den eigenen Tod vor. „Der unerwartete, plötzliche Tod war ein Unglück, ein Einbruch in die rituell festgelegte Ordnung des Sterbens“. Der Tod war ein öffentliches Ereignis. Familienangehörige und Freunde standen dem Sterbenden bei. Ein anderes Beispiel ist das Sterben im Kloster. Man zeichnete zum Beispiel nicht das Geburtsdatum auf, sondern das Sterbedatums eines Klosterangehörigen. Dieser Tag war viel bedeutender, da er den Übergang ins Paradies bedeutete. Außerdem gab es bestimmte Regeln und Vorschriften für das Sterben im Kloster, genau wie es für die normalen Menschen feste Rituale gab. Der Tod war somit kein Ereignis vor dem man sich fürchten musste, solange man sich gut darauf vorbereitet hatte. Allerdings brachten Ereignisse wie die Pest zum Beispiel diese Rituale des Sterbens durcheinander. Während der Pestepedemien starben soviel Menschen und das so schnell, dass meist keine Zeit blieb sich vorzubereiten und für die Angehörigen war der Kontakt zu dem Kranken meist auch tödlich. Der Tod war zwar im gesamten Mittelalter allgegenwärtig doch die Pest war anders. Sie entvölkerte ganze Ortschaften und Landstriche. Mit Ritualen und Gebeten allein war diese Katastrophe nicht zu bewältigen. Aus diesem Grund suchten die Menschen andere Wege um ihrer Angst zu begegnen. Ein Beispiel hierfür ist der Totentanz.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der mittelalterliche Totentanz
- II.1 Bedeutung und Entstehung
- II.2 Die bildliche Darstellung
- II.3 Die Verse bzw. Bildunterschriften
- III. Der Lübecker Totentanz von 1489
- III.1 Vorbemerkung zum Lübecker Totentanz von 1489
- III.2 Zur Ikonographie
- III.3 Zu den Versen
- IV. Reflexion des Themas in der heutigen Zeit
- V. Anhang
- V.1 Abbildungen
- VI. Abbildungsnachweis
- VII. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den mittelalterlichen Totentanz, insbesondere den Lübecker Totentanz von 1489. Ziel ist es, die Entstehungsgeschichte, Bedeutung und den Aufbau von Totentänzen zu beleuchten und diese am Beispiel des Lübecker Totentanzes zu veranschaulichen. Die Arbeit schließt mit einer Reflexion des Themas aus heutiger Perspektive.
- Der Tod als allgegenwärtiges Thema im Mittelalter
- Bedeutung und Entstehung des Totentanzes als religiöse und gesellschaftliche Ausdrucksform
- Ikonographie und Symbolik des Totentanzes
- Der Lübecker Totentanz von 1489 als Beispiel für die künstlerische und textuelle Gestaltung
- Relevanz des Totentanz-Motivs in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des mittelalterlichen Todesverständnisses ein und verdeutlicht dessen allgegenwärtige Präsenz im religiösen und profanen Leben. Die geringe Lebenserwartung, die Häufigkeit von Katastrophen und die stark religiös geprägte Sichtweise auf Leben und Tod werden beschrieben. Der Tod wird als ein öffentliches Ereignis mit festen Ritualen dargestellt, wobei die Pest als Ausnahme genannt wird, die diese Rituale durchbrach und zu neuen Ausdrucksformen wie dem Totentanz führte.
II. Der mittelalterliche Totentanz: Dieses Kapitel behandelt die Entstehung und Bedeutung des Totentanzes als Bildmotiv. Der Totentanz wird als Teil der religiösen Bußliteratur eingeordnet, der sowohl auf die Selbstverantwortung des Menschen im Leben, als auch auf die Vergänglichkeit irdischer Güter hinweist. Er vereint profane Welterfahrung mit religiöser Erbauung und zeigt die Gleichheit aller Menschen im Tod, ungeachtet ihrer gesellschaftlichen Stellung. Die Verbreitung des Totentanzmotivs durch Franziskaner- und Dominikanerorden wird erläutert.
Schlüsselwörter
Mittelalter, Tod, Totentanz, Lübeck, Memento Mori, Ars Moriendi, Religiöse Bußliteratur, Ikonographie, Gesellschaft, Sterberituale, Pest, Lebensvergänglichkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Lübecker Totentanz von 1489
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den mittelalterlichen Totentanz, insbesondere den Lübecker Totentanz von 1489. Sie beleuchtet die Entstehungsgeschichte, Bedeutung und den Aufbau von Totentänzen und veranschaulicht diese anhand des Lübecker Beispiels. Die Arbeit schließt mit einer Reflexion des Themas aus heutiger Perspektive.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Tod als allgegenwärtiges Thema im Mittelalter; Bedeutung und Entstehung des Totentanzes als religiöse und gesellschaftliche Ausdrucksform; Ikonographie und Symbolik des Totentanzes; Der Lübecker Totentanz von 1489 als Beispiel für die künstlerische und textuelle Gestaltung; Relevanz des Totentanz-Motivs in der heutigen Zeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: I. Einleitung; II. Der mittelalterliche Totentanz (mit Unterkapiteln zu Bedeutung und Entstehung, bildlicher Darstellung und Versen/Bildunterschriften); III. Der Lübecker Totentanz von 1489 (mit Unterkapiteln zu Vorbemerkungen, Ikonographie und Versen); IV. Reflexion des Themas in der heutigen Zeit; V. Anhang (mit Abbildungen); VI. Abbildungsnachweis; VII. Literaturverzeichnis.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik des mittelalterlichen Todesverständnisses ein und verdeutlicht dessen allgegenwärtige Präsenz im religiösen und profanen Leben. Die geringe Lebenserwartung, die Häufigkeit von Katastrophen und die stark religiös geprägte Sichtweise auf Leben und Tod werden beschrieben. Der Tod wird als öffentliches Ereignis mit festen Ritualen dargestellt, wobei die Pest als Ausnahme genannt wird, die diese Rituale durchbrach und zu neuen Ausdrucksformen wie dem Totentanz führte.
Was ist der Fokus des Kapitels "Der mittelalterliche Totentanz"?
Dieses Kapitel behandelt die Entstehung und Bedeutung des Totentanzes als Bildmotiv. Der Totentanz wird als Teil der religiösen Bußliteratur eingeordnet, der sowohl auf die Selbstverantwortung des Menschen im Leben als auch auf die Vergänglichkeit irdischer Güter hinweist. Er vereint profane Welterfahrung mit religiöser Erbauung und zeigt die Gleichheit aller Menschen im Tod, ungeachtet ihrer gesellschaftlichen Stellung. Die Verbreitung des Totentanzmotivs durch Franziskaner- und Dominikanerorden wird erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Mittelalter, Tod, Totentanz, Lübeck, Memento Mori, Ars Moriendi, Religiöse Bußliteratur, Ikonographie, Gesellschaft, Sterberituale, Pest, Lebensvergänglichkeit.
Welche Art von Informationen liefert der Anhang?
Der Anhang enthält Abbildungen zum Thema.
- Quote paper
- Marie-Christin Pollak (Author), 2004, Der mittelalterliche Totentanz (Unter besonderer Berücksichtigung des Lübecker Totentanzes von 1489), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51236