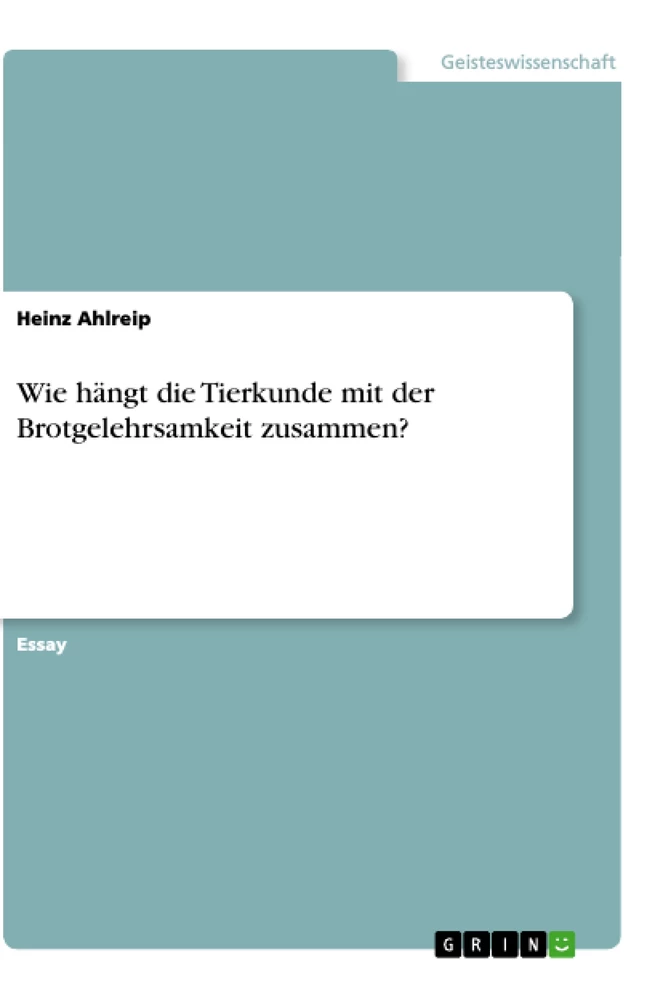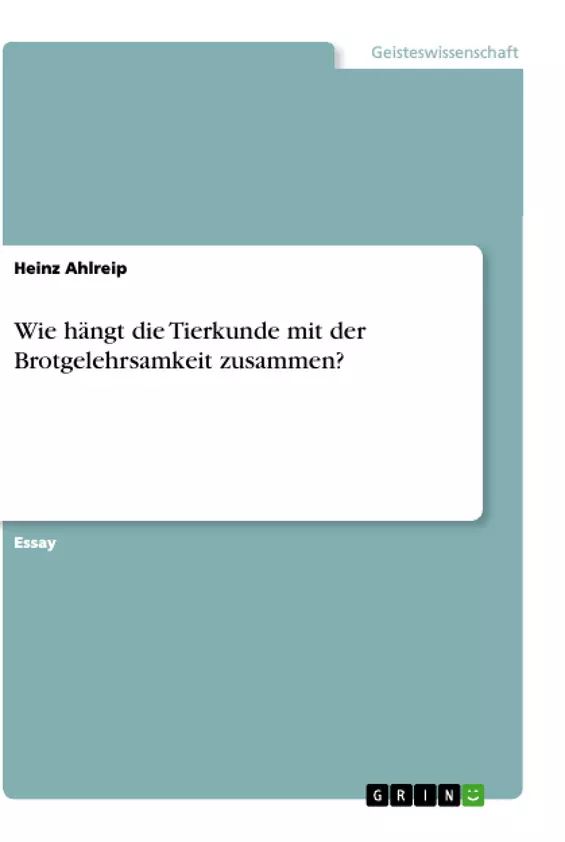Beantwortung der Frage: Wie hängt die Tierkunde mit der Brotgelehrsamkeit zusammen?
„Die Existenz des Staats und die Existenz der Sklaverei sind unzertrennlich.“ (Karl Marx).
Die Gesellschaftswissenschaften haben ihren Grund und ihre Bedingung in der geschichtlichen Abfolge des Aufbaus und der Destruktion von Herrschaften und Knechtschaften. Anarchistische Tendenzen tragen den Todeskeim dieser Wissenschaften in sich.
Dagegen war das Bornieren in Herr-Knecht-Mechanismen eines der eilfertigsten Anliegen der abendländischen Geisteswissenschaft von Platons Politeia über Hegels Staatsphilosophie bis Hitlers ‚Mein Kampf‘. Plato hielt Ungebundenheit bei Menschen wie bei Tieren für schädlich, Kant sah im Menschen noch „…ein Thier, das, wenn es unter anderen seiner Gattung lebt, einen Herrn nöthig hat.“ In einem Aphorismus äußert Hegel, daß russische Frauen und die Völker der Weltgeschichte die Hundepeitsche verlangen.
Heute kann ich ihnen zurufen: Sie haben sich alle gründlich geirrt, meine Herren! Denn wie es bei einer starken Eiche mit markigen Wuchs auch einige kleine, verdorrte Verästelungen geben kann, so in der langen Emanzipationsgeschichte des Affen zum Menschen, der wahrscheinlich erst von den Bäumen heruntergestiegen, auch einen Bruchteil, in dem er wieder künstlicher Affe wurde: Staatsbürger. Mit der Zeit fegt der Sturm die dürren Zweige ab, mit der Zeit wachsen Generationen heran, die in Revolutionsstürmen den ganzen Staatsplunder von sich abwerfen.
Inhaltsverzeichnis
- Beantwortung der Frage: Wie hängt die Tierkunde mit der Brotgelehrsamkeit zusammen?
- Es waren nicht die Philosophen Kant und St. Pierre, die zuerst die Vision des Ewigen Friedens in der Menschheit aufzeigten, sondern dieser Friede war bereits ein Begehren des Bundschuhs
- In einem Aphorismus äußert Hegel, daß russische Frauen und die Völker der Weltgeschichte die Hundepeitsche verlangen.
- Aber 23 Jahre später wurde die Pariser Kommune proklamiert: das war die Diktatur des Proletariats, schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Verbindung zwischen Tierkunde und der Entwicklung von Herrschaftsstrukturen in der Menschheitsgeschichte. Er hinterfragt die Vorstellung von der Notwendigkeit von Herrschaft und analysiert historische Beispiele von Revolutionen und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Ordnung.
- Die Rolle von Herrschaft und Knechtschaft in der Menschheitsgeschichte
- Die Analyse historischer Revolutionen und deren Ziele
- Die Entwicklung des Kommunismus als Gegenmodell zur Staatsgewalt
- Die Kritik an bestehenden Gesellschaftswissenschaften und deren Ideologien
- Die Bedeutung der Selbstnegation von Herrschaftsstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Beantwortung der Frage: Wie hängt die Tierkunde mit der Brotgelehrsamkeit zusammen?: Der Text beginnt mit der provokativen Frage nach dem Zusammenhang zwischen Tierkunde und Brotgelehrsamkeit, um die zentrale These zu etablieren, dass die Annahme der Notwendigkeit von Herrschaft in der menschlichen Gesellschaft einer kritischen Überprüfung bedarf. Er argumentiert, dass die Gesellschaftswissenschaften, die sich mit Herrschaftsstrukturen befassen, inhärent an den Mechanismen von Herrschaft und Knechtschaft gebunden sind. Die Geschichte der abendländischen Geistesgeschichte wird als ein kontinuierlicher Versuch dargestellt, Herrschaftsmechanismen zu rechtfertigen, von Platon über Hegel bis Hitler. Der Autor stellt die These auf, dass der Staat eine künstliche Konstruktion ist, die im Laufe der Emanzipation überwunden werden kann.
Es waren nicht die Philosophen Kant und St. Pierre, die zuerst die Vision des Ewigen Friedens in der Menschheit aufzeigten, sondern dieser Friede war bereits ein Begehren des Bundschuhs: Dieses Kapitel untersucht die historischen Wurzeln der Idee des Friedens und des Kommunismus. Es zeigt, dass die Sehnsucht nach einem herrschaftsfreien Zustand bereits lange vor den bekannten Philosophen existierte, beispielsweise im Bundschuh-Aufstand. Die Bauern verlangten die Abschaffung des Zehnten und damit aller Obrigkeiten. Der Text verbindet diese frühneuzeitlichen Bewegungen mit dem französischen Revolution von 1789, die zwar zunächst eine bürgerliche Revolution war, aber bereits Tendenzen zur Transzendierung der bürgerlichen Gesellschaft enthielt. Diese Revolution, analysiert durch die Perspektive Hegels, strebte laut dem Autor eine Anarchie an, die allerdings auf der globalen Ebene erst verwirklicht werden kann.
In einem Aphorismus äußert Hegel, daß russische Frauen und die Völker der Weltgeschichte die Hundepeitsche verlangen.: Dieses Kapitel analysiert Hegels Aphorismus über die angebliche Sehnsucht nach der Hundepeitsche und widerlegt diese Sichtweise. Es argumentiert, dass die Geschichte der Emanzipation auch Rückschläge beinhaltet, verdorrte Äste, die jedoch mit der Zeit durch Revolutionen entfernt werden können. Der Autor vertritt die Ansicht, dass Generationen heranwachsen, die die bestehenden Herrschaftsstrukturen ablegen. Das Kapitel dient als Überleitung zur Diskussion des Marxismus und der proletarischen Revolution.
Aber 23 Jahre später wurde die Pariser Kommune proklamiert: das war die Diktatur des Proletariats, schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr.: Das Kapitel analysiert die Pariser Kommune als ein konkretes Beispiel für die Diktatur des Proletariats, die im Gegensatz zu vorherigen Revolutionen, keinen Staat im herkömmlichen Sinne mehr darstellt. Der Text vergleicht die geringe Zahl der Streiks vor 1905 mit der enormen Steigerung im Januar 1905, um das wachsende revolutionäre Potential zu verdeutlichen. Die Entstehung der Sowjets als Organisationsform wird hervorgehoben. Die Sowjets werden als Vorboten des Absterbens jedes Staates interpretiert. Schließlich wird Stalins Sicht auf die Rolle der Partei in der Diktatur des Proletariats diskutiert, mit dem Argument, dass die Partei mit dem Verschwinden der Klassen selbst absterben muss. Der Text vergleicht diese Sichtweise mit der Selbstauffassung bürgerlicher Parteien und betont die grundlegende Differenz.
Schlüsselwörter
Herrschaft, Knechtschaft, Revolution, Kommunismus, Anarchie, Gesellschaftswissenschaften, Proletariat, Bourgeoisie, Staat, Diktatur, Emanzipation, Hegel, Marx, Engels, Pariser Kommune, Sowjets.
Häufig gestellte Fragen zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Der Text untersucht die Verbindung zwischen Tierkunde (als Metapher für die Betrachtung von Herrschaftsstrukturen) und der Entwicklung von Herrschaftsstrukturen in der Menschheitsgeschichte. Er hinterfragt die Notwendigkeit von Herrschaft und analysiert historische Revolutionen und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Ordnung, mit besonderem Fokus auf den Kommunismus als Gegenmodell zur Staatsgewalt.
Welche historischen Ereignisse werden im Text analysiert?
Der Text analysiert den Bundschuh-Aufstand, die Französische Revolution, die Pariser Kommune und die Entwicklung der Sowjets. Diese Ereignisse dienen als Beispiele für den Kampf gegen Herrschaft und die Sehnsucht nach einem herrschaftsfreien Zustand.
Welche Philosophen und Denker werden im Text behandelt?
Der Text bezieht sich auf Kant, St. Pierre, Hegel, Marx und Engels. Hegels Aphorismus über die angebliche Sehnsucht nach der "Hundepeitsche" wird kritisch analysiert. Die marxistische Sicht auf die Diktatur des Proletariats und das Absterben des Staates wird im Kontext der Pariser Kommune diskutiert.
Wie wird die Rolle des Staates im Text gesehen?
Der Staat wird als eine künstliche Konstruktion dargestellt, die im Laufe der Emanzipation überwunden werden kann. Der Text argumentiert, dass der Kommunismus ein Modell für eine Gesellschaft ohne Staat darstellt, wobei die Pariser Kommune als ein frühes, wenn auch unvollkommenes, Beispiel hierfür betrachtet wird.
Welche Kritik wird an bestehenden Gesellschaftswissenschaften geübt?
Der Text kritisiert die Tendenz bestehender Gesellschaftswissenschaften, die Mechanismen von Herrschaft und Knechtschaft zu reproduzieren anstatt sie zu hinterfragen. Es wird argumentiert, dass diese Wissenschaften oft an den bestehenden Herrschaftsstrukturen beteiligt sind.
Was ist die Bedeutung der Selbstnegation von Herrschaftsstrukturen?
Die Selbstnegation von Herrschaftsstrukturen ist ein zentraler Aspekt des Textes. Es wird argumentiert, dass die Überwindung von Herrschaft nur durch einen aktiven Prozess der Selbstaufhebung bestehender Machtstrukturen möglich ist, der sich in historischen Revolutionen manifestiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Herrschaft, Knechtschaft, Revolution, Kommunismus, Anarchie, Gesellschaftswissenschaften, Proletariat, Bourgeoisie, Staat, Diktatur, Emanzipation, Hegel, Marx, Engels, Pariser Kommune, Sowjets.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, die jeweils einen Aspekt des Themas behandeln. Er beginnt mit einer provokativen Frage nach dem Zusammenhang zwischen Tierkunde und Brotgelehrsamkeit, um die zentrale These zu etablieren. Die Kapitel werden anschließend zusammengefasst.
Für welche Zielgruppe ist der Text gedacht?
Der Text richtet sich an Leser, die sich für Fragen der Gesellschaftskritik, Geschichte der Revolutionen und die philosophischen Grundlagen des Kommunismus interessieren. Ein akademischer Hintergrund ist hilfreich, um die komplexen Argumentationen zu verstehen.
Wo finde ich den vollständigen Text?
[Hier den Link oder die Quelle zum vollständigen Text einfügen]
- Citar trabajo
- Magister artium Heinz Ahlreip (Autor), 2019, Wie hängt die Tierkunde mit der Brotgelehrsamkeit zusammen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508543