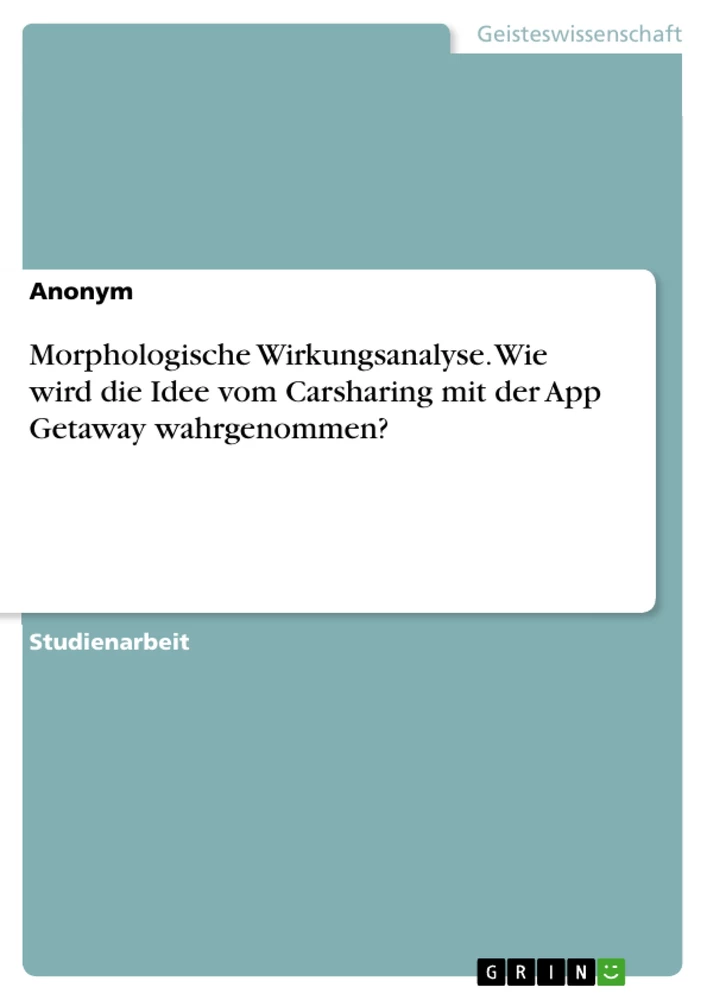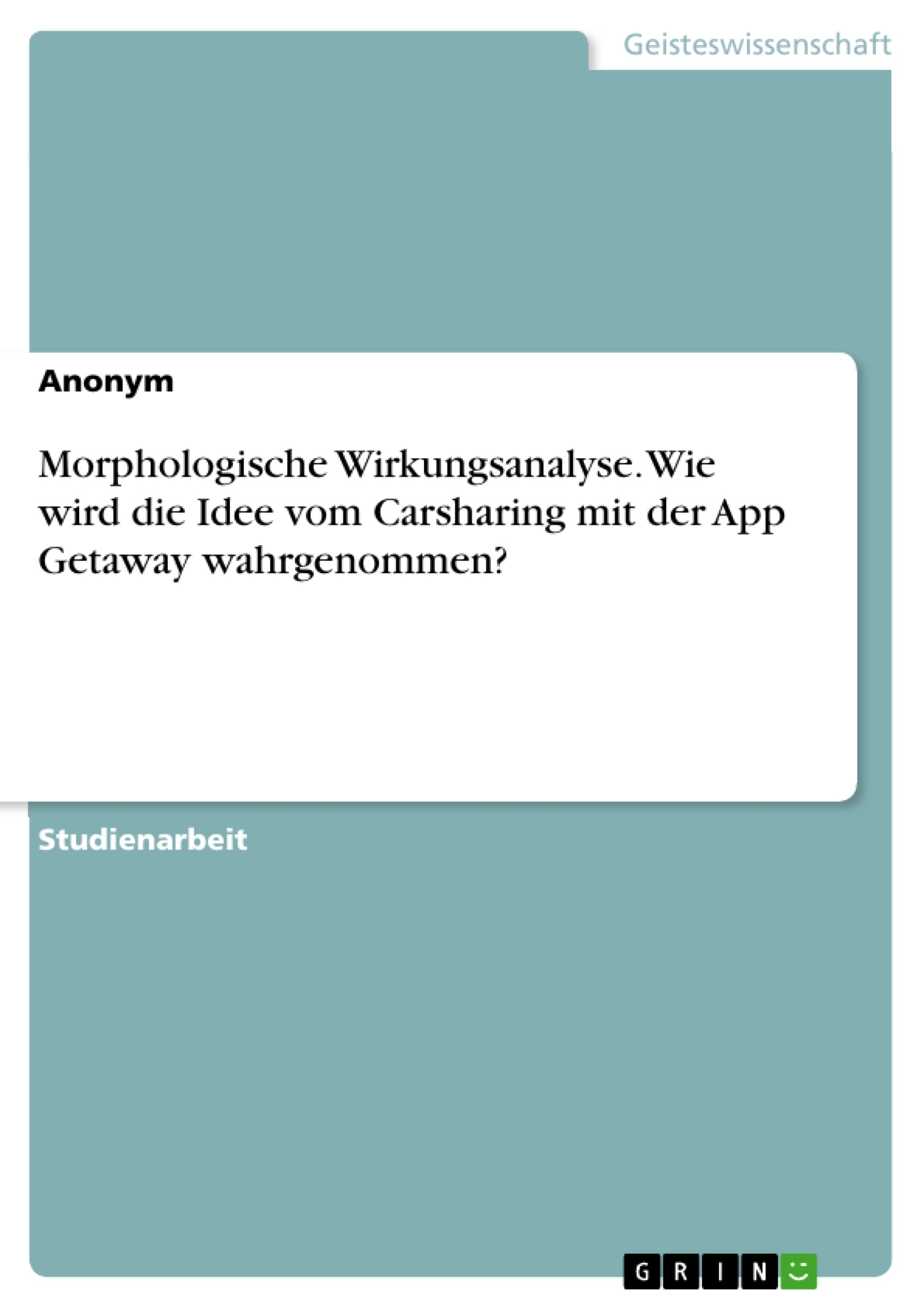Diese Studie nähert sich den Wirkungsmechanismen der Carsharing-Plattform Getaway aus psychologischer Perspektive und untersucht, in welches Erleben und Verhalten Menschen im Umgang mit der Idee von sozialisierten Privatautos geraten. Dabei wird betrachtet, was unbewusst mit uns passiert, wenn wir uns in ein fremdes Privatfahrzeug begeben oder unseres einem Fremden zur Verfügung stellen würden, um die verschiedenen Verwendungsmotive zu rekonstruieren. Um diesen Fragen auf die Spur zu kommen, werden in der Studie verschiedene Einstellungs- und Verhaltensmuster von Probanden gegenüber dem Thema Carsharing und speziell gegenüber der Idee von Getaway beschrieben und gemeinsame Paradoxien, Spannungen und Wirkungsmuster herausgearbeitet. Die dabei zugrundeliegende Theorie ist die der morphologischen Psychologie. Sie wurde als eigenständiger Ansatz der Psychologie von Wilhelm Salber ab Mitte des 20. Jahrhunderts über viele Jahre entwickelt.
Hierfür wurden Tiefeninterviews geführt, die anschließend in psychologischen Einzelbeschreibungen zusammengefasst und verdichtet wurden. Die unbewussten seelischen Wirksamkeiten versucht die morphologische Psychologie dann nach Maßgabe einer Theorie, welche Unbewusstes und Gegenläufiges miteinbezieht, durch verschiedene Stadien hindurch zu rekonstruieren.
Seit einigen Jahren findet man auf Deutschlands Straßen neben den privaten PKW auch gemeinschaftlich geteilte Autos. Das sogenannte Carsharing, dominiert durch große Konzerne wie Daimler und BMW, hat im Zuge eines gesellschaftlichen Trends die Straßen erobert und ist heute als Fortbewegungsmittel in großen Städten nicht mehr wegzudenken: Anfang 2019 gab es in Deutschland bereits über 2,46 Millionen registrierte Nutzer bei den verschiedenen Carsharing-Plattformen. Neben den klassischen Anbietern bahnen sich jedoch auch kleine Start-Ups ihren Weg auf die Straße und entwickeln innovative Ideen: Das Unternehmen Getaway verfolgt die Idee, dass Besitzer ihre privaten Fahrzeuge für eine bestimmte Zeit freigeben und vermieten können, um somit aus persönlichem Eigentum "sozialisierten Besitz" zu machen - eine private Carsharing-Community also. Kann diese Idee auf Anklang stoßen und damit erfolgreich verwirklicht werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stichprobe
- 3. Empirische Untersuchung
- 3.1 Erste Version: Grundqualität: Gefährliches Spiel mit Verantwortung
- 3.2 Zweite Version: Wirkungsraum
- 3.2.1 Aneignung und Umbildung
- 3.2.2 Ausbreitung und Ausrüstung
- 3.2.3 Einwirkung und Anordnung
- 3.3 Psychologisierende Fragestellung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie befasst sich mit den Wirkungsmechanismen von privatem Carsharing, speziell mit der Idee der App Getaway, aus psychologischer Perspektive. Sie analysiert die Erfahrungen und Einstellungen von Probanden gegenüber Carsharing und die unbewussten Prozesse, die im Umgang mit der Idee von sozialisierten Privatautos stattfinden. Ziel ist es, die verschiedenen Verwendungsmotive zu rekonstruieren und die Paradoxien und Spannungen, die mit dieser Form von Carsharing verbunden sind, zu beleuchten.
- Die unbewussten seelischen Wirksamkeiten im Umgang mit Carsharing.
- Die Anwendung der morphologischen Psychologie auf das Thema Carsharing.
- Die Analyse der verschiedenen Stadien der morphologischen Wirkungsanalyse.
- Die Herausarbeitung der psychologischen Grundprobleme, die im Zusammenhang mit Carsharing auftreten.
- Die Rekonstruktion der Verwendungsmotive für Carsharing.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Wirkungsmechanismen des privaten Carsharing am Beispiel der App Getaway. Sie führt in das Thema Carsharing und den gesellschaftlichen Trend ein, sowie in die theoretischen Grundlagen der morphologischen Psychologie.
2. Stichprobe
Dieses Kapitel beschreibt die untersuchte Stichprobe, die aus sechs Personen besteht, die Erfahrungen mit Carsharing haben und in Berlin wohnen. Die Stichprobe ist klein, aber homogen und ermöglicht eine spezifische Analyse der Fragestellung.
3. Empirische Untersuchung
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung der verschiedenen Einstellungs- und Verhaltensmuster der Probanden gegenüber Carsharing dargestellt.
3.1 Erste Version: Grundqualität: Gefährliches Spiel mit Verantwortung
Die erste Version der morphologischen Analyse umfasst die Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der Interviewdynamiken und die ambivalentesten Erlebens- und Verhaltensbeschreibungen der Probanden.
3.2 Zweite Version: Wirkungsraum
Die zweite Version umfasst die Analyse der seelischen Spannungsfelder im Zusammenhang mit Carsharing.
3.2.1 Aneignung und Umbildung
Dieser Abschnitt beschreibt die Prozesse der Aneignung und Umbildung des Carsharing-Konzepts durch die Probanden.
3.2.2 Ausbreitung und Ausrüstung
Hier wird die Ausbreitung und Ausrüstung des Carsharing-Systems untersucht.
3.2.3 Einwirkung und Anordnung
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Einwirkung und Anordnung des Carsharing-Systems auf die Probanden.
3.3 Psychologisierende Fragestellung
In diesem Abschnitt wird die psychologische Grundproblematik, die sich im Zusammenhang mit Carsharing zeigt, herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Carsharing, Getaway, morphologische Psychologie, private Carsharing-Community, sozialisiertes Privateigentum, Wirkungsmechanismen, unbewusste Prozesse, Verwendungsmotive, Paradoxien, Spannungen, seelische Wirksamkeiten, Tiefeninterviews, Grundqualität, Wirkungsraum, psychologisierende Fragestellung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Carsharing-Konzept von Getaway?
Getaway ermöglicht es Privatpersonen, ihre eigenen Fahrzeuge anderen zur Miete zur Verfügung zu stellen, wodurch Privatbesitz zu „sozialisiertem Eigentum“ wird.
Was untersucht die morphologische Psychologie in diesem Kontext?
Sie untersucht die unbewussten seelischen Wirkungsmechanismen, Spannungen und Paradoxien, die entstehen, wenn Menschen fremde Autos nutzen oder das eigene Auto Fremden überlassen.
Welche psychologischen Widerstände gibt es beim privaten Carsharing?
Oft besteht ein „gefährliches Spiel mit der Verantwortung“ sowie Ängste vor Beschädigung oder Verletzung der Privatsphäre im eigenen Fahrzeug.
Wie wurden die Daten für diese Studie erhoben?
Es wurden psychologische Tiefeninterviews mit Probanden geführt, um deren Erleben und Verhalten detailliert zu rekonstruieren.
Welche Motive bewegen Menschen zur Nutzung von Getaway?
Neben ökonomischen Vorteilen spielen Motive wie Flexibilität, Gemeinschaftsgefühl und die Umbildung des herkömmlichen Eigentumsbegriffs eine Rolle.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Morphologische Wirkungsanalyse. Wie wird die Idee vom Carsharing mit der App Getaway wahrgenommen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508344