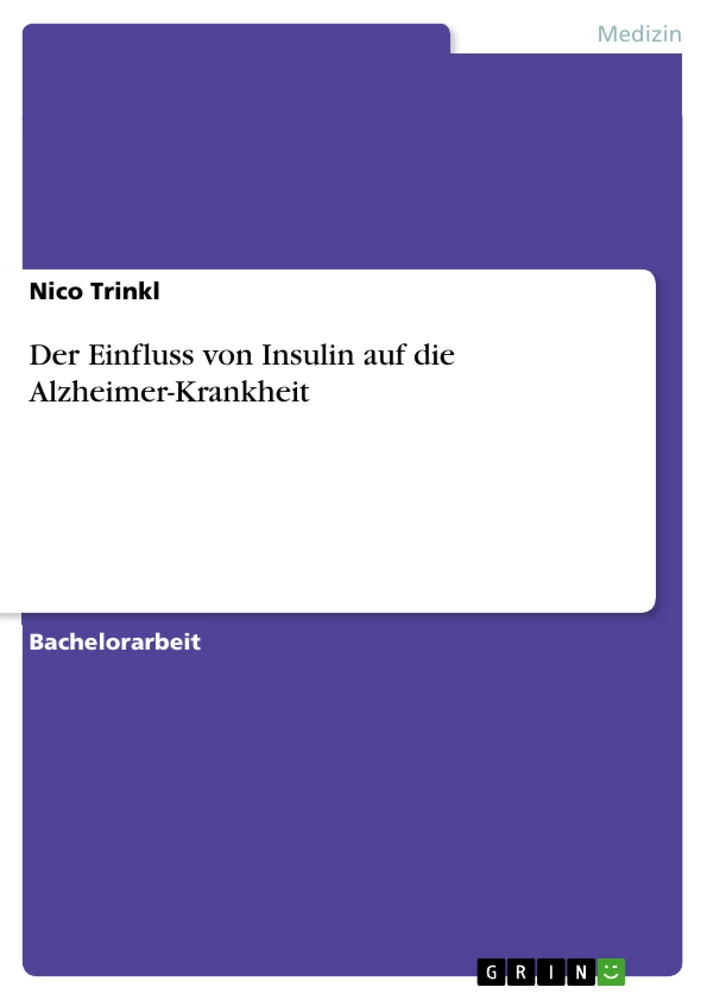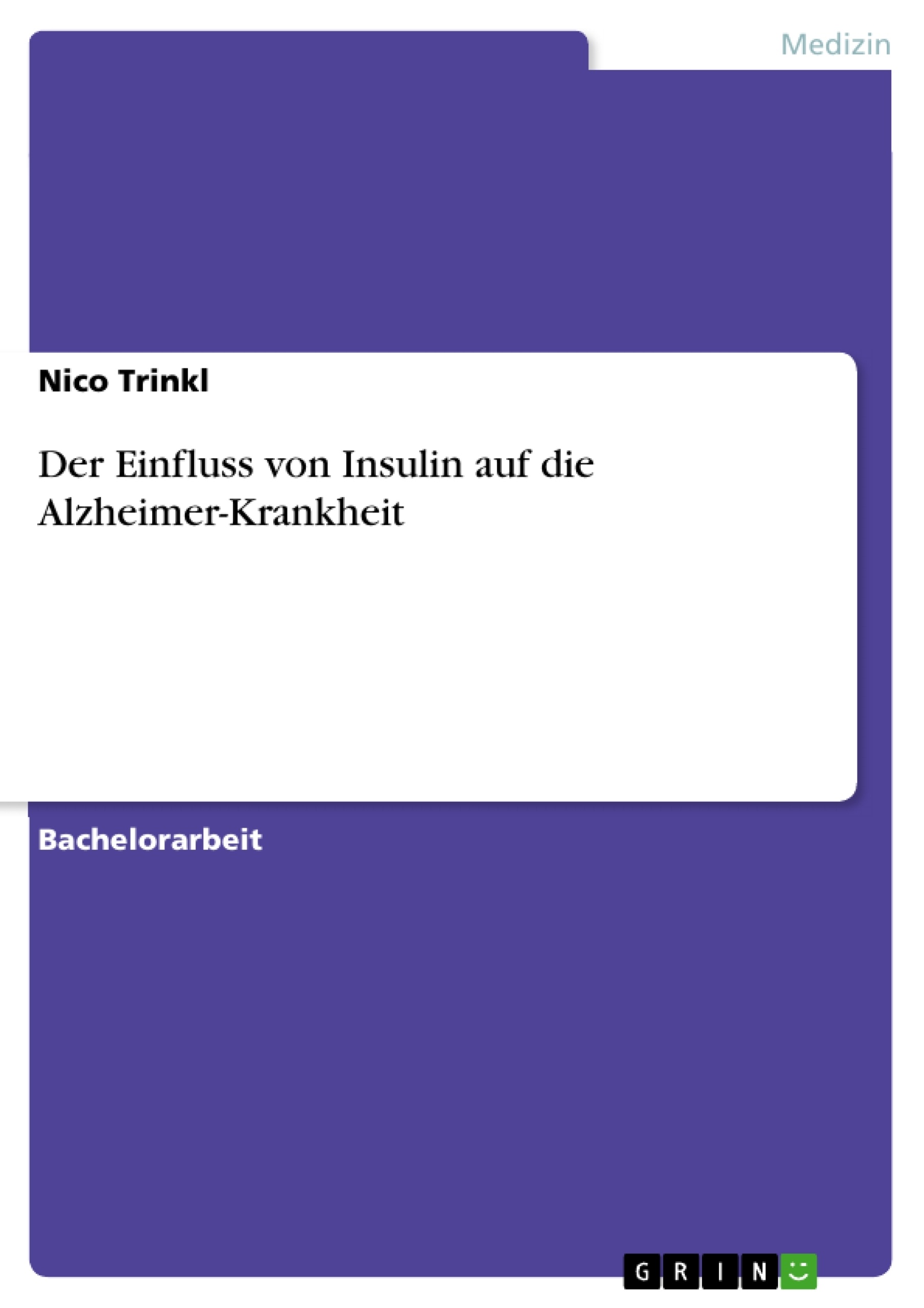In dieser Arbeit wird die Frage beantwortet, welche Rolle Insulin im peripheren und neuronalen Metabolismus einnimmt und in welcher Beziehung es zu der Ätiologie neurodegenerativer Erkrankungen steht. Dazu werden vorrangig aktuelle Studien zu dieser Thematik herangezogen und anschließend diskutiert. Besonders vertieft wird neben dem Wirkspektrum von Insulin die Pathogenese des Morbus Alzheimer und die facettenreichen Ansatzpunkte für eine mögliche Beziehung zwischen beiden. Des Weiteren soll ein Ausblick auf mögliche Therapie- und Präventionsstrategien gegeben werden, die Prävalenz- beziehungsweise Inzidenzfälle neurodegenerativer Krankheiten stark eindämmen könnten.
Im Jahr 1907 veröffentlichte der deutsche Neuropathologe und Psychiater Alois Alzheimer in der Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie einen kurzen Artikel unter dem Titel "Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde". Er beschrieb darin die neuropathologischen Veränderungen der weltweit ersten registrierten Alzheimer-Patientin, die der Krankheit nach vier Jahren im Alter von 51 Jahren nach fortschreitendem Gedächtnisverlust erlag. Neben einem rapide wachsenden Gedächtnisverlust war ihr Verhalten von Orientierungslosigkeit und Halluzinationen geprägt, eine Symptomatik, die sie von anderen bisher bekannten Fällen abgrenzte. Auffällig war zudem ihr vergleichsweise junges Alter. Nach ihrem Tod hatte Alzheimer mithilfe des Silberimprägnationsverfahrens herausgefunden, dass kleine Eiweißablagerungen, die er als "Miliarkörper" bezeichnete und die heute als Neuritische Plaques bekannt sind, und Neurofibrillenbündel im Gehirn, die Alzheimer als "dichte Fibrillenbündel" beschrieb, für die progressive Funktionseinschränkung, sowie das Absterben von Nervenzellen verantwortlich waren und konnte so die Erstbeschreibung der später nach ihm benannten Krankheit definieren.
Die Alzheimer-Demenz ist laut der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) eine primär degenerative zerebrale Krankheit mit unbekannter Ätiologie und charakteristischen neuropathologischen und neurochemischen Merkmalen. Sie beginnt meist schleichend und entwickelt sich langsam, aber stetig über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Die Alzheimer-Demenz ist für 60-80 Prozent aller Demenzerkrankungen verantwortlich und ist damit deren Hauptursache.
Inhaltsverzeichnis
- ABSTRACT
- ZUSAMMENFASSUNG
- EINLEITUNG
- EINSTIEG IN DIE THEMATIK
- ZIELSETZUNG
- THEORETISCHER HINTERGRUND
- MORBUS ALZHEIMER
- DEFINITIONEN
- FORMEN DER ALZHEIMER-DEMENZ
- DIAGNOSE
- PRÄVALENZ UND INZIDENZ
- SYMPTOMATIK
- PATHOGENESE
- INSULIN
- BIOCHEMISCHES PROFIL
- WIRKUNG VON INSULIN AUF DEN PERIPHEREN METABOLISMUS
- WIRKUNG VON INSULIN AUF DEN ZEREBRALEN METABOLISMUS
- DER EINFLUSS VON INSULIN AUF DIE ALZHEIMER-DEMENZ
- MÖGLICHE THERAPIE DURCH EXOGENE INSULINAPPLIKATION
- NEURODEGENERATION ALS FOLGE GESTÖRTER INSULINSIGNALISIERUNG
- PRÄVENTION UND MÖGLICHE THERAPIEANSÄTZE
- MINIMIERUNG DER RISIKOFAKTOREN
- NICHT-MEDIKAMENTÖSE INTERVENTIONEN
- DIE MEDITERRANE DIÄT
- DIE KETOGENE DIÄT
- MEDIKAMENTÖSE INTERVENTIONEN
- METHODE
- BESCHREIBUNG DER STRATEGIE DER LITERATURBESCHAFFUNG
- AUSWERTUNGSSTRATEGIE DER LITERATUR
- ERGEBNISSE
- STUDIEN, IN DENEN INSULIN DIE KOGNITION VERBESSERN KONNTE
- GESTÖRTE INSULINSIGNALISIERUNG ALS URSACHE DER NEURODEGENERATION
- INSULIN ALS URSACHE DER NEURODEGENERATION
- DISKUSSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen Insulin und der Alzheimer-Krankheit. Ziel ist es, den Einfluss von Insulin auf die Pathogenese, Symptomatik und Therapie der Alzheimer-Demenz zu untersuchen. Dabei werden die verschiedenen Aspekte der Insulinsensitivität und -resistenz im Gehirn beleuchtet, um die Mechanismen zu verstehen, die zur Neurodegeneration beitragen.
- Pathophysiologische Mechanismen der Alzheimer-Krankheit
- Die Rolle von Insulin im Gehirn und seine Relevanz für die kognitive Funktion
- Die Auswirkungen gestörter Insulinsensitivität und -resistenz auf die Entwicklung der Alzheimer-Krankheit
- Potenzielle Therapieansätze, die auf der Modulation der Insulinsensitivität basieren
- Aktuelle Forschungsansätze und Perspektiven zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in die Thematik der Alzheimer-Krankheit ein und definiert die wichtigsten Begriffe. Es erläutert verschiedene Formen der Erkrankung, die diagnostischen Kriterien, die Prävalenz und die Symptomatik.
- Kapitel zwei beschreibt das biochemische Profil von Insulin und seine vielseitigen Wirkungen auf den peripheren und den zentralen Stoffwechsel. Es werden die physiologischen Mechanismen der Insulinsensitivität und -resistenz erläutert.
- Kapitel drei fokussiert auf den Einfluss von Insulin auf die Alzheimer-Krankheit. Es werden verschiedene Studien vorgestellt, die die Rolle von Insulin bei der Entstehung und dem Fortschreiten der Erkrankung beleuchten.
- Kapitel vier analysiert die möglichen Therapieansätze zur Verbesserung der Insulinsensitivität im Gehirn und zur Prävention der Alzheimer-Krankheit. Es werden sowohl nicht-medikamentöse als auch medikamentöse Interventionsmöglichkeiten diskutiert.
- Das fünfte Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, die auf einer umfassenden Literaturrecherche basiert. Es werden die Kriterien für die Auswahl und die Auswertung der relevanten wissenschaftlichen Publikationen dargestellt.
- Kapitel sechs präsentiert die Ergebnisse der Literaturanalyse. Es werden Studien vorgestellt, die die Auswirkungen von Insulin auf die kognitive Funktion und die Entstehung der Alzheimer-Krankheit untersucht haben.
Schlüsselwörter
Alzheimer-Krankheit, Demenz, Insulin, Insulinsensitivität, Insulinsresistenz, Neurodegeneration, Synaptische Plastizität, Amyloid-Beta-Protein, Tau-Protein, Prävention, Therapie, Ketogene Diät, Mediterrane Diät.
- Quote paper
- Nico Trinkl (Author), 2017, Der Einfluss von Insulin auf die Alzheimer-Krankheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507434