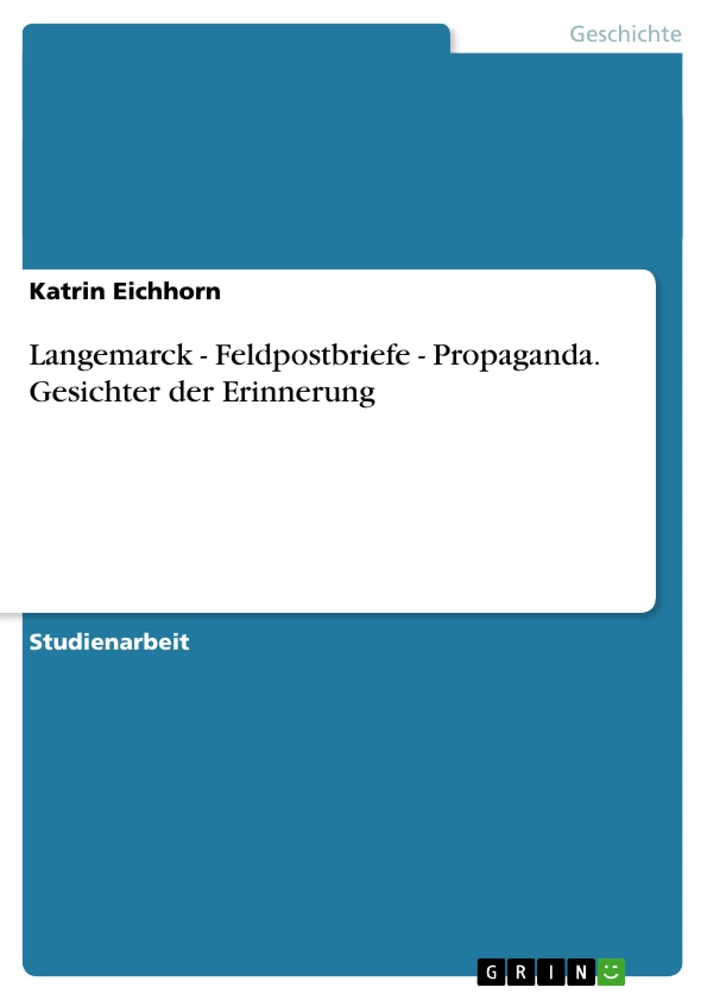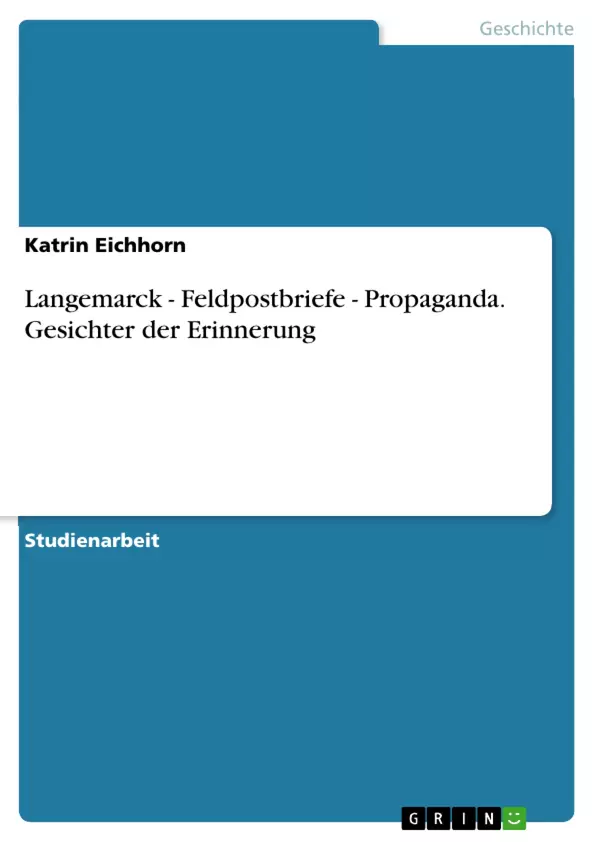I. Einleitung
Die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg in der Weimarer Zeit waren verschiedener Art. Am Beispiel der Schlacht bei Langemarck wird dies in vorliegender Arbeit erläutert. Die Bearbeitung eines solchen Themas scheint mir nicht möglich, ohne den Zusammenhang zu Feldpostbriefen herzustellen, da diese ein wahrhaftiges Erleben widerspiegeln. Die Analyse der Briefe zweier ausgesuchter Soldaten hilft hierbei, die Verschiedenartigkeit persönlichen Kriegserlebens darzulegen.
Doch wie wird aus persönlichem Erleben eine "offizielle" Erinnerung, die eine verlorene Schlacht zu einer Heldensaga werden lässt?
In der zielgerichteten politischen Instrumentalisierung der Feldpostbriefe sowie in der "Nachkriegspropaganda" zur Flandernschlacht ist die Antwort zu suchen.
Das Ziel meiner Arbeit ist es, ein umfassendes Bild verschiedener Sichtweisen von unterschiedlichen Ausgangspunkten auf den Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik zu erstellen.
Die gute Quellenlage zur Thematik lässt einen solchen Vergleich zu. Philipp Witkops Sammlung "Kriegsbriefe gefallener Studenten" und Reinhard Dithmars "Der Langemarck-Mythos in Dichtung und Unterricht" enthalten zahlreiche niedergeschriebene zeitgenössische Gedanken und bilden somit einen interessanten Einstieg in die Thematik.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die Schlacht bei Langemarck
- 2. Die unmittelbare Erinnerung: Der Feldpostbrief
- 2.1. Die Briefe Fritz Philipps'
- 2.2. Die Briefe Kurt Petersons
- 3. Die späte (konstruierte) Erinnerung
- 3.1. Ludwig Renn: Erinnerung von Links
- 3.2. Josef Magnus Wehner: Erinnerung von Rechts
- 4. Ergebnis: Verschiedene Erinnerungen an dieselbe Sache
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht verschiedene Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg, speziell die Schlacht bei Langemarck, in der Weimarer Republik. Sie analysiert die Diskrepanz zwischen persönlichem Kriegserleben, wie es in Feldpostbriefen zum Ausdruck kommt, und der späteren, politisch geprägten Erinnerung an die Schlacht. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der verschiedenen Sichtweisen und deren Entstehung zu zeichnen.
- Das persönliche Kriegserlebnis von Soldaten.
- Die Rolle von Feldpostbriefen als Quelle authentischer Erinnerungen.
- Die politische Instrumentalisierung der Schlacht von Langemarck.
- Der Unterschied zwischen unmittelbarer und später konstruierter Erinnerung.
- Die Konstruktion des „Langemarck-Mythos“
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der unterschiedlichen Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik ein. Sie fokussiert auf die Schlacht bei Langemarck als Fallbeispiel und betont die Bedeutung von Feldpostbriefen als Quelle für authentisches Kriegserleben. Die Arbeit hat zum Ziel, die verschiedenen Perspektiven und deren Entstehung zu vergleichen und zu analysieren, unterstützt durch die gute Quellenlage, insbesondere die Sammlungen von Philipp Witkop und Reinhard Dithmar.
1. Die Schlacht bei Langemarck: Dieses Kapitel beschreibt die Schlacht bei Langemarck im Herbst 1914 im Kontext des größeren Feldzugs in Flandern. Es erläutert die militärischen Ziele und den Verlauf der Schlacht, wobei der Fokus auf den letzten, erfolglosen Versuch der 4. Armee liegt, Ypern einzunehmen. Besonderes Augenmerk wird auf den Heeresbericht gelegt, der den Mythos von den „jungen Regimentern“, die unter dem Gesang von „Deutschland, Deutschland über alles“ in die Schlacht zogen, begründete – ein Ereignis, das den Grundstein für die spätere Mythisierung der Schlacht legte.
2. Die unmittelbare Erinnerung: Der Feldpostbrief: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung von Feldpostbriefen als Quelle für unmittelbare Kriegserinnerungen in der Weimarer Republik. Es werden die unterschiedlichen Inhalte dieser Briefe angesprochen, die zwischen entschiedener Ablehnung und eindeutiger Identifikation mit dem Krieg variierten. Die Sammlung „Kriegsbriefe gefallener Studenten“ von Philipp Witkop wird als zentrale Quelle vorgestellt, wobei kritisch die damalige weit verbreitete, aber falsche Annahme der hohen Anzahl von Kriegsfreiwilligen unter den Studenten in Flandern beleuchtet wird.
2.1. Die Briefe Fritz Philipps': Die Analyse der Briefe von Fritz Philipps zeigt das Spannungsfeld zwischen persönlichem Kriegserleben und der ideologischen Aufladung des Krieges. Während ein Brief eine relativ objektive Schilderung der Schlacht bietet, offenbaren andere Briefe Philipps’ Einstellung zum Krieg. Es wird hervorgehoben, wie diese Briefe eine mehrschichtige Perspektive auf den Krieg ermöglichen, die über eine einfache Helden- oder Opferdarstellung hinausgeht.
Schlüsselwörter
Erster Weltkrieg, Schlacht bei Langemarck, Feldpostbriefe, Weimarer Republik, Erinnerungskultur, Kriegspropaganda, Mythosbildung, persönliche Erfahrung, politische Instrumentalisierung, Kriegsromane.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verschiedene Erinnerungen an dieselbe Sache - Eine Analyse der Schlacht bei Langemarck
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht verschiedene Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg, speziell die Schlacht bei Langemarck in der Weimarer Republik. Sie analysiert die Diskrepanz zwischen persönlichem Kriegserleben (wie es in Feldpostbriefen zum Ausdruck kommt) und der späteren, politisch geprägten Erinnerung an die Schlacht. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der verschiedenen Sichtweisen und deren Entstehung zu zeichnen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Feldpostbriefe, insbesondere die Sammlungen von Philipp Witkop und Reinhard Dithmar. Sie analysiert auch die literarischen Darstellungen der Schlacht, z.B. von Ludwig Renn und Josef Magnus Wehner, um die unterschiedlichen Erinnerungskonstruktionen aufzuzeigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem persönlichen Kriegserlebnis von Soldaten, der Rolle von Feldpostbriefen als Quelle authentischer Erinnerungen, der politischen Instrumentalisierung der Schlacht von Langemarck, dem Unterschied zwischen unmittelbarer und später konstruierter Erinnerung und der Konstruktion des „Langemarck-Mythos“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Der Hauptteil analysiert die Schlacht bei Langemarck, die unmittelbare Erinnerung anhand von Feldpostbriefen (inkl. Analyse der Briefe von Fritz Philipps und Kurt Peterson), die spätere (konstruierte) Erinnerung (mit Fokus auf Ludwig Renn und Josef Magnus Wehner) und zieht abschließend ein Fazit zu den verschiedenen Erinnerungen an dasselbe Ereignis.
Welche Rolle spielen die Feldpostbriefe?
Feldpostbriefe bilden eine zentrale Quelle für die Untersuchung des unmittelbaren Kriegserlebens. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Inhalte dieser Briefe, die zwischen entschiedener Ablehnung und eindeutiger Identifikation mit dem Krieg variierten. Sie beleuchten das Spannungsfeld zwischen persönlicher Erfahrung und der ideologischen Aufladung des Krieges.
Wie wird der „Langemarck-Mythos“ behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entstehung und die Konstruktion des „Langemarck-Mythos“, der auf dem Heeresbericht basiert, welcher den Einsatz von „jungen Regimentern“, die unter dem Gesang von „Deutschland, Deutschland über alles“ in die Schlacht zogen, beschrieb. Diese Darstellung wurde später politisch instrumentalisiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt, wie unterschiedlich die Erinnerung an die Schlacht bei Langemarck ausgeprägt war und wie diese Erinnerungen durch politische Interessen beeinflusst und geformt wurden. Sie verdeutlicht die Bedeutung der Quellenkritik und die Notwendigkeit, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild der Vergangenheit zu erhalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Erster Weltkrieg, Schlacht bei Langemarck, Feldpostbriefe, Weimarer Republik, Erinnerungskultur, Kriegspropaganda, Mythosbildung, persönliche Erfahrung, politische Instrumentalisierung, Kriegsromane.
- Arbeit zitieren
- Katrin Eichhorn (Autor:in), 2002, Langemarck - Feldpostbriefe - Propaganda. Gesichter der Erinnerung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4971