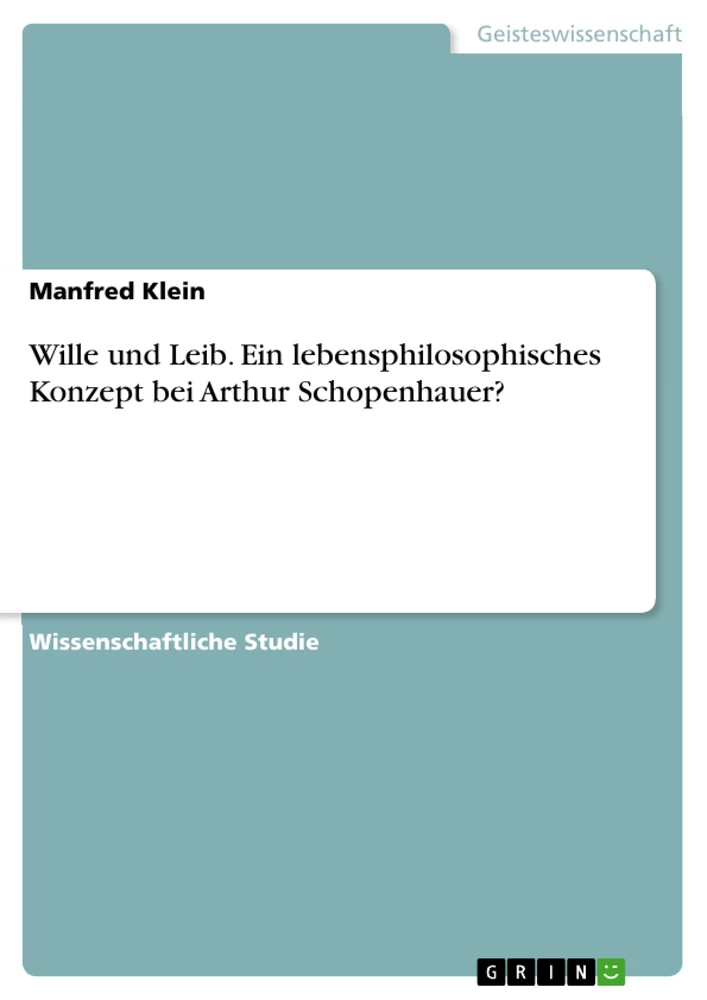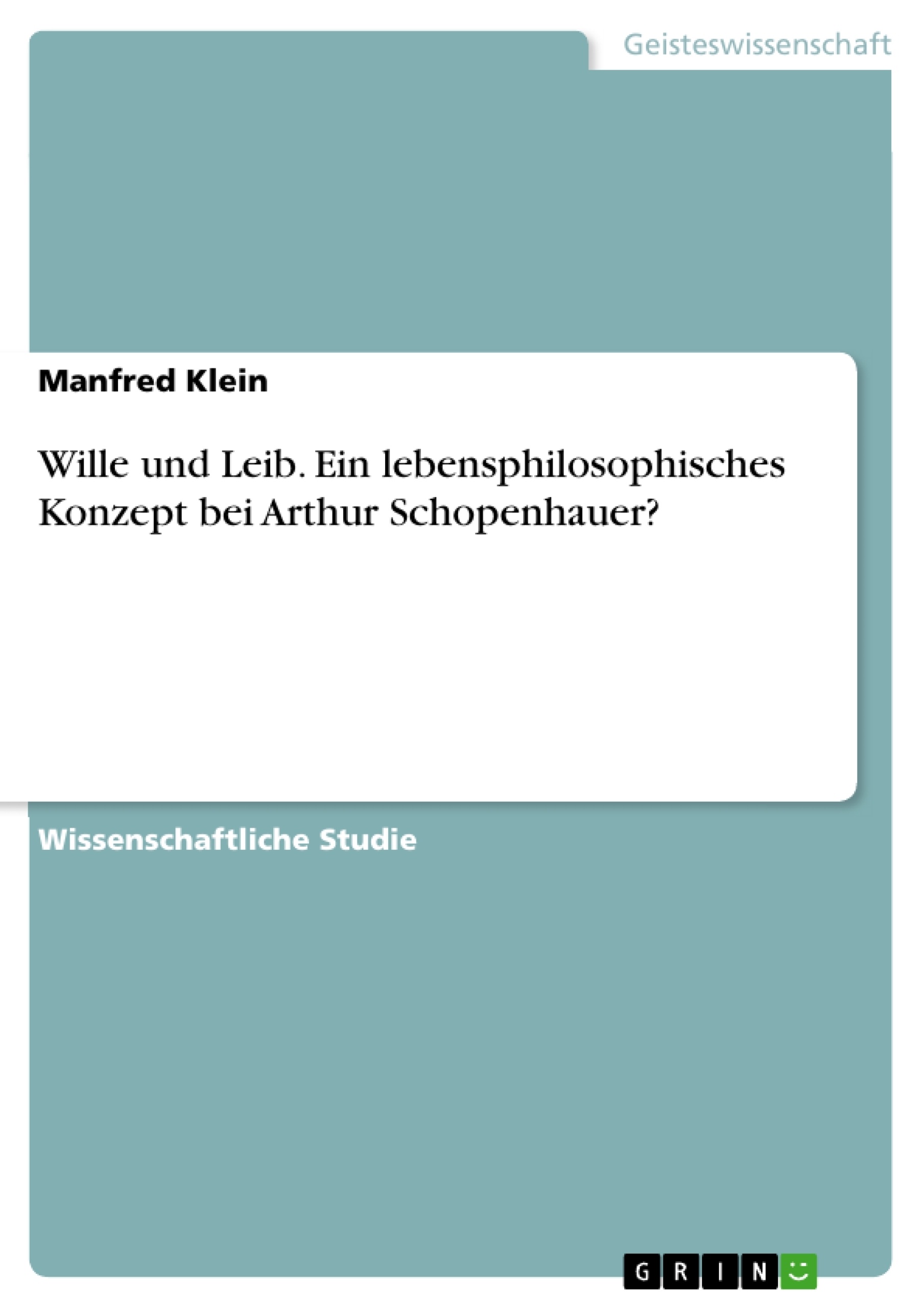Arthur Schopenhauer hat mit seiner Philosophie den Weg zurück zum Menschen eingeschlagen und damit vielleicht auch den Weg der jungen lebensphilosophischen Strömungen, die von der Romantik ausgingen, beschleunigt.
Wie dies Schopenhauer gelingen könnte, stellt der Autor in den Mittelpunkt der Arbeit und nähert sich besonders den weitreichenden Begriffen "Wille" und "Leib" an, die in seinem Denken eine große Rolle spielen. Die Philosophie vor Schopenhauer hatte den Leib als Teil des Menschen seit der Antike völlig außer Acht gelassen. Die Arbeit legt die leibphilosophischen Momente in Schopenhauers Denken offen und fragt gleichzeitig nach einem lebensphilosophischen Konzept des schopenhauerschen Wille zum Leben und Leib-Denkens.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Wille, Vorstellung, Leben
- Leiblichkeit und der Wille
- Wille zum Leben und die Realität
- Abgrenzungen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht Schopenhauers Philosophie im Kontext der Lebensphilosophie. Das Hauptziel ist es, Schopenhauers Beitrag zur Lebensphilosophie aufzuzeigen, indem die zentralen Konzepte "Wille" und "Leib" analysiert werden. Dabei wird auch auf die Punkte eingegangen, in denen sich Schopenhauer von der Lebensphilosophie unterscheidet.
- Schopenhauers Verhältnis zur Lebensphilosophie
- Die Rolle des Willens in Schopenhauers Philosophie
- Die Bedeutung des Leibes für Schopenhauers Konzept
- Der Wille zum Leben und seine Beziehung zur Realität
- Abgrenzung von Schopenhauers Philosophie zu anderen Strömungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Einordnung Schopenhauers in die Lebensphilosophie dar, heftet sich an die Schwierigkeit, Übereinstimmungen und Differenzen zu definieren. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit: Schopenhauers Wegbereitung für die Lebensphilosophie aufzuzeigen und gleichzeitig seine Abweichungen hervorzuheben. Schopenhauers Fokus auf den "Willen zum Leben" als ungestalteten Kern der Welt wird als wichtiger Aspekt im Hinblick auf die Lebensphilosophie hervorgehoben, ebenso seine Bedeutung für die philosophische Anthropologie durch seine Hinwendung zum Menschen. Die Verbindung zur Romantik wird angesprochen und Schlegels kritische Haltung gegenüber Schopenhauer erwähnt. Die Wirkung auf spätere Denker wird als Thema für den Schluss der Arbeit angekündigt. Schopenhauers Konzept des blinden, vernunftlosen Willens als Wesen der Welt und dessen Erörterbarkeit wird als besonderes Merkmal hervorgehoben, ebenso wie die Betonung der Bedeutung des Leibes für unser Erleben.
Wille, Vorstellung, Leben: Dieses Kapitel analysiert Schopenhauers Abkehr von der Vernunft hin zum Leben. Es erklärt, wie der Wille nicht gegen die Vernunft steht, sondern außerhalb von ihr und ihrem Gegenteil. Die Vernunft nimmt im Willenskonzept eine sekundäre Rolle ein. Schopenhauer betrachtet das logische Ich als unzureichend für die Erklärung des Selbstbewusstseins und sieht den Ursprung in der unmittelbaren Erfahrung des eigenen Willens. Dieser Wille wird als drängend, quälend und unstillbar beschrieben, als "beharrender" und "unveränderlicher" Kern des Bewusstseins. Es wird zwischen dem vorgestellten und dem unmittelbaren, unbewussten Willen unterschieden, der als triebhafter Drang zum Selbsterhalt verstanden wird, nicht aber als freier Wille im Sinne Kants. Die Bedeutung dieser Aufwertung des Willens und die damit verbundene Verschiebung im Denken wird herausgestellt. Der Wille und die Vorstellung werden als zwei substantielle Bestimmungen der Welt betrachtet, was als paradox erscheint. Schopenhauers Kantianismus wird anhand seines transzendentalen Idealismus erklärt, wonach die Welt ein Inbegriff von Erscheinungen ist, relativ zum Erkennenden. Trotz dieser idealistischen Sichtweise wird die Realität der erkannten Welt anerkannt, wobei Vorbehalte gegenüber dem berechenbaren Vorstellungszusammenhang geäußert werden.
Schlüsselwörter
Schopenhauer, Lebensphilosophie, Wille, Leib, Vorstellung, Wille zum Leben, Romantik, transzendentaler Idealismus, Selbstbewusstsein, Existenzphilosophie, Anthropologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Schopenhauers Philosophie im Kontext der Lebensphilosophie
Was ist der Inhalt dieser Studie?
Diese Studie analysiert Arthur Schopenhauers Philosophie im Kontext der Lebensphilosophie. Sie untersucht Schopenhauers Beitrag zur Lebensphilosophie, indem sie zentrale Konzepte wie "Wille" und "Leib" analysiert und die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Schopenhauers Philosophie und der Lebensphilosophie herausarbeitet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Studie behandelt folgende Themen: Schopenhauers Verhältnis zur Lebensphilosophie; die Rolle des Willens in Schopenhauers Philosophie; die Bedeutung des Leibes für Schopenhauers Konzept; der Wille zum Leben und seine Beziehung zur Realität; und die Abgrenzung von Schopenhauers Philosophie zu anderen Strömungen. Die Arbeit untersucht auch Schopenhauers Abkehr von der Vernunft hin zum Leben, die Bedeutung des Willens und der Vorstellung und die Beziehung zwischen dem Willen und dem Selbstbewusstsein.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Abstract, Einleitung, Wille, Vorstellung, Leben, Leiblichkeit und der Wille, Wille zum Leben und die Realität, Abgrenzungen und Literatur. Die Einleitung skizziert den Ansatz der Arbeit und die Problematik der Einordnung Schopenhauers in die Lebensphilosophie. Das Kapitel "Wille, Vorstellung, Leben" analysiert Schopenhauers Abkehr von der Vernunft hin zum Leben und die Rolle des Willens im Selbstbewusstsein. Weitere Kapitel befassen sich mit der Beziehung von Leib und Wille und der Abgrenzung Schopenhauers von anderen philosophischen Strömungen.
Wie wird Schopenhauers Verhältnis zur Lebensphilosophie dargestellt?
Die Studie untersucht sowohl die Übereinstimmungen als auch die Unterschiede zwischen Schopenhauers Philosophie und der Lebensphilosophie. Sie zeigt auf, wie Schopenhauer mit seinem Fokus auf den "Willen zum Leben" die Lebensphilosophie vorbereitet hat, aber gleichzeitig auch von ihr abweicht. Die Arbeit hebt Schopenhauers Konzept des blinden, vernunftlosen Willens als Wesen der Welt und dessen Erörterbarkeit hervor, ebenso wie die Betonung der Bedeutung des Leibes für unser Erleben.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Schopenhauer, Lebensphilosophie, Wille, Leib, Vorstellung, Wille zum Leben, Romantik, transzendentaler Idealismus, Selbstbewusstsein und Anthropologie.
Was ist das Hauptziel der Studie?
Das Hauptziel ist es, Schopenhauers Beitrag zur Lebensphilosophie aufzuzeigen, indem die zentralen Konzepte "Wille" und "Leib" analysiert werden. Die Arbeit soll sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede zwischen Schopenhauers Philosophie und der Lebensphilosophie hervorheben.
Welche Rolle spielt der Wille in Schopenhauers Philosophie?
Der Wille spielt in Schopenhauers Philosophie eine zentrale Rolle. Er wird als drängend, quälend und unstillbar beschrieben, als "beharrender" und "unveränderlicher" Kern des Bewusstseins. Schopenhauer unterscheidet zwischen dem vorgestellten und dem unmittelbaren, unbewussten Willen, der als triebhafter Drang zum Selbsterhalt verstanden wird. Die Vernunft nimmt im Willenskonzept eine sekundäre Rolle ein.
Wie wird der Leib in Schopenhauers Philosophie betrachtet?
Der Leib spielt eine wichtige Rolle für Schopenhauers Konzept. Die Studie hebt die Betonung der Bedeutung des Leibes für unser Erleben hervor. Die genaue Beziehung zwischen Leib und Wille wird im Detail analysiert.
- Quote paper
- Dr. Manfred Klein (Author), 2019, Wille und Leib. Ein lebensphilosophisches Konzept bei Arthur Schopenhauer?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496856