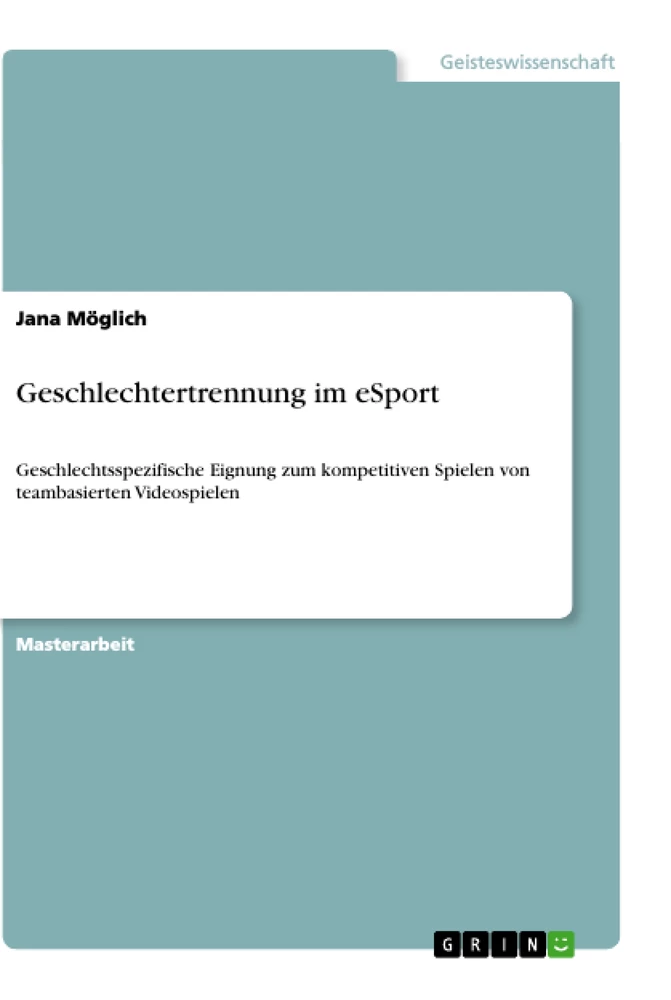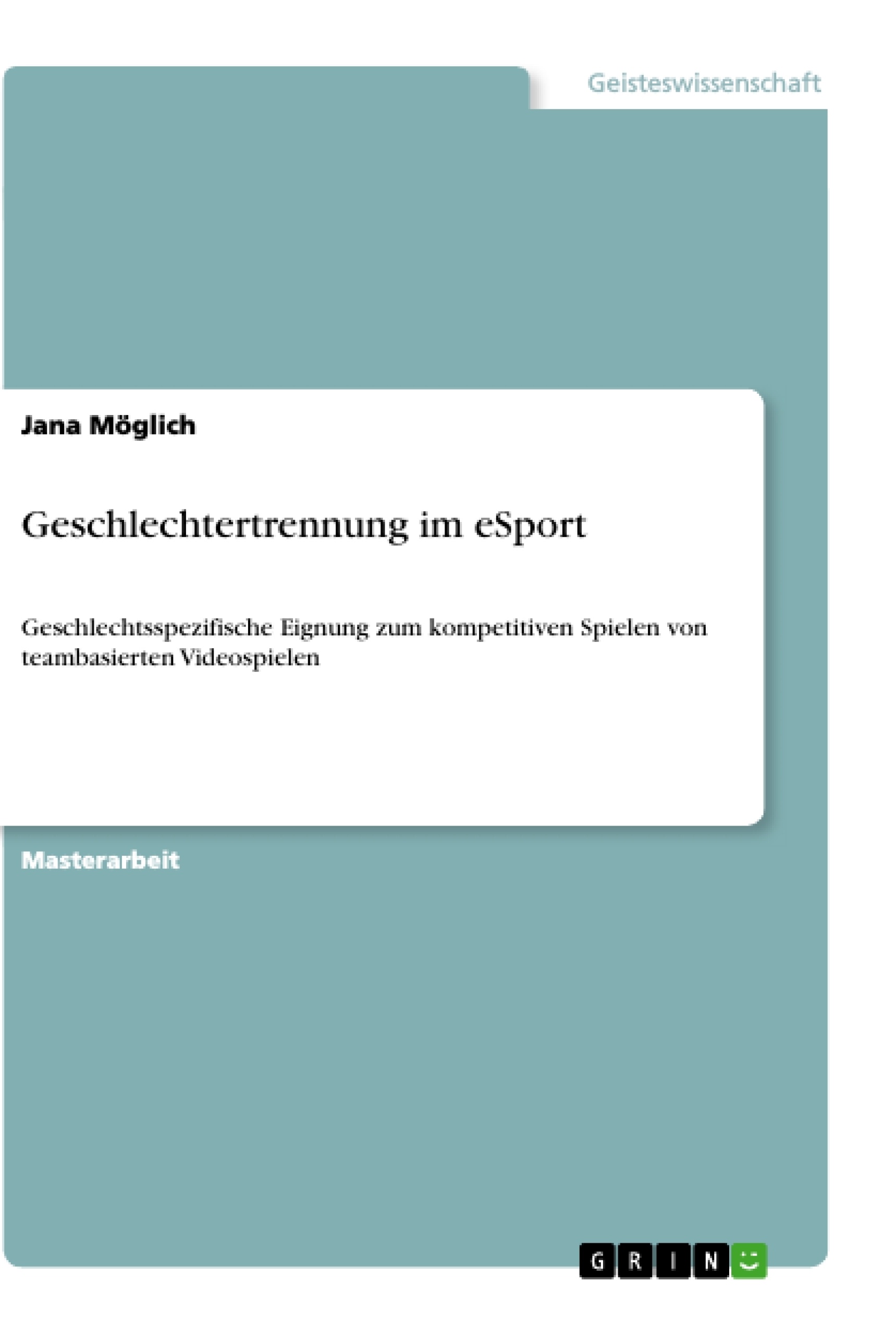In dieser Arbeit soll die geschlechtsspezifische Eignung zum Spielen von eSport-Titeln anhand des Beispiels COUNTER STRIKE: GO herausgearbeitet werden. Zu diesem Zweck werden zunächst die wichtigsten kognitiven Fertigkeiten von eSportler*innen aufgrund fehlender wissenschaftlicher Befunde basierend auf Einschätzungen zahlreicher Szene-Größen sowie eigens durchgeführter Interviews mit eSport-Enthusiast*innen zusammengetragen. Es folgt eine Literaturrecherche zur Geschlechterforschung ausgehend von der Frage, inwiefern die relevanten kognitiven Fähigkeiten geschlechterspezifisch sind.
Schließlich wird im Zuge einer Beobachtung ein Vergleich zwischen weiblichem und männlichem Spielverhalten durchgeführt, sodass Aussagen über die Eignung zum kompetitiven Spielen von Videospielen ermöglicht werden. Abschließend werden die Untersuchungsergebnisse ausgehend von der These, dass Frauen vergleichbare eSport-relevante Fähigkeiten aufweisen wie Männer, kritisch reflektiert und untersucht, wie Theorie und praktizierte Realität zusammenwirken.
Das Spielen von Videospielen ist seit jeher gesellschaftlich betrachtet eine typisch männliche Tätigkeit, wodurch Frauen in der Spielegemeinschaft stets deutlich unterrepräsentiert waren. So verhielt es sich, als Gaming noch ausschließlich als Hobby betrieben wurde, wobei die Frauen hier im Laufe der Jahrzehnte aufgeholt und die männlichen Spieler in einzelnen Genres gar überholt haben. Mit zunehmender Professionalisierung von Gaming entstand mit der Zeit das wettbewerbsorientierte Spielen oder auch der eSport. In unserer heutigen Zeit ein großes Thema, das immer mehr Einzug in die Öffentlichkeit findet. Doch trotz seines inklusiven Potenzials und zunehmender Teilhabe von Frauen am Szenegeschehen zeigen sich kaum Ansätze zur Gleichberechtigung der Geschlechter.
Tatsächlich verhält es sich eher rückläufig, indem bei prestigeträchtigen Wettkämpfen explizite Frauenturniere angeboten werden. Es stellt sich die Frage nach der Begründung für diese Abgrenzung, da in der kognitiven Disziplin eSport die geschlechtsspezifischen physischen Unterschiede zwischen Frau und Mann augenscheinlich nicht zum Tragen kommen.
Ob nun abgegrenzt oder nicht, Frauen machen immer noch nur einen Bruchteil der Profis aus. Darauf aufbauend wurde in der Community die Annahme populär, dass weibliche Gamer nicht die nötigen Fähigkeiten für das professionelle Spielen von Videospielen mitbringen, um mit ihren männlichen Konkurrenten mithalten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entwicklung des eSports
- 2.1 Frauen im eSport
- 2.2 Esport-relevante Fähigkeiten
- 2.3 Anerkennung als Sportart
- 3. Geschlechtsspezifische Merkmale
- 3.1 Biologische Komponente
- 3.2 Sozialpsychologische Komponente
- 4. Expert*innenbefragung
- 4.1 Planung
- 4.2 Durchführung
- 4.3 Auswertung
- 5. Verhaltensanalyse
- 5.1 Planung
- 5.2 Durchführung
- 5.3 Auswertung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschlechtsspezifische Eignung für kompetitives Spielen von teambasierten Videospielen, speziell im eSport, am Beispiel von Counter-Strike: Global Offensive. Ziel ist es, die Annahme zu überprüfen, dass Frauen aufgrund fehlender Fähigkeiten weniger geeignet seien. Hierzu werden relevante kognitive Fähigkeiten von professionellen Gamer*innen identifiziert, geschlechtsspezifische Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten aus der Forschung beleuchtet und schließlich das Spielverhalten von Frauen und Männern verglichen.
- Kognitive Fähigkeiten professioneller Gamer*innen
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten
- Vergleich des Spielverhaltens von Frauen und Männern in Counter-Strike: Global Offensive
- Analyse der Geschlechtertrennung im professionellen eSport
- Bewertung der Eignung von Frauen für kompetitives Gaming
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Unterrepräsentation von Frauen im Gaming und eSport dar und führt in die Thematik der Geschlechtertrennung in professionellen eSports-Wettbewerben ein. Sie beleuchtet den Wandel im Casual Gaming, wo Frauen mittlerweile einen hohen Anteil an Spielerinnen ausmachen, im Gegensatz zum kompetitiven Bereich. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage der geschlechtsspezifischen Eignung für kompetitives Spielen und skizziert den Forschungsansatz.
2. Entwicklung des eSports: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des eSports, die zunehmende Professionalisierung des Gamings und die damit verbundene Debatte um die Anerkennung als Sportart. Es analysiert die Rolle von Frauen in der Entwicklung des eSports, sowohl als Spielerinnen als auch als Zuschauerinnen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Geschlechterverhältnis in verschiedenen eSport-Genres und der wachsenden Bedeutung des eSports-Marktes gewidmet. Der starke Anstieg der weiblichen Zuschauerzahlen wird ebenso behandelt wie der Mangel an weiblichen Profispielerinnen trotz des wachsenden Interesses.
3. Geschlechtsspezifische Merkmale: Dieses Kapitel untersucht biologische und sozialpsychologische Faktoren, die potentiell geschlechtsspezifische Unterschiede im kompetitiven Gaming beeinflussen könnten. Es analysiert die relevante Literatur der Geschlechterforschung, um vorhandene Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten zu beleuchten und diese im Kontext von eSport-relevanten Fähigkeiten zu bewerten. Es werden hier wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt um das Verständnis der möglichen Einflussfaktoren zu fördern.
4. Expert*innenbefragung: Dieses Kapitel beschreibt die Planung, Durchführung und Auswertung einer Expert*innenbefragung. Die Befragung von Experten aus dem eSport-Bereich dient dazu, die relevanten kognitiven Fähigkeiten für professionelles Spielen in Counter-Strike: Global Offensive zu identifizieren und die Perspektiven von Brancheninsidern zu den Fragestellungen der Arbeit zu ermitteln. Die Methodik der Befragung und die Ergebnisse werden detailliert dargestellt.
5. Verhaltensanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die Planung, Durchführung und Auswertung einer Verhaltensanalyse. Die Analyse des Spielverhaltens von weiblichen und männlichen Spieler*innen in Counter-Strike: Global Offensive dient dazu, geschlechtsspezifische Unterschiede im Spielstil und in der Performance zu identifizieren. Die Methodik der Verhaltensanalyse sowie die gewonnenen Erkenntnisse werden detailliert beschrieben und ausgewertet.
Schlüsselwörter
eSport, kompetitives Gaming, Geschlechtertrennung, geschlechtsspezifische Eignung, kognitive Fähigkeiten, Counter-Strike: Global Offensive, Geschlechterforschung, Verhaltensanalyse, Expert*innenbefragung, Gamer*innen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Geschlechtsspezifische Eignung im kompetitiven Gaming
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die geschlechtsspezifische Eignung für kompetitives Spielen in teambasierten Videospielen, insbesondere im eSport, am Beispiel von Counter-Strike: Global Offensive. Sie hinterfragt die Annahme, dass Frauen aufgrund fehlender Fähigkeiten weniger geeignet sind.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Annahme der geringeren Eignung von Frauen im kompetitiven Gaming zu überprüfen. Dazu werden relevante kognitive Fähigkeiten professioneller Gamer*innen identifiziert, geschlechtsspezifische Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten aus der Forschung beleuchtet und das Spielverhalten von Frauen und Männern verglichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt kognitive Fähigkeiten professioneller Gamer*innen, geschlechtsspezifische Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten, einen Vergleich des Spielverhaltens von Frauen und Männern in Counter-Strike: Global Offensive, die Analyse der Geschlechtertrennung im professionellen eSport und die Bewertung der Eignung von Frauen für kompetitives Gaming.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Expert*innenbefragung zur Identifizierung relevanter kognitiver Fähigkeiten und zur Einholung von Branchenperspektiven. Zusätzlich wird eine Verhaltensanalyse des Spielverhaltens von Frauen und Männern in Counter-Strike: Global Offensive durchgeführt, um geschlechtsspezifische Unterschiede zu identifizieren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Entwicklung des eSports, geschlechtsspezifische Merkmale, Expert*innenbefragung, Verhaltensanalyse und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die Unterrepräsentation von Frauen im Gaming und eSport dar und führt in die Thematik der Geschlechtertrennung in professionellen eSports-Wettbewerben ein. Sie beleuchtet den Wandel im Casual Gaming und skizziert den Forschungsansatz.
Was wird im Kapitel zur Entwicklung des eSports behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des eSports, die Professionalisierung des Gamings und die Debatte um die Anerkennung als Sportart. Es analysiert die Rolle von Frauen im eSports, das Geschlechterverhältnis in verschiedenen Genres und den wachsenden eSports-Markt.
Was wird im Kapitel zu geschlechtsspezifischen Merkmalen behandelt?
Dieses Kapitel untersucht biologische und sozialpsychologische Faktoren, die geschlechtsspezifische Unterschiede im kompetitiven Gaming beeinflussen könnten. Es analysiert die Literatur der Geschlechterforschung und bewertet vorhandene Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten im Kontext des eSports.
Was wird in den Kapiteln zur Expert*innenbefragung und Verhaltensanalyse behandelt?
Diese Kapitel beschreiben die Planung, Durchführung und Auswertung einer Expert*innenbefragung und einer Verhaltensanalyse in Counter-Strike: Global Offensive. Sie dienen der Identifizierung relevanter kognitiver Fähigkeiten und der Analyse geschlechtsspezifischer Unterschiede im Spielstil und der Performance.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
eSport, kompetitives Gaming, Geschlechtertrennung, geschlechtsspezifische Eignung, kognitive Fähigkeiten, Counter-Strike: Global Offensive, Geschlechterforschung, Verhaltensanalyse, Expert*innenbefragung, Gamer*innen.
- Arbeit zitieren
- Jana Möglich (Autor:in), 2018, Geschlechtertrennung im eSport, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494223