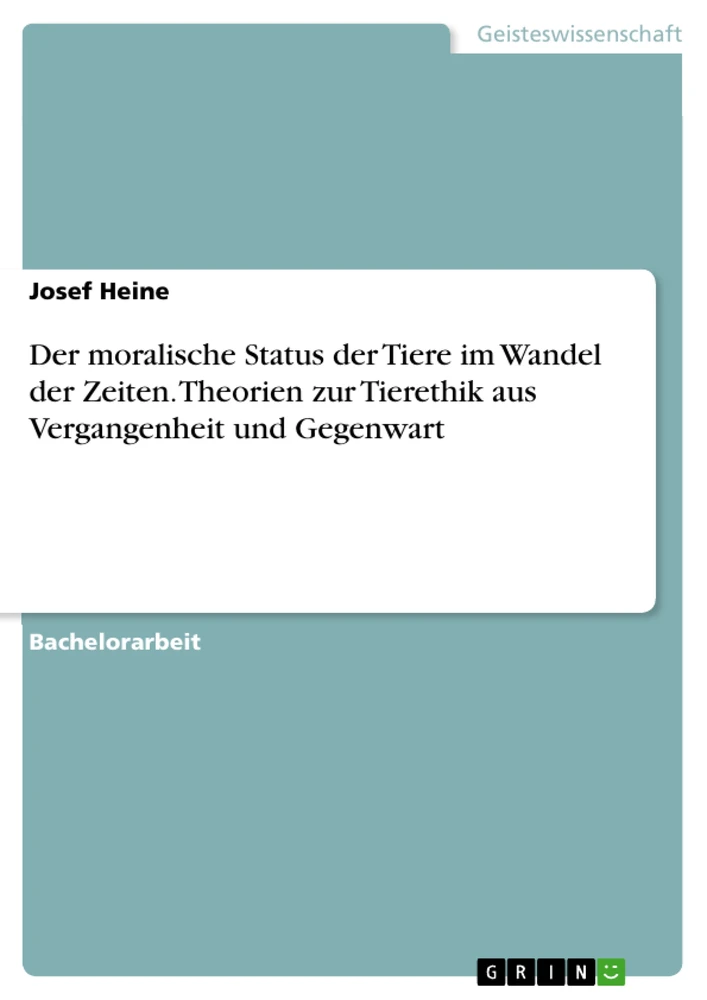Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf wichtige ethische Konzeptionen der Vergangenheit und auf zwei heute in der Gesellschaft dominierende Theorien zur Tierethik - die anthropozentrische Theorie von Kant und die pathozentrische Theorie von Singer.
Beide Theorien werden in ihren Grundzügen dargestellt, eine Diskussion der umfangreichen Kritik und den aus dieser Kritik resultierenden Abwandlungen und Ergänzungen der ursprünglichen Theorien unterbleibt. Aktuell diskutierte Fragen zur Tierethik werden in diese Arbeit nur insoweit einbezogen, wie sie von grundsätzlicher Bedeutung für die behandelten Theorien sind.
Nach der Darlegung der Erkenntnisse erfolgt, mit speziellem Hinblick auf die deutsche Öffentlichkeit, ein abschließendes Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der prähistorische Glaube an das Verhältnis von Mensch und Tier
- 3. Der moralische Status des Tieres in der abendländischen Geistesgeschichte
- 3.1 Die Ausgangsituation zu Beginn der Antike
- 3.2 Die Stellung des Tieres in der Tugendethik des Aristoteles
- 3.3 Der christliche Ansatz des Tierschutzes
- 3.3.1 Das Tier im Alten Testament
- 3.3.2 Das Tier im Neuen Testament
- 3.3.3 Neue Ansätze für eine christliche Mitleidsethik
- 4. Die moralische Status des Tieres in der Neuzeit
- 4.1 Der anthropozentrische Tierethik in Kants deontologischer Ethik
- 4.1.1 Die Ausgangssituation zu Beginn der Neuzeit
- 4.1.2 Kants Pflichtenethik
- 4.1.3 Die Stellung des Tieres in Kants Ethik
- 4.1.4 Anthropozentrische Tierethik heute
- 4.2 Die pathozentrische Tierethik in Peter Singers Präferenzutilitarismus
- 4.2.1 Der moralische Status des Tieres in der Mitte des 20. Jahrhunderts
- 4.2.2 Peter Singers neuer tierethischer Ansatz
- 4.2.3 Die Grenzen der Akzeptanz von Singers pathozentrischer Tierethik
- 5. Fazit und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel des moralischen Status von Tieren im Laufe der Geschichte, mit Fokus auf westliche Denkschulen. Ziel ist es, wichtige ethische Konzeptionen der Vergangenheit und zwei heute dominante Theorien – den anthropozentrischen Ansatz Kants und den pathozentrischen Ansatz Singers – zu präsentieren. Die Arbeit beschränkt sich auf die Darstellung der Grundzüge dieser Theorien, ohne detailliert auf Kritik und Weiterentwicklungen einzugehen.
- Der Wandel des Mensch-Tier-Verhältnisses von der Prähistorie bis zur Gegenwart
- Der anthropozentrische Ansatz in der Tierethik (Kant)
- Der pathozentrische Ansatz in der Tierethik (Singer)
- Die Herausforderungen und Ambivalenzen in der modernen Tierethik
- Die Rolle von Mythen und Religionen im Verständnis des Mensch-Tier-Verhältnisses
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung begründet die Notwendigkeit historischer Betrachtungen des Umgangs mit Tieren für die heutige tierschutzethische Diskussion. Sie betont die Entwicklung einer Tierethik, die dem Tier moralischen Wert zuspricht, und die unterschiedlichen Auffassungen darüber in der heutigen Gesellschaft. Die Arbeit konzentriert sich auf die Tierethik im westlichen Kulturkreis und behandelt die anthropozentrische Theorie Kants und die pathozentrische Theorie Singers.
2. Der prähistorische Glaube an das Verhältnis von Mensch und Tier: Dieses Kapitel beleuchtet das Verhältnis von Mensch und Tier in der Urzeit, bevor Tiere domestiziert wurden. Es beschreibt die Verehrung von Jagdtieren und die Ambivalenz der Gefühle: Angst vor Rache der getöteten Tiere, Schuldgefühle der Jäger, aber auch eine Gleichstellung von Mensch und Tier in einigen Mythen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Mythen und Riten, die ein komplexes und nicht rein utilitaristisches Verhältnis zum Tier belegen. Die Rituale zeigten weniger moralische Bedenken als pragmatische Ängste vor dem Verlust der Nahrungsquelle und göttlicher Bestrafung.
3. Der moralische Status des Tieres in der abendländischen Geistesgeschichte: Dieses Kapitel skizziert die Entwicklung des moralischen Status von Tieren in der abendländischen Philosophie und Theologie, beginnend mit der Antike. Es untersucht die verschiedenen Positionen und philosophischen Ansätze, um die sich verändernde Betrachtung des Tieres aufzuzeigen und den Weg hin zu einer differenzierteren Tierethik zu beleuchten. Die Analyse der antiken und christlichen Sichtweisen auf den moralischen Status von Tieren bildet die Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der modernen Tierethik.
4. Die moralische Status des Tieres in der Neuzeit: Dieses Kapitel analysiert zwei einflussreiche moderne Ansätze in der Tierethik: Kants anthropozentrische und Singers pathozentrische Position. Es erläutert die Grundprinzipien beider Ansätze, deren jeweilige Argumentationslinien und ihre unterschiedlichen Schlussfolgerungen für den Umgang mit Tieren. Der Vergleich beider Theorien hebt die zentralen Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervor und verdeutlicht die Herausforderungen und Komplexitäten der zeitgenössischen Diskussionen um den moralischen Status von Tieren.
Schlüsselwörter
Tierethik, Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Kant, Singer, Mensch-Tier-Verhältnis, Moral, Ethik, Geschichte, Mythen, Religion, Jagd, Domestikation, Tierwohl.
Häufig gestellte Fragen zu: Der moralische Status des Tieres in der Geschichte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des moralischen Status von Tieren im Laufe der Geschichte, insbesondere im westlichen Kulturkreis. Der Fokus liegt auf der Darstellung wichtiger ethischer Konzeptionen der Vergangenheit und der Analyse zweier dominanter moderner Theorien: des anthropozentrischen Ansatzes Kants und des pathozentrischen Ansatzes Singers.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Mensch-Tier-Verhältnisses von der Prähistorie bis zur Gegenwart, den anthropozentrischen Ansatz in der Tierethik (Kant), den pathozentrischen Ansatz (Singer), die Herausforderungen der modernen Tierethik, und die Rolle von Mythen und Religionen im Verständnis des Mensch-Tier-Verhältnisses. Es werden die Grundzüge der genannten Theorien dargestellt, ohne detailliert auf Kritik und Weiterentwicklungen einzugehen.
Welche Epochen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung des moralischen Status von Tieren von der Prähistorie über die Antike und das Mittelalter bis in die Neuzeit. Sie analysiert dabei verschiedene philosophische und theologische Ansätze, um die sich verändernde Betrachtungsweise des Tieres aufzuzeigen.
Welche philosophischen Ansätze werden verglichen?
Im Mittelpunkt stehen der anthropozentrische Ansatz Immanuel Kants und der pathozentrische Ansatz Peter Singers. Die Arbeit erläutert die Grundprinzipien beider Ansätze, ihre Argumentationslinien und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen für den Umgang mit Tieren. Ein Vergleich beider Theorien verdeutlicht deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der prähistorische Glaube an das Verhältnis von Mensch und Tier, Der moralische Status des Tieres in der abendländischen Geistesgeschichte, Der moralische Status des Tieres in der Neuzeit, und Fazit und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Entwicklung des moralischen Status von Tieren.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die wichtigsten ethischen Konzeptionen zum Thema Mensch-Tier-Verhältnis historisch zu beleuchten und zwei einflussreiche moderne Theorien zu präsentieren. Es soll ein Verständnis für die Komplexität und die Herausforderungen der zeitgenössischen Diskussion um den moralischen Status von Tieren vermittelt werden.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Tierethik, Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Kant, Singer, Mensch-Tier-Verhältnis, Moral, Ethik, Geschichte, Mythen, Religion, Jagd, Domestikation, Tierwohl.
Welche Quellen werden verwendet?
(Die HTML-Datei enthält keine explizite Quellenangabe. Diese Information fehlt.)
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
(Die HTML-Datei enthält keine explizite Zielgruppenangabe. Diese Information fehlt.)
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die HTML-Datei enthält Kapitelzusammenfassungen, welche die Kernaussagen jedes Kapitels kurz und prägnant beschreiben.
- Citar trabajo
- Josef Heine (Autor), 2016, Der moralische Status der Tiere im Wandel der Zeiten. Theorien zur Tierethik aus Vergangenheit und Gegenwart, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494207