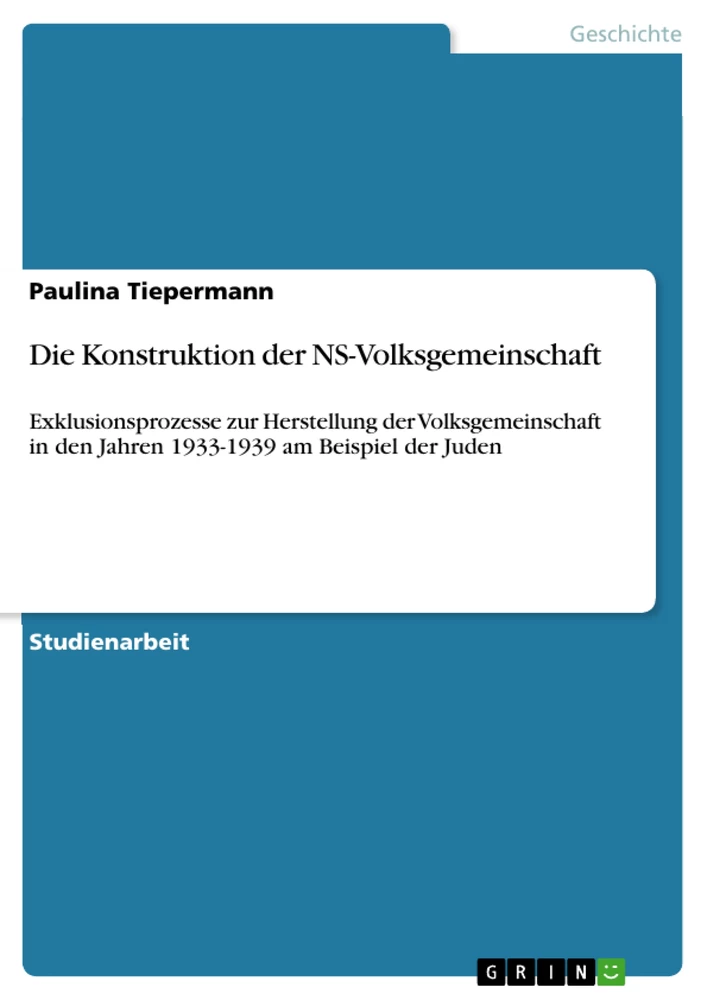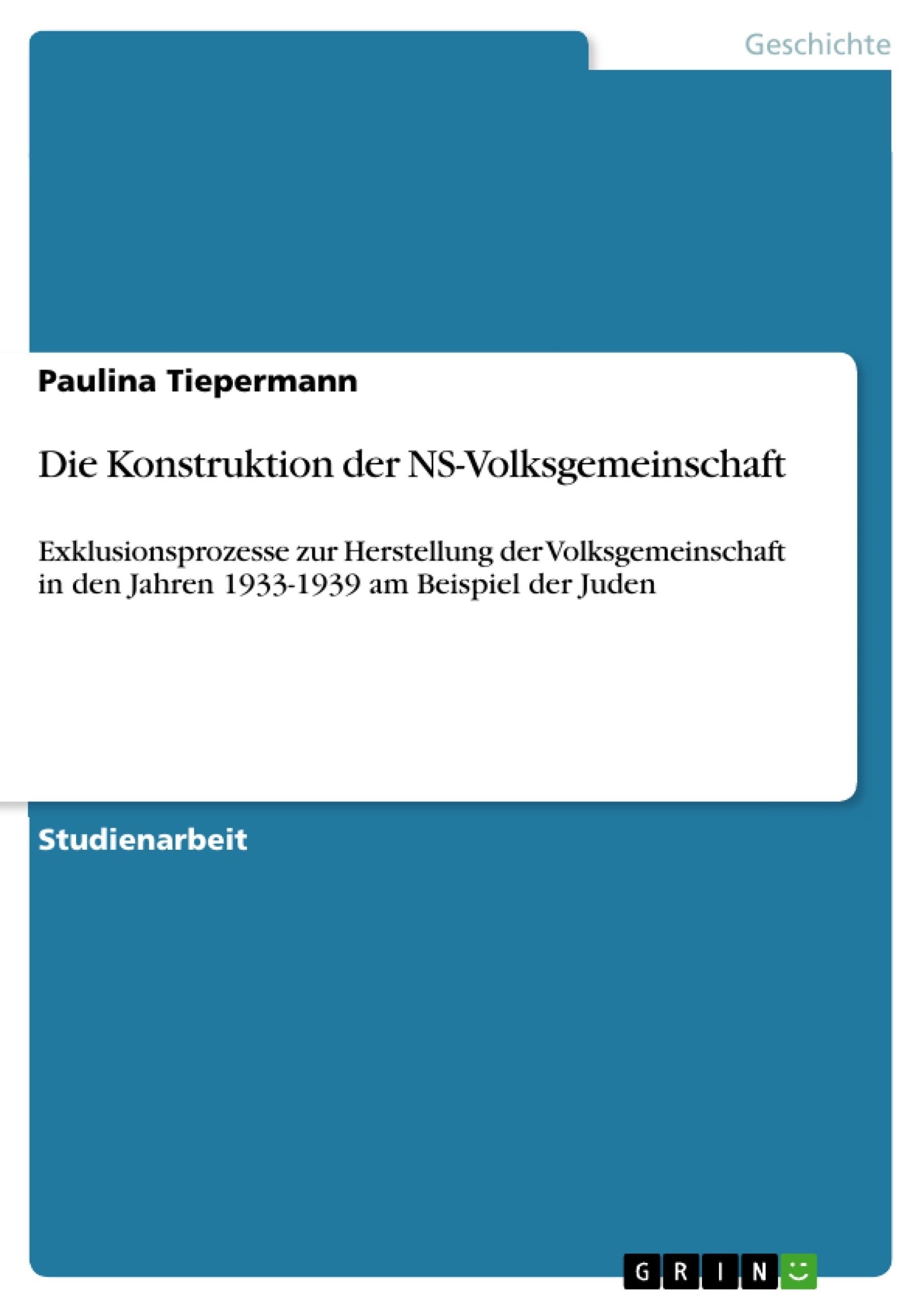In der vorliegenden Arbeit wird die Fragestellung behandelt, in welchem Zusammenhang die Exklusionsprozesse im Dritten Reich zu Lasten der deutschen Juden mit der Herstellung der „NS-Volksgemeinschaft“ stehen? Es wird die These verfolgt, dass der Prozess der Exklusion sowohl Mittel zur Herstellung der “NS-Volksgemeinschaft“ war, als auch das Volksgemeinschaftsprojekt in Wechselwirkung eine Legitimation zur Verfolgung und Vernichtung der deutschen Juden darstellte. Die Endlösung war in diesem sukzessiven Prozess das gut vorbereitete Ziel der Politik des NS-Regimes.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Volksgemeinschaft in der NS-Ideologie
- 2.1 Entwicklung des Begriffs "Volksgemeinschaft"
- 3. Exklusionsprozesse in den Jahren 1933-1939 am Beispiel der Juden
- 3.1 Im Zeitraum von 1933-1935
- 3.2 Im Zeitraum von 1935-1939
- 4. Die volksgemeinschaftliche Grenze der systematischen Vernichtung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Exklusionsprozessen gegenüber deutschen Juden im Dritten Reich und der Konstruktion der NS-Volksgemeinschaft. Die zentrale These ist, dass die Exklusion sowohl Mittel zur Herstellung der "NS-Volksgemeinschaft" war, als auch durch das Volksgemeinschaftsprojekt selbst legitimiert wurde. Die Arbeit analysiert die sukzessive Entwicklung dieses Prozesses und dessen Ziel, die systematische Vernichtung der Juden.
- Entwicklung des Begriffs "Volksgemeinschaft" in der NS-Ideologie
- Exklusionsmechanismen gegen deutsche Juden (1933-1939)
- Die Rolle der Bevölkerung bei der öffentlichen Demütigung von Juden
- Der Zusammenhang zwischen Exklusion und der Legitimation der Verfolgung
- Die "Volksgemeinschaft" als Mythos versus soziale Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert eine Fotografie aus dem Jahr 1935, die die öffentliche Demütigung von Juden zeigt. Sie dient als Ausgangspunkt für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Exklusionsprozessen und der Konstruktion der NS-Volksgemeinschaft. Die Arbeit stellt die These auf, dass die Exklusion sowohl Mittel als auch Ergebnis des Projekts "Volksgemeinschaft" war und die systematische Vernichtung der Juden als Ziel hatte. Die Einleitung skizziert den Forschungsstand und den Aufbau der Arbeit, wobei der Fokus auf der Praxis der Exklusion im deutschen Raum und der Opfergruppe der Juden liegt.
2. Die Volksgemeinschaft in der NS-Ideologie: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Begriffs "Volksgemeinschaft" innerhalb der NS-Ideologie. Es analysiert die ideologischen Grundlagen und die Bedeutung des Konzepts für die nationalsozialistische Politik. Es wird beleuchtet, wie die "Volksgemeinschaft" als ein reines, homogenes Kollektiv konstruiert wurde, das von allen als "Volksfeinde" identifizierten Gruppen ausgeschlossen war. Der Begriff wird im Kontext von Propaganda und politischer Manipulation analysiert. Die Analyse untersucht auch, wie die Ideologie der "Volksgemeinschaft" die gesellschaftliche Akzeptanz von Unterdrückung und Gewalt schürte.
3. Exklusionsprozesse in den Jahren 1933-1939 am Beispiel der Juden: Dieses Kapitel analysiert die Exklusionsprozesse gegen deutsche Juden im Zeitraum von 1933 bis 1939, unterteilt in die Phasen 1933-1935 und 1935-1939. Es beleuchtet die zunehmende Ausgrenzung und Verfolgung der Juden durch gesetzliche Maßnahmen, soziale Diskriminierung und öffentliche Demütigungen. Das Kapitel untersucht die verschiedenen Strategien der Exklusion, von Boykotten und Enteignungen bis hin zur Deportation und schließlich zur systematischen Vernichtung. Die detaillierte Analyse der beiden Zeitabschnitte verdeutlicht die Eskalation der Gewalt und die zunehmende Radikalisierung der NS-Politik.
4. Die volksgemeinschaftliche Grenze der systematischen Vernichtung: Dieses Kapitel untersucht, wie weit die Akzeptanz der "Volksgemeinschaft" gegenüber der systematischen Ermordung der Juden reichte und welche Rolle die gesellschaftliche Zustimmung bei der Umsetzung der "Endlösung" spielte. Es wird analysiert, wie Propaganda und die vorherige Ausgrenzung der Juden die Akzeptanz von Gewalt und Mord vorbereiteten und begünstigten. Das Kapitel untersucht auch das Schweigen und die Mittäterschaft der Bevölkerung und untersucht die Mechanismen der Dehumanisierung und Entwertung jüdischen Lebens.
Schlüsselwörter
NS-Volksgemeinschaft, Exklusion, Judenverfolgung, Antisemitismus, Drittes Reich, Propaganda, Rassenschande, Volksfeind, Volksgenosse, Dehumanisierung, Systematische Vernichtung, Soziale Praxis, Mythos.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der NS-Volksgemeinschaft und der Judenverfolgung
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Konstruktion der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft und den Exklusionsprozessen gegen deutsche Juden im Dritten Reich. Die zentrale These besagt, dass die Exklusion der Juden sowohl Mittel zur Herstellung der „Volksgemeinschaft“ war, als auch durch dieses Projekt selbst legitimiert wurde.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Begriffs „Volksgemeinschaft“ in der NS-Ideologie, die Exklusionsmechanismen gegen deutsche Juden von 1933-1939, die Rolle der Bevölkerung bei der öffentlichen Demütigung von Juden, den Zusammenhang zwischen Exklusion und der Legitimation der Verfolgung, sowie die „Volksgemeinschaft“ als Mythos versus soziale Praxis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die Volksgemeinschaft in der NS-Ideologie, Exklusionsprozesse in den Jahren 1933-1939 am Beispiel der Juden, Die volksgemeinschaftliche Grenze der systematischen Vernichtung und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt des Themas und baut aufeinander auf.
Was wird in der Einleitung präsentiert?
Die Einleitung präsentiert eine Fotografie aus dem Jahr 1935, die die öffentliche Demütigung von Juden zeigt. Sie stellt die These auf, dass die Exklusion sowohl Mittel als auch Ergebnis des Projekts „Volksgemeinschaft“ war und die systematische Vernichtung der Juden als Ziel hatte. Sie skizziert den Forschungsstand und den Aufbau der Arbeit.
Worum geht es im Kapitel über die NS-Volksgemeinschaft?
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Begriffs „Volksgemeinschaft“ in der NS-Ideologie, seine ideologischen Grundlagen und seine Bedeutung für die nationalsozialistische Politik. Es untersucht, wie die „Volksgemeinschaft“ als homogenes Kollektiv konstruiert wurde, das „Volksfeinde“ ausschloss, und wie die Ideologie die Akzeptanz von Unterdrückung und Gewalt schürte.
Wie werden die Exklusionsprozesse gegen Juden dargestellt?
Das Kapitel zu den Exklusionsprozessen analysiert die Ausgrenzung und Verfolgung von Juden von 1933 bis 1939, unterteilt in die Phasen 1933-1935 und 1935-1939. Es beleuchtet gesetzliche Maßnahmen, soziale Diskriminierung, öffentliche Demütigungen, Boykotte, Enteignungen, Deportationen und die systematische Vernichtung.
Was ist der Fokus des Kapitels „Die volksgemeinschaftliche Grenze der systematischen Vernichtung“?
Dieses Kapitel untersucht die Akzeptanz der „Volksgemeinschaft“ im Hinblick auf die systematische Ermordung der Juden und die Rolle der gesellschaftlichen Zustimmung bei der „Endlösung“. Es analysiert Propaganda, die Vorbereitung der Akzeptanz von Gewalt und Mord, das Schweigen und die Mittäterschaft der Bevölkerung, sowie Mechanismen der Dehumanisierung.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: NS-Volksgemeinschaft, Exklusion, Judenverfolgung, Antisemitismus, Drittes Reich, Propaganda, Rassenschande, Volksfeind, Volksgenosse, Dehumanisierung, Systematische Vernichtung, Soziale Praxis, Mythos.
- Quote paper
- Paulina Tiepermann (Author), 2019, Die Konstruktion der NS-Volksgemeinschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/493158