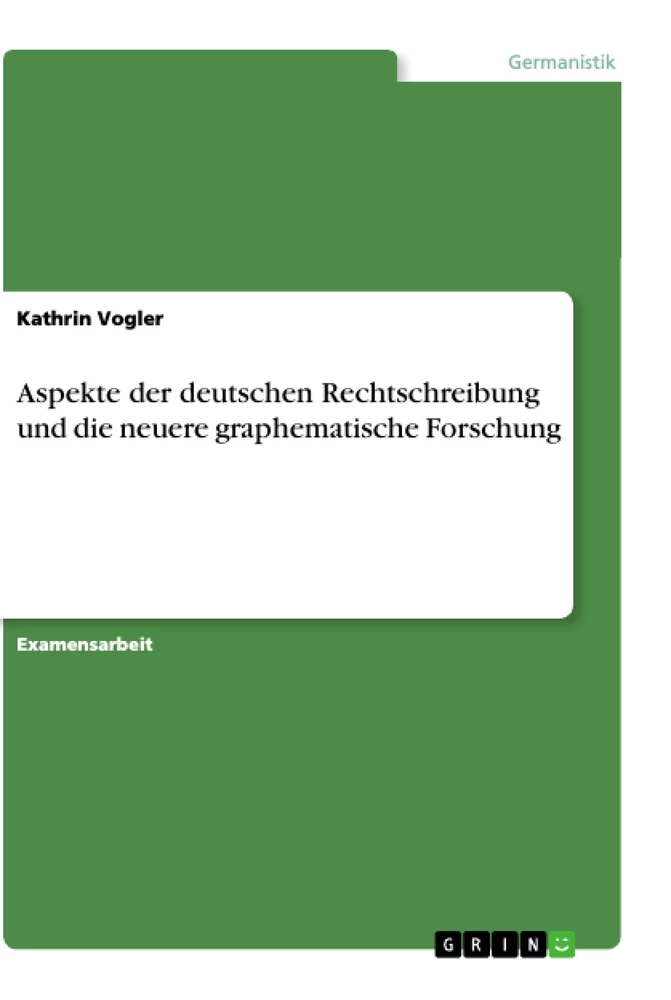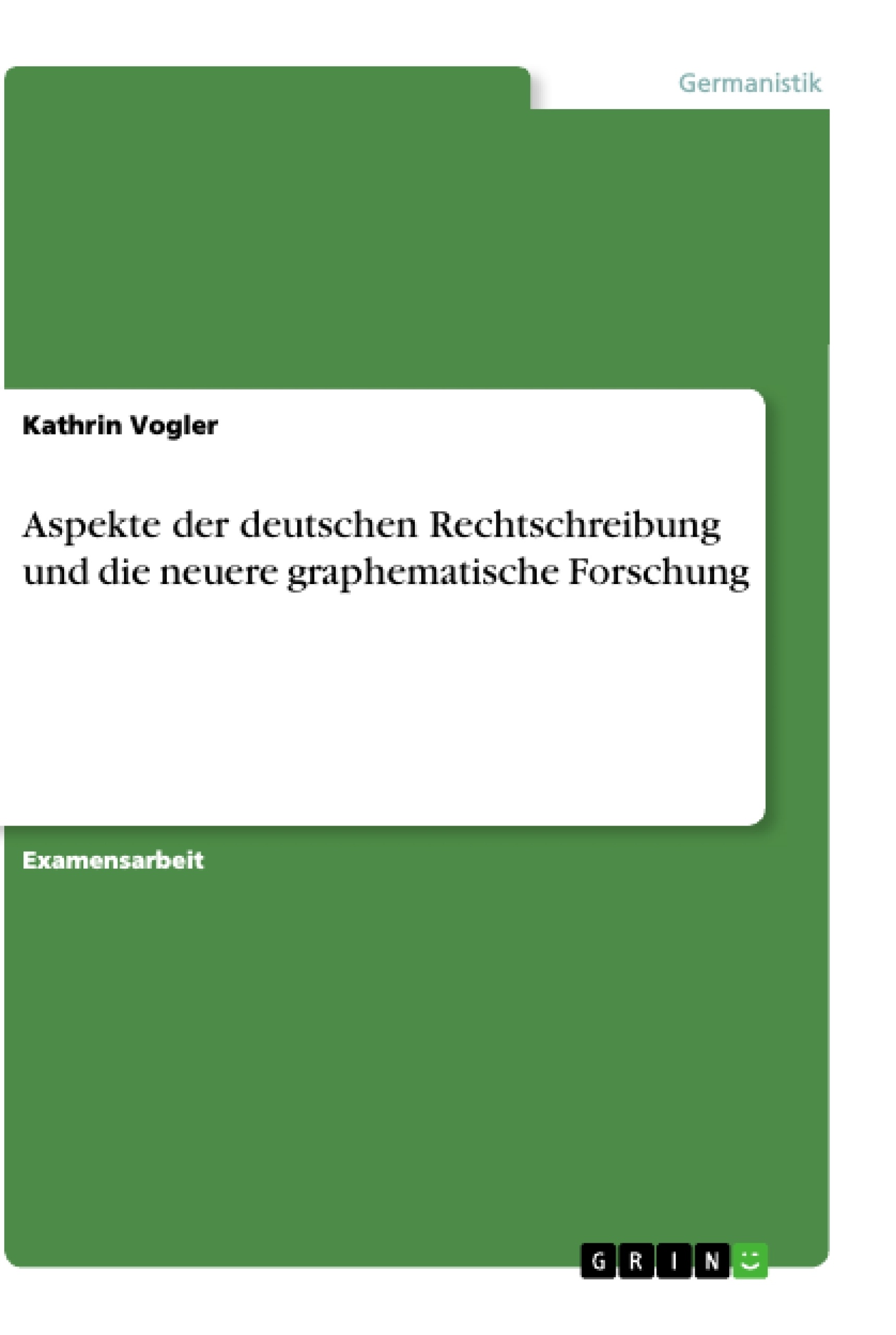Was ist Rechtschreibung überhaupt? Wie entstand die deutsche Orthographie? Wie erlernen Kinder die Grundlagen der (Recht)Schreibung? Diesen Fragen soll im ersten Teil dieser Arbeit nachgegangen werden.
Im zweiten Teil geht es um die Groß- und Kleinschreibung. Dabei möchte ich mich auf die satzinterne Großschreibung beschränken. Es wird deutlich, dass dieser Aspekt seit je her eines der größten Probleme für Lerner darstellt und als Ursache für die meisten Fehler in der Rechtschreibung gilt. Nach einem historischen Abriss zur Entwicklung der Groß- und Kleinschreibung und der Darstellung der Problemlage sollen didaktische Ansätze zur Vermittlung der GKS vorgestellt werden. Anschließend wird dargestellt, wie der Duden die GKS erklärt, bevor ausgewählte Studien vorgestellt werden, die belegen, welchen Platz die GKS bei den Fehlern in der Rechtschreibung einnimmt.
Der dritte Teil behandelt die Getrennt- und Zusammenschreibung, die nach der GKS die zweitgrößte Fehlerquelle darstellt. Zunächst wird die Geschichte der Getrennt- und Zusammenschreibung aufgezeigt. Anschließend wird auf einen der größten Problembereiche innerhalb der GZS aufmerksam gemacht: die Nomen-Verb-Verbindungen. Es sollen Erklärungsansätze und Hilfestellungen zu bekannten Schwierigkeitsbereichen gegeben werden. Zuletzt wird den Fragen nachgegangen, wie Kinder die GZS erlernen und welchen Stellenwert diese in den Bildungsstandards des Landes Baden-Württemberg einnimmt. Dabei soll vergleichend auf die GKS zurückverwiesen werden.
Im vierten Teil soll auf die neuere graphematische Forschung eingegangen werden, die das deutsche (Recht)Schreibsystem aus einem anderen Blickwinkel beobachtet: Graphematischer Wandel, graphematische Silbe und graphematischer Fuß sind Schlagwörter, auf die ich mich berufen möchte.
In einer abschließenden Konklusion werden die Ergebnisse dieser Arbeit schließlich noch einmal zusammengefasst.
"Ein Hauptgrund für abgelehnte Bewerbungen sind die mangelnden Rechtschreibkenntnisse der Schulabgänger" (Praxis Deutsch Heft 170). Diese oder ähnliche Aussagen hört man immer öfter. Und tatsächlich: "Fehlerhaftes Schreiben trotz gebräuchlichen Wortschatzes zeigt sich bei […] fünfundzwanzig Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung, dies betrifft vor allem die Rechtschreibung" (Grotlüschen / Riekmann 2011:6). Wie unzulänglich die Rechtschreibung vieler Deutscher tatsächlich ist, wird einem bewusst, wenn man sich vertieft mit diesem Thema auseinandersetzt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Aspekte der deutschen Rechtschreibung und die neuere graphematische Forschung
- 1. Allgemeines zur Orthographie
- 1.1 Grundlagen der deutschen Orthographie
- 1.2 Orthographieerwerb
- 2. Die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen
- 2.1 Geschichte der Groß- und Kleinschreibung
- 2.2 Problemlage
- 2.3 Didaktik der Groß- und Kleinschreibung
- 2.4 Die Groß- und Kleinschreibung im Duden
- 2.5 Forschungslage
- 3. Die Getrennt- und Zusammenschreibung im Deutschen
- 3.1 Geschichte der Getrennt- und Zusammenschreibung
- 3.2 Problemlage bei Nomen-Verb-Verbindungen
- 3.3 Didaktische Überlegungen
- 4. Die neuere graphematische Forschung
- 4.1 Graphematischer Wandel
- 4.2 Graphematische Silbe
- 4.3 Graphematischer Fuß
- 1. Allgemeines zur Orthographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht ausgewählte Aspekte des deutschen Rechtschreibsystems, konzentriert sich auf die Groß- und Kleinschreibung (GKS) sowie die Getrennt- und Zusammenschreibung (GZS), und gibt einen Einblick in die neuere graphematische Forschung. Ziel ist es, die Herausforderungen beim Erlernen und Lehren dieser orthographischen Phänomene zu beleuchten und potenzielle Verbesserungen für den Unterricht aufzuzeigen.
- Historische Entwicklung der GKS und GZS
- Problematik lexikalischer vs. syntaktischer Ansätze im Rechtschreibunterricht
- Analyse der GKS und GZS im Duden und Schulbüchern
- Empirische Befunde zur Fehlerhäufigkeit und -ursachen
- Einführung in die neuere graphematische Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik mangelnder Rechtschreibkenntnisse bei Schulabgängern dar und führt die zentralen Forschungsfragen ein: Was ist Rechtschreibung, wie entstand die deutsche Orthographie und wie erlernen Kinder die Rechtschreibung? Die Arbeit gliedert sich in vier Teile, die sich mit der Orthographie im Allgemeinen, der Groß- und Kleinschreibung, der Getrennt- und Zusammenschreibung und der neueren graphematischen Forschung befassen.
II. Aspekte der deutschen Rechtschreibung und die neuere graphematische Forschung: Dieser Teil beginnt mit einer allgemeinen Einführung in den Begriff der Orthographie und deren historische Entwicklung. Es werden die Grundlagen des deutschen Schriftsystems erläutert, inklusive der Phonem-Graphem-Korrespondenz und deren Schwierigkeiten. Anschließend werden Theorien zum Orthographieerwerb vorgestellt, die verschiedene Entwicklungsphasen und Strategien der Lernenden beschreiben. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des deutschen Schriftsystems und des Lernprozesses beim Erwerb der Rechtschreibung.
2. Die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die satzinterne Großschreibung. Es wird die historische Entwicklung der Groß- und Kleinschreibung nachgezeichnet, wobei die Rolle des Buchdrucks und die Bemühungen der Grammatiker, Regeln zu formulieren, hervorgehoben werden. Die Problematik der hohen Fehlerquote bei der Groß- und Kleinschreibung wird dargestellt, wobei die unzureichende Vermittlung in der Schule kritisiert wird. Es werden lexikalische und syntaktische Ansätze im Rechtschreibunterricht verglichen, die Darstellung der Groß- und Kleinschreibung im Duden analysiert und relevante empirische Studien vorgestellt.
3. Die Getrennt- und Zusammenschreibung im Deutschen: Dieser Teil beleuchtet die Getrennt- und Zusammenschreibung, insbesondere bei Nomen-Verb-Verbindungen. Die historische Entwicklung wird dargestellt, beginnend mit der scriptio continua bis zur modernen scriptio discontinua. Die Problematik der Unterscheidung zwischen Wortgruppe und Zusammensetzung wird erörtert, verschiedene Wortbildungsprozesse wie Komposita, Inkorporation, Noun-Stripping, Univerbierung und Rückbildungen werden erläutert. Der Mangel an expliziter didaktischer Berücksichtigung der Getrennt- und Zusammenschreibung im Unterricht wird kritisiert, und es werden Vorschläge für eine verbesserte didaktische Herangehensweise unterbreitet.
4. Die neuere graphematische Forschung: Der letzte Teil der Arbeit gibt einen Überblick über die neuere graphematische Forschung. Es werden Konzepte wie graphematischer Wandel, graphematische Silbe und graphematischer Fuß vorgestellt und deren Bedeutung für das Verständnis des deutschen Schriftsystems erläutert. Dieser Teil dient als Ausblick auf ein innovatives Forschungsfeld mit dem Potential, neue Wege im Rechtschreibunterricht aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Deutsche Orthographie, Rechtschreibunterricht, Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Nomen-Verb-Verbindungen, Graphem-Phonem-Korrespondenz, Schriftspracherwerb, Graphematische Forschung, Didaktik, Fehleranalyse, Empirische Studien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Aspekte der deutschen Rechtschreibung und die neuere graphematische Forschung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über ausgewählte Aspekte der deutschen Rechtschreibung. Es konzentriert sich auf die Groß- und Kleinschreibung, die Getrennt- und Zusammenschreibung und gibt Einblicke in die neuere graphematische Forschung. Es werden historische Entwicklungen, didaktische Herausforderungen und empirische Befunde präsentiert, um Verbesserungen im Rechtschreibunterricht aufzuzeigen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die historische Entwicklung der deutschen Orthographie, die Problematik der Groß- und Kleinschreibung (GKS) und der Getrennt- und Zusammenschreibung (GZS), insbesondere bei Nomen-Verb-Verbindungen. Weiterhin wird die neuere graphematische Forschung mit Konzepten wie graphematischer Silbe und graphematischem Fuß vorgestellt. Der Erwerb der Rechtschreibung und didaktische Ansätze im Unterricht spielen eine wichtige Rolle.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in eine Einleitung und vier Hauptkapitel. Kapitel II behandelt allgemeine Aspekte der deutschen Rechtschreibung und den Orthographieerwerb. Kapitel II konzentriert sich auf die Groß- und Kleinschreibung, inklusive historischer Entwicklung, Problemlage und didaktischen Aspekten. Kapitel III befasst sich mit der Getrennt- und Zusammenschreibung, ebenfalls mit historischem Hintergrund und didaktischen Überlegungen. Kapitel IV gibt einen Überblick über die neuere graphematische Forschung.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die Herausforderungen beim Erlernen und Lehren der deutschen Rechtschreibung, insbesondere der GKS und GZS, zu beleuchten. Es soll einen Beitrag zum Verständnis der Problematik leisten und potenzielle Verbesserungen für den Rechtschreibunterricht aufzeigen. Die Einbeziehung der neueren graphematischen Forschung soll neue Perspektiven eröffnen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Zentrale Forschungsfragen sind: Was ist Rechtschreibung? Wie entstand die deutsche Orthographie? Wie erlernen Kinder die Rechtschreibung? Weitere implizite Fragen betreffen die Effektivität verschiedener didaktischer Ansätze im Rechtschreibunterricht, die Ursachen für häufige Rechtschreibfehler und das Potential neuerer graphematischer Forschung für den Unterricht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Orthographie, Rechtschreibunterricht, Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Nomen-Verb-Verbindungen, Graphem-Phonem-Korrespondenz, Schriftspracherwerb, Graphematische Forschung, Didaktik, Fehleranalyse, Empirische Studien.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Das Dokument ist relevant für Lehramtsstudierende, Lehrer*innen der deutschen Sprache, Sprachwissenschaftler*innen und alle, die sich für die deutsche Orthographie, den Rechtschreibunterricht und die graphematische Forschung interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen zu den behandelten Themen?
Das Dokument selbst verweist auf relevante Literatur und empirische Studien. Zusätzliche Informationen können über Fachliteratur zur deutschen Orthographie, Didaktik des Deutschunterrichts und graphematischer Forschung gefunden werden. Eine Suche in wissenschaftlichen Datenbanken nach den Schlüsselwörtern liefert weitere relevante Treffer.
- Citar trabajo
- Kathrin Vogler (Autor), 2017, Aspekte der deutschen Rechtschreibung und die neuere graphematische Forschung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492889