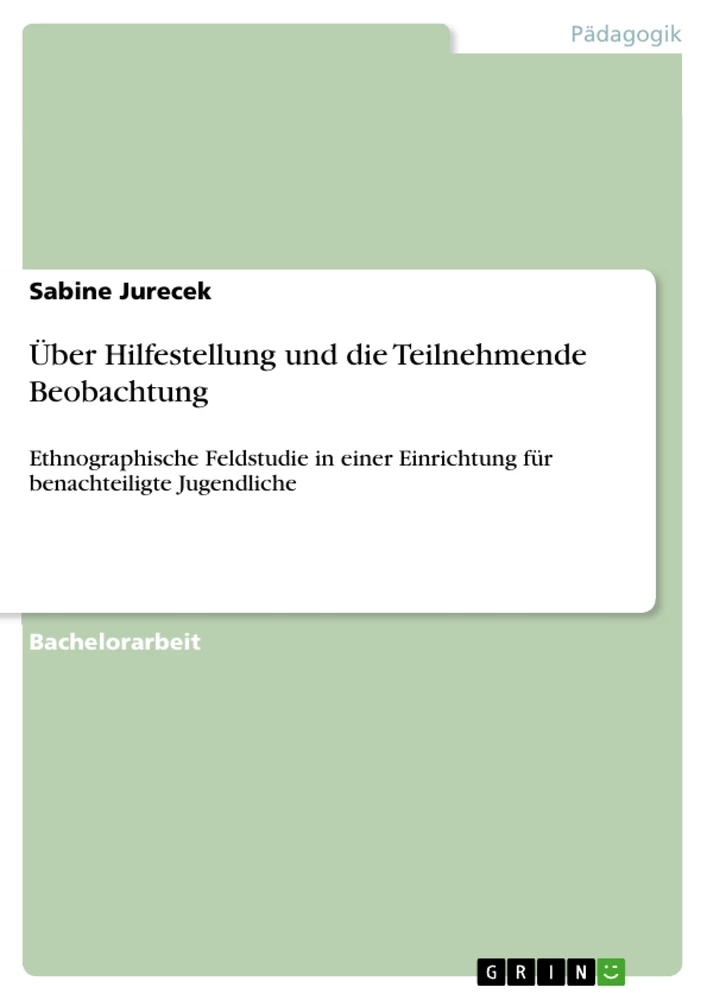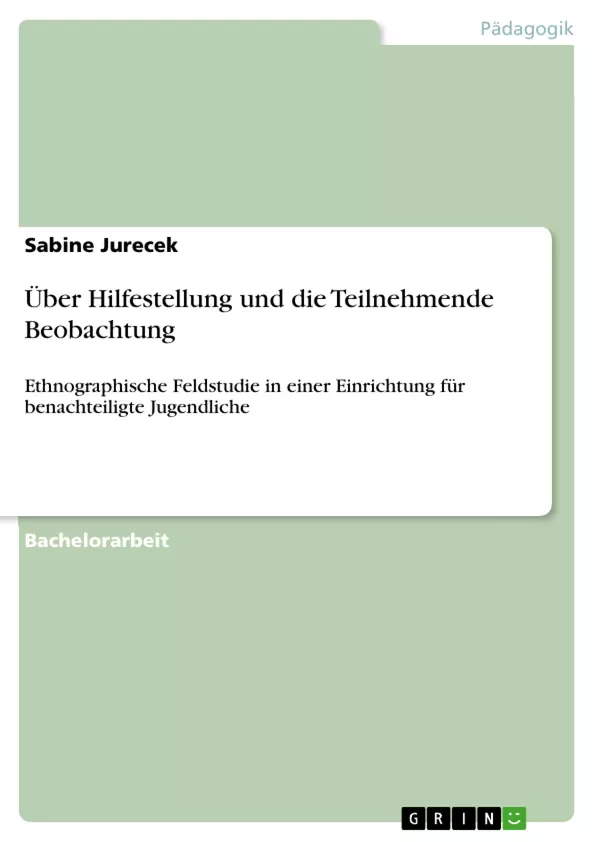Diese Arbeit ist eine ethnographische Feldstudie. Der Schwerpunkt liegt auf dem Phänomen der Hilfestellung und ihrer Rolle während der Teilnehmenden Beobachtung. Die Arbeit stützt sich in methodischer Hinsicht auf die Ethnographische Feldforschung. Im Speziellen wird die Methode der Teilnehmenden Beobachtung zur Datenerhebung herangezogen.
Das Phänomen der Hilfestellung wird im vorliegenden pädagogischen Kontext in den verschiedenen Äußerungsformen untersucht. Wer übt diese aus und wer ist der Adressat? Welche Wirkmechanismen kommen dabei zu Tage? Wie verhalten sich Hilfestellung und Kooperation und welche Rolle kommt dem Gruppengefüge dabei zu? Diese Fragen waren Teil meiner Überlegungen während der Bearbeitung meiner Protokolle und Interpretationen. Auf Grund der vorgeschriebenen Länge der Arbeit ist es mir allerdings nicht möglich, auf alle Aspekte in detaillierter Form einzugehen. Aus diesem Grund wird im vierten Teil vor allem auf das Phänomen der Hilfestellung und seine Erscheinungsformen eingegangen.
Das Resultat dieser Auseinandersetzung mit den gewonnen Daten soll im Rahmen dieser Arbeit dargestellt werden. Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil wird versucht, den theoretischen Hintergrund darzustellen. Dabei wird auf die ethnographische Forschung als Methode eingegangen. Der zweite Teil widmet sich der Teilnehmenden Beobachtung. Hier wird im Besonderen die Rolle des Forschers und in weiterer Folge der Fokus, auf den sich mein Interesse nach und nach stützte, thematisiert. Die Institution, in der wir unsere Beobachtungen durchführen konnten, ist eine institutionelle Einrichtung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, benachteiligte Jugendliche auf ihrem Weg ins Arbeitsleben zu unterstützen. Im besten Fall soll es den Jugendlichen nach Abschluss des Trainings möglich sein, eine Ausbildungsstelle zu erhalten.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- II) Hauptteil
- 1. Theoretischer Hintergrund
- 1.1 Theoretischer Hintergrund zum spezifischen Feld
- 1.2 Einstieg ins Feld
- 2. Teilnehmende Beobachtung im Forschungsprozess
- 2.1 Die Rolle des Forschers im Feld
- 2.2 Ablauf der Beobachtung
- 2.3 Fokussierung des Interesses
- 2.4 Theoretisierung des Interessensphänomens im Feld
- 3. Datenanalyse
- 3.1 Interpretation des Datenmaterials
- 4. Abstraktion des Datenmaterials
- 4.1 Hilfestellung aus Sicht der Arbeitspädagogen/innen im Gefüge „Team“ oder „Individuen einer Gruppe“
- 4.2 Hilfestellung aus Sicht der Teilnehmer/innen
- 4.3 Bedarf einer Hilfestellung
- 1. Theoretischer Hintergrund
- III) Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht das Phänomen der Hilfestellung in einer Einrichtung für benachteiligte Jugendliche mittels ethnographischer Feldforschung, insbesondere teilnehmender Beobachtung. Ziel ist es, die verschiedenen Ausprägungen der Hilfestellung, die Akteure und deren Interaktionen zu analysieren.
- Hilfestellung als soziales Phänomen im pädagogischen Kontext
- Rollen und Interaktionen zwischen Arbeitspädagogen und Jugendlichen
- Kooperation und Gruppendynamik im Zusammenhang mit Hilfestellung
- Analyse der Wirkmechanismen von Hilfestellung
- Der Bedarf an Hilfestellung aus verschiedenen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
I) Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entstehung und den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf ethnographischer Feldforschung und teilnehmender Beobachtung basiert. Sie führt in das Forschungsfeld – eine Einrichtung zur Unterstützung benachteiligter Jugendlicher – ein und skizziert das zentrale Untersuchungsobjekt: das Phänomen der Hilfestellung. Die Autorin erläutert die Motivation, sich mit Hilfestellung und Kooperation in diesem spezifischen pädagogischen Kontext auseinanderzusetzen.
II) Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in verschiedene Abschnitte. Zuerst wird der theoretische Hintergrund der ethnographischen Forschung erläutert, mit Fokus auf teilnehmende Beobachtung als Methode. Die Autorin beschreibt den Forschungsprozess, ihre Rolle als teilnehmende Beobachterin, den Ablauf der Beobachtungen und die schrittweise Fokussierung auf das Phänomen der Hilfestellung. Anschließend werden die Datenanalyse und -interpretation, sowie die Abstraktion des Datenmaterials dargestellt. Hier werden verschiedene Perspektiven auf Hilfestellung beleuchtet – sowohl die Sicht der Arbeitspädagogen als auch die der Jugendlichen. Der Bedarf an Hilfestellung wird ebenfalls analysiert.
III) Resümee: (Zusammenfassung wird hier ausgelassen um Spoiler zu vermeiden)
Schlüsselwörter
Ethnographie, teilnehmende Beobachtung, Hilfestellung, Kooperation, benachteiligte Jugendliche, pädagogisches Feld, soziale Kompetenz, Datenanalyse, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Hilfestellung bei benachteiligten Jugendlichen
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Phänomen der Hilfestellung in einer Einrichtung für benachteiligte Jugendliche. Sie analysiert verschiedene Ausprägungen der Hilfestellung, die beteiligten Akteure und deren Interaktionen mittels ethnographischer Feldforschung, insbesondere teilnehmender Beobachtung.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf ethnographischer Feldforschung und teilnehmender Beobachtung. Die Autorin beschreibt ihren Forschungsprozess, ihre Rolle als teilnehmende Beobachterin, den Ablauf der Beobachtungen und die schrittweise Fokussierung auf das Phänomen der Hilfestellung. Die Datenanalyse und -interpretation sowie die Abstraktion des Datenmaterials bilden weitere zentrale Methoden.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie der ethnographischen Forschung, insbesondere die teilnehmende Beobachtung. Der theoretische Hintergrund wird im Hauptteil ausführlich erläutert.
Welche Perspektiven werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet das Thema Hilfestellung aus verschiedenen Perspektiven: sowohl aus der Sicht der Arbeitspädagogen als auch aus der Sicht der Jugendlichen. Der Bedarf an Hilfestellung wird ebenfalls aus unterschiedlichen Blickwinkeln analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Hilfestellung als soziales Phänomen im pädagogischen Kontext, den Rollen und Interaktionen zwischen Arbeitspädagogen und Jugendlichen, Kooperation und Gruppendynamik im Zusammenhang mit Hilfestellung, der Analyse der Wirkmechanismen von Hilfestellung und dem Bedarf an Hilfestellung aus verschiedenen Perspektiven.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Resümee. Der Hauptteil umfasst die Darstellung des theoretischen Hintergrunds, den Forschungsprozess, die Datenanalyse und -interpretation sowie die Abstraktion des Datenmaterials. Die Einleitung beschreibt den methodischen Ansatz und das Forschungsfeld. Das Resümee fasst die Ergebnisse zusammen (Detaillierte Zusammenfassung im Dokument).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ethnographie, teilnehmende Beobachtung, Hilfestellung, Kooperation, benachteiligte Jugendliche, pädagogisches Feld, soziale Kompetenz, Datenanalyse, qualitative Forschung.
Wo finde ich eine detailliertere Zusammenfassung der Kapitel?
Eine detailliertere Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Einleitung, Hauptteil, Resümee) findet sich im bereitgestellten Dokument.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, insbesondere für Personen, die sich für ethnographische Forschung, qualitative Forschung, Pädagogik und die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen interessieren.
- Citation du texte
- Sabine Jurecek (Auteur), 2012, Über Hilfestellung und die Teilnehmende Beobachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491478