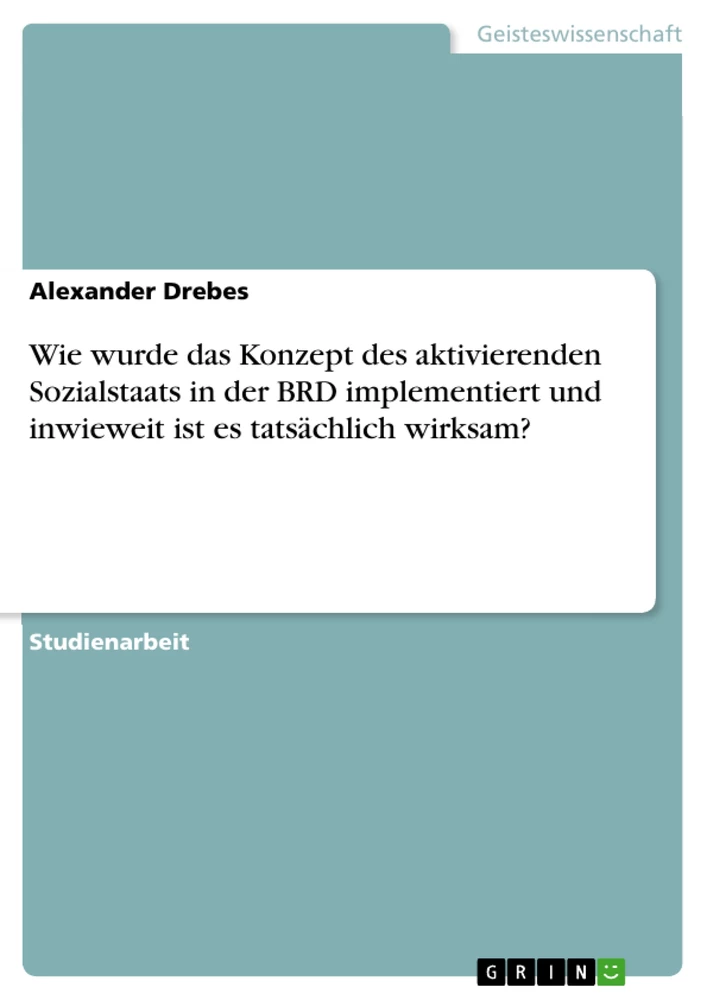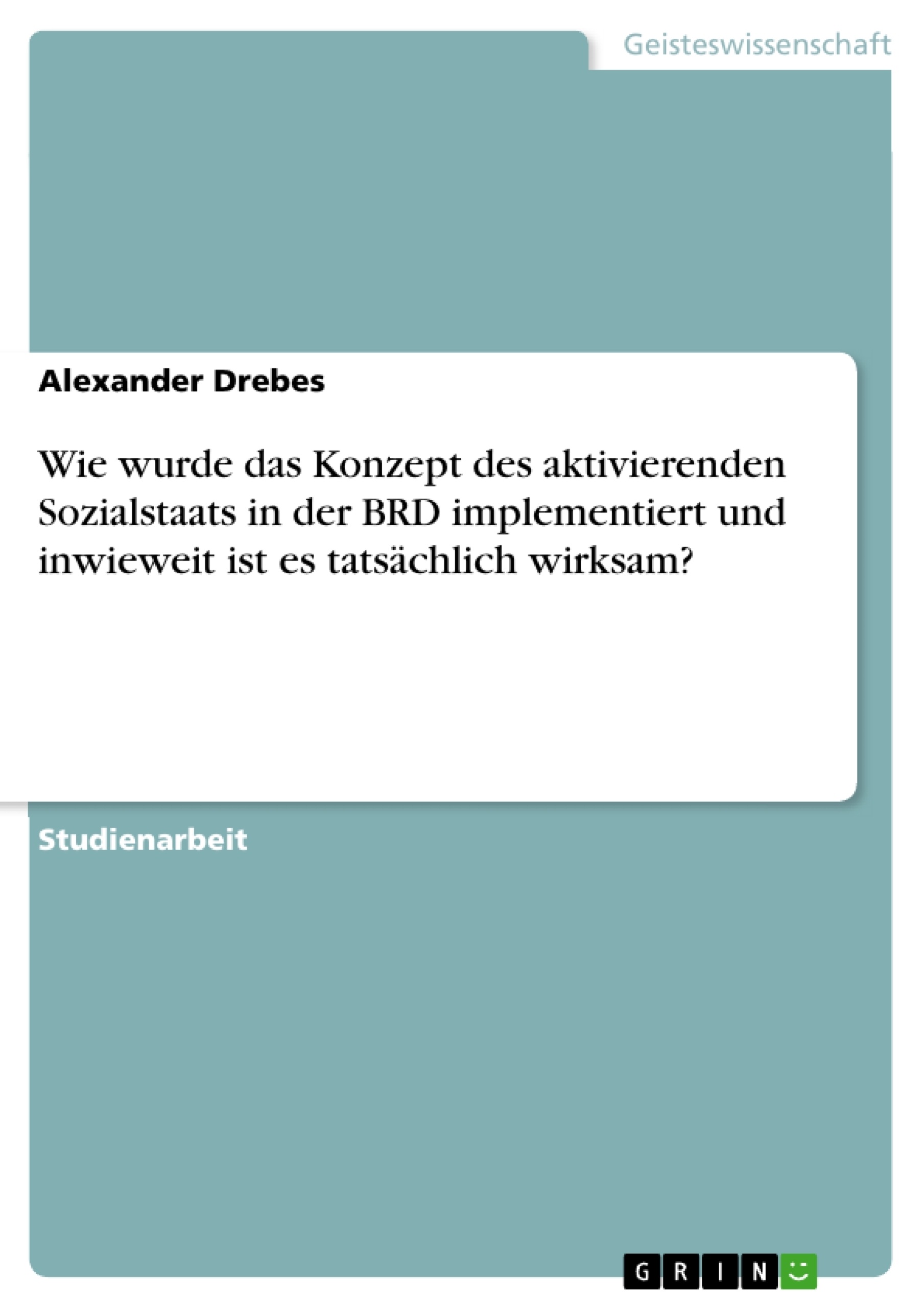Diese Hausarbeit widmet sich der Implementierung(-sgeschichte) des Aktivierungsgedanken in die deutsche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Die Aktivierung des Sozialstaats in Deutschland begann bereits in den 1990er Jahren. Aber als Leitbild wurde die Aktivierung erst in der zweiten Legislaturperiode der rot-grünen Regierung (2002 - 2005) unter Kanzler Schröder durchgesetzt. Dabei zu beachten gilt, dass diese Hausarbeit keine genaue Analyse über die Folgen der Agenda-Politik erstellt, sondern die Gründe für diese erörtert und die Pfadabhängigkeit (etwa der damalige Arbeitsmarktpolitische Diskurs, die sozialpolitischen Prinzipien des Grundgesetzes, der damalige Reformstau und die Beschäftigungskrise, etc.) aufzeigt.
Die Hausarbeit beginnt im ersten Kapitel mit den grundlegenden Prinzipien und Zielen des deutschen Sozialstaats (1.1. Implikationen im Grundgesetz, 1.2. Ziele und Aufgaben des Sozialgesetzbuches I, 1.3. Allgemeine Sozialstaatsziele).
Im zweiten Kapitel wird der arbeitsmarktpolitische Diskurs beschrieben (2.1 Allgemeine Arbeitsmarktpolitik, 2.2 Nachfrageorientierte Arbeitsmarktpolitik, 2.3 Angebotsorientierte Arbeitsmarktpolitik, 2.4 Der "dritte Weg": Die aktivierende Arbeitsmarktpolitik) dabei liefert dieses Kapitel einen Kontext zum arbeitsmarktpolitischen Diskurs, der dem Leser die Pfadabhängigkeit in der Arbeitsmarktpolitik vor Augen führen soll.
Im dritten und längsten Kapitel geht es dann konkret um die Beschäftigungskrise der 1990er bis Mitte der 2000er Jahre, welche die rot-grüne Koalition dazu bewegte, Lösungen für die Massenarbeitslosigkeit zu finden (3.1). Einher geht damit die Neuausrichtung der sozialdemokratischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (3.2) und die Umsetzung der Agenda 2010 (3.3). - Hier werden in den Unterpunkten die einzelnen Hartz-Gesetze (Hartz I-II 3.3.1, Hartz III 3.3.2 und Hartz IV) ausformuliert, indem ihre wichtigsten Implementierungen und Ziele beschrieben werden. Am Ende des Kapitels findet eine Evaluation der Agenda-Politik (3.4) auf die beiden Politikbereiche Arbeitsmarkt- (3.4.1) und Sozialpolitik (3.4.2) statt. Hinzu kommt ein Unterpunkt zu einigen Nachbesserungen der Agenda-Reformen durch die Große Koalition zw. 2005 und 2009 (3.4.3).
Schlussendlich das Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundprinzipien und Ziele des Sozialstaats
- 1.1 Implikationen im Grundgesetz
- 1.2 Ziele und Aufgaben des Sozialgesetzbuches I
- 1.3 Allgemeine Sozialstaatsziele
- 2. Arbeitsmarktpolitischer Diskurs
- 2.1 Allgemeine Arbeitsmarktpolitik
- 2.2 Nachfrageorientierte Arbeitsmarktpolitik
- 2.3 Angebotsorientierte Arbeitsmarktpolitik
- 2.4 Der „dritte Weg“: Die aktivierende Arbeitsmarktpolitik
- 3. Beschäftigungskrise und Aktivierung der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
- 3.1 Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt zwischen 1990 und 2005
- 3.2 Neuausrichtung der sozialdemokratischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
- 3.3 Die Agenda 2010
- 3.3.1 Hartz-I und Hartz-II
- 3.3.2 Hartz III
- 3.3.3 Hartz IV
- 3.4 Evaluation der Agenda-Politik
- 3.4.1 Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
- 3.4.2 Die Auswirkungen auf die Sozialordnung
- 3.4.3 Frühzeitige Nachbesserung oder Abschaffung unwirksamer Instrumente
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Implementierung des aktivierenden Sozialstaats in der Bundesrepublik Deutschland und evaluiert dessen Wirksamkeit. Dabei werden die Grundprinzipien und Ziele des Sozialstaats sowie die verschiedenen Ansätze der Arbeitsmarktpolitik beleuchtet.
- Die Entwicklungen des deutschen Arbeitsmarktes seit der Wiedervereinigung
- Die Agenda 2010 als Instrument der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik
- Die Auswirkungen der Agenda 2010 auf den Arbeitsmarkt und die Sozialordnung
- Die Kritik an der Agenda 2010 und die Debatte um die Wirksamkeit des aktivierenden Sozialstaats
- Die Rolle des Grundgesetzes und der Sozialgesetzbücher im Kontext des aktivierenden Sozialstaats
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der steigenden Arbeitslosigkeit in Deutschland nach der Wiedervereinigung dar und führt den Begriff des aktivierenden Sozialstaats ein.
Kapitel 1 analysiert die Grundprinzipien und Ziele des deutschen Sozialstaats, indem es relevante Artikel des Grundgesetzes und die Aufgaben des Sozialgesetzbuches I beleuchtet.
Kapitel 2 skizziert den Arbeitsmarktpolitischen Diskurs, wobei die verschiedenen Ansätze zur Gestaltung von Arbeitsmarktpolitik, wie z. B. die Nachfrage- und Angebotsorientierte Arbeitsmarktpolitik sowie der „dritte Weg“ der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, vorgestellt werden.
Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zwischen 1990 und 2005 und geht auf die Neuausrichtung der sozialdemokratischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ein. Die Agenda 2010, insbesondere ihre Hartz-Reformen, sowie ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Sozialordnung werden im Detail untersucht.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem aktivierenden Sozialstaat, der Agenda 2010, der Hartz-Reform, Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Grundgesetz, Sozialgesetzbuch I, Arbeitslosigkeit, Sozialstaatsprinzip, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zum aktivierenden Sozialstaat
Wann begann die Aktivierung des Sozialstaats in Deutschland?
Die ersten Ansätze begannen bereits in den 1990er Jahren, doch als Leitbild wurde die Aktivierung erst unter Kanzler Schröder (2002-2005) mit der Agenda 2010 durchgesetzt.
Was sind die zentralen Bestandteile der Agenda 2010?
Die wichtigsten Instrumente waren die Hartz-Gesetze (Hartz I bis IV), die den Arbeitsmarkt flexibilisieren und Langzeitarbeitslose schneller in Arbeit bringen sollten.
Welche Rolle spielt das Grundgesetz im Sozialstaat?
Das Grundgesetz legt die grundlegenden Prinzipien und Ziele des Sozialstaats fest, an denen sich jede Reform, auch die Aktivierungspolitik, messen lassen muss.
Wie wird die Wirksamkeit der Hartz-Reformen bewertet?
Die Arbeit evaluiert die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Sozialordnung, wobei auch Kritikpunkte und notwendige Nachbesserungen der Großen Koalition thematisiert werden.
Was bedeutet „Pfadabhängigkeit“ in diesem Kontext?
Damit sind die historischen und strukturellen Rahmenbedingungen gemeint (z.B. Reformstau, Beschäftigungskrise), die den Weg hin zur aktivierenden Politik beeinflusst haben.
- Citar trabajo
- Alexander Drebes (Autor), 2019, Wie wurde das Konzept des aktivierenden Sozialstaats in der BRD implementiert und inwieweit ist es tatsächlich wirksam?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490946