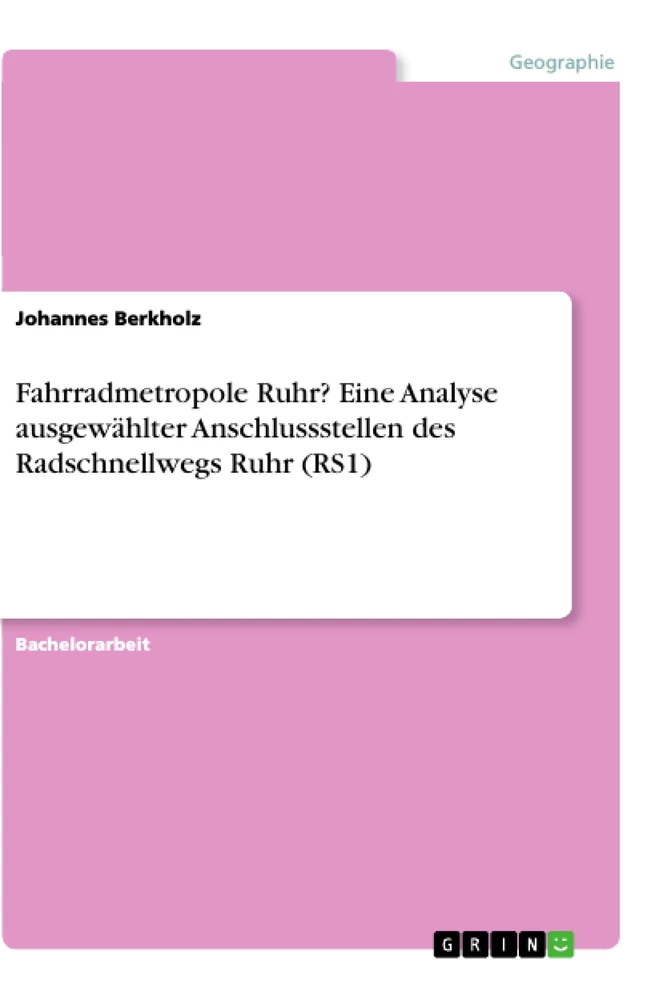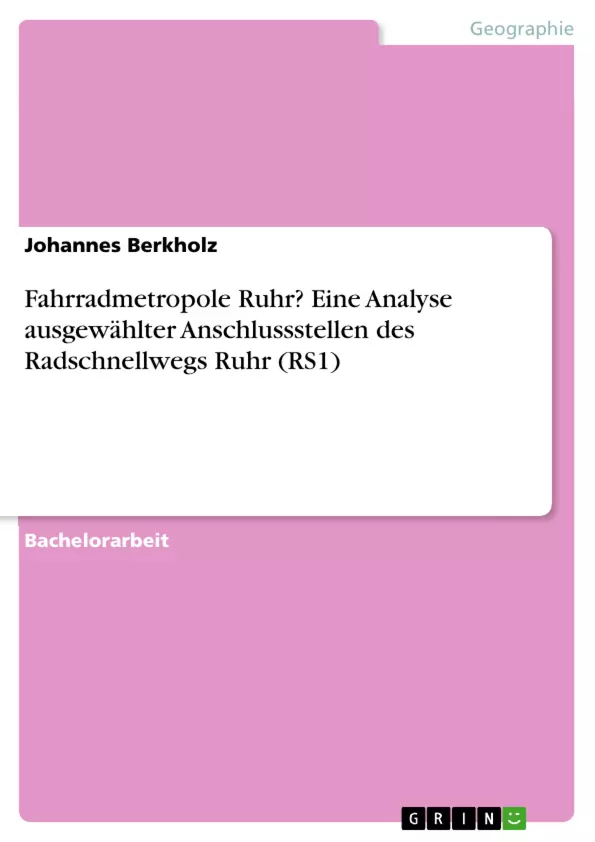Diese Arbeit befasst sich im Rahmen des Strategiewechsels von der Autostadt zum multimodalen Verkehrssystem mit dem Großprojekt Radschnellweg Ruhr.
Bei der Wahl des Verkehrsmittels gewinnt das Fahrrad zunehmend an Bedeutung. Besonders im täglichen Verkehr nutzen Pendler für den längsten Weg zwischen ihrem Wohnort und ihrer Arbeits- oder Ausbildungsstätte zunehmend das Fahrrad als Verkehrsmittel, sofern sich die zurückzulegende Distanz hiermit realisieren lässt. In den letzten Jahren ist zudem eine starke Zunahme der Verkaufszahlen von Pedelecs (Pedal Electric Cycle) zu vermerken.
Die deutschen Städte sind durch die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg und in den 1960er Jahren mit den gleichzeitig steigenden Zahlen der Kraftfahrzeuge auf den Straßen autogerecht umgestaltet worden. Dieser Ausbau der Infrastruktur ist aus der heutigen Perspektive des Radfahrers problematischer. Hierbei ist besonders die Sicherheit der Radfahrer auf den von Autos dominierten Straßen hervorzuheben.
Als hauptsächliche Grundlage für diese Arbeit soll die Machbarkeitsstudie des RVR, in der die wesentlichen Ziele und zu erreichenden Zahlen bereits erarbeitet wurden, dienen. Für die spätere Analyse der untersuchten Verkehrswege sollen die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) als Grundlage der Einordnung und Bewertung helfen. Vorliegende Zähldaten der Zählsäule in der südlichen Innenstadt in Mülheim an der Ruhr werden hinzugezogen, um die Nutzung des RS 1 zu untersuchen und um Rückschlüsse ziehen zu können, inwiefern das Projekt von Radfahrern genutzt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangslage
- 1.2 Einordnung in die Forschung und Relevanz
- 1.3 Forschungsfragen, Methode und Aufbau
- 2 Radinfrastruktur und Maßnahmen
- 2.1 Klassifizierung von Führungsformen des Radverkehrs
- 2.1.1 Radfahrstreifen
- 2.1.2 Schutzstreifen
- 2.1.3 Baulich angelegte Radwege neben der Fahrbahn
- 2.1.4 Gemeinsame Geh- und Radwege
- 2.1.5 Fahrradstraßen
- 2.2 Integration in die MIV-Infrastruktur
- 2.3 Konflikte
- 2.4 Beispiele anderer Städte als Vorreiter
- 3 Radschnellwege
- 3.1 Qualitätskriterien für Radschnellwege
- 3.2 Voraussetzungen für die Annahme von RSW
- 3.3 Konzept des Radschnellwegs Ruhr
- 3.3.1 Finanzierung
- 3.3.2 Streckenverlauf
- 3.3.3 Zielsetzungen
- 4 Untersuchung ausgewählter Anschlussstellen
- 4.1 Methode
- 4.2 Anschlussstellen des Radschnellwegs Ruhr
- 4.2.1 Kleine Buschstraße (Essen)
- 4.2.2 Segerothstraße (Essen)
- 4.2.3 Situation der zukünftigen Anschlussstelle Bessemerstraße (Bochum)
- 4.3 Anschlussstelle Roomweg (Enschede)
- 4.4 Vergleich der untersuchten Anschlussstellen
- 5 Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert ausgewählte Anschlussstellen des Radschnellwegs Ruhr (RS1) und untersucht deren Integration in die bestehende Rad- und Verkehrslandschaft. Ziel ist es, die Qualität der Anschlussstellen zu bewerten und Möglichkeiten zur Verbesserung aufzuzeigen.
- Analyse der Radinfrastruktur an den ausgewählten Anschlussstellen
- Bewertung der Integration des RS1 in die bestehende Verkehrsstruktur
- Identifizierung von Konflikten und Verbesserungspotentialen
- Vergleich der Anschlussstellen untereinander und mit Beispielen aus anderen Städten
- Beitrag zur Diskussion über die Entwicklung von Fahrradinfrastruktur in Ballungsräumen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt die Ausgangslage und die Relevanz der Forschungsarbeit. Sie definiert die Forschungsfragen und beschreibt die Methodik und den Aufbau der Arbeit.
2 Radinfrastruktur und Maßnahmen: Dieses Kapitel klassifiziert verschiedene Führungsformen des Radverkehrs, von Radfahrstreifen bis zu Fahrradstraßen, und untersucht deren Integration in die bestehende motorisierte Infrastruktur. Es analysiert auftretende Konflikte und präsentiert Beispiele aus anderen Städten als Best-Practice-Beispiele.
3 Radschnellwege: Dieses Kapitel beleuchtet die Qualitätskriterien und Voraussetzungen für erfolgreiche Radschnellwege. Es konzentriert sich auf das Konzept des Radschnellwegs Ruhr (RS1), inklusive Finanzierung, Streckenverlauf und Zielsetzungen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Konzepts und der Hintergründe seiner Entstehung.
4 Untersuchung ausgewählter Anschlussstellen: In diesem zentralen Kapitel werden verschiedene Anschlussstellen des RS1 (Kleine Buschstraße und Segerothstraße in Essen, zukünftige Bessemerstraße in Bochum und Roomweg in Enschede) methodisch untersucht und detailliert beschrieben. Der Vergleich der Ergebnisse soll Aufschluss über Stärken und Schwächen der jeweiligen Integration in die Umgebung geben.
Schlüsselwörter
Radschnellweg Ruhr (RS1), Radinfrastruktur, Anschlussstellen, Radverkehr, Stadtplanung, Verkehrsmanagement, Konflikte, Integration, Vergleich, Fahrradmetropole.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse ausgewählter Anschlussstellen des Radschnellwegs Ruhr
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert ausgewählte Anschlussstellen des Radschnellwegs Ruhr (RS1) und untersucht deren Integration in die bestehende Rad- und Verkehrslandschaft. Das Ziel ist die Bewertung der Anschlussstellenqualität und die Aufzeigung von Verbesserungsmöglichkeiten.
Welche Anschlussstellen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Anschlussstellen Kleine Buschstraße und Segerothstraße in Essen, die zukünftige Anschlussstelle Bessemerstraße in Bochum und die Anschlussstelle Roomweg in Enschede.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Aspekte der Radinfrastruktur, einschließlich der Klassifizierung von Führungsformen des Radverkehrs (Radfahrstreifen, Schutzstreifen, Radwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Fahrradstraßen), der Integration in die motorisierte Infrastruktur (MIV), auftretender Konflikte und Beispiele aus anderen Städten. Ein Schwerpunkt liegt auf den Qualitätskriterien und Voraussetzungen für erfolgreiche Radschnellwege, insbesondere am Beispiel des RS1 (Finanzierung, Streckenverlauf, Zielsetzungen). Die methodische Untersuchung der ausgewählten Anschlussstellen bildet den Kern der Arbeit, inklusive eines Vergleichs der Ergebnisse.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit beschreibt die angewandte Methodik im Kapitel 4.1. Es werden detaillierte Beschreibungen der untersuchten Anschlussstellen gegeben, die dann verglichen werden, um Stärken und Schwächen der jeweiligen Integration in die Umgebung aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen und ein Ausblick werden im Kapitel 5 präsentiert. Die genauen Ergebnisse sind nicht in diesem Preview enthalten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Radschnellweg Ruhr (RS1), Radinfrastruktur, Anschlussstellen, Radverkehr, Stadtplanung, Verkehrsmanagement, Konflikte, Integration, Vergleich, Fahrradmetropole.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Radinfrastruktur und Maßnahmen, zu Radschnellwegen, zur Untersuchung ausgewählter Anschlussstellen und abschließende Schlussfolgerungen und einen Ausblick. Ein Inhaltsverzeichnis mit detaillierter Gliederung ist im Preview enthalten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Qualität der Anschlussstellen des RS1 zu bewerten, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und einen Beitrag zur Diskussion über die Entwicklung von Fahrradinfrastruktur in Ballungsräumen zu leisten. Die Analyse der Radinfrastruktur an den Anschlussstellen, die Bewertung der RS1-Integration in die Verkehrsstruktur, die Identifizierung von Konflikten und Verbesserungspotentialen sowie ein Vergleich mit anderen Städten sind zentrale Ziele.
- Citation du texte
- Johannes Berkholz (Auteur), 2018, Fahrradmetropole Ruhr? Eine Analyse ausgewählter Anschlussstellen des Radschnellwegs Ruhr (RS1), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490107