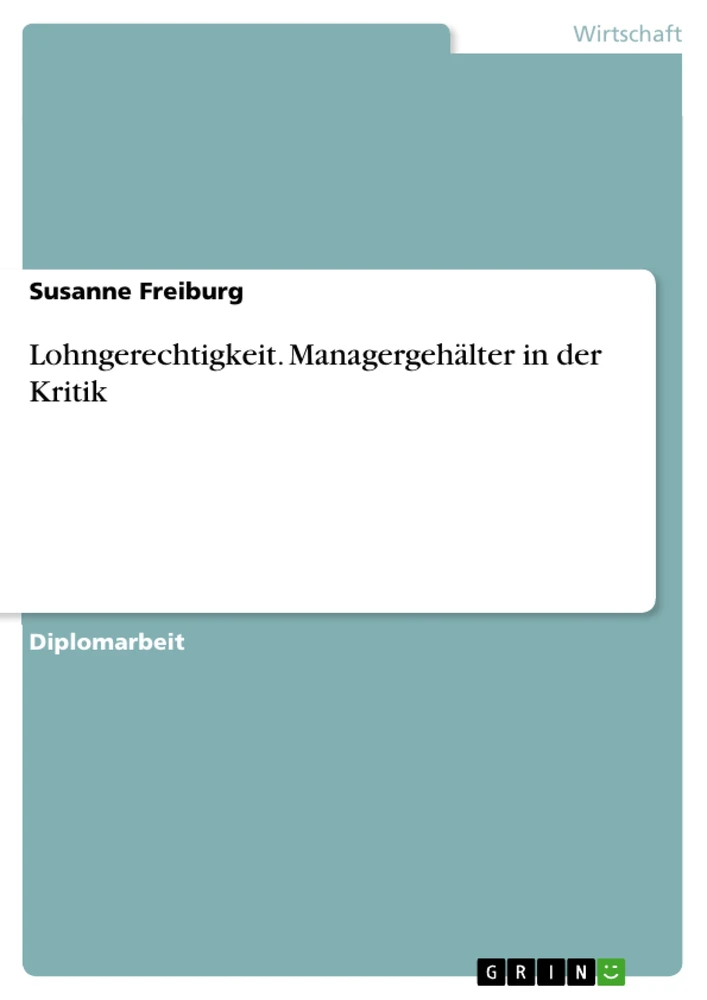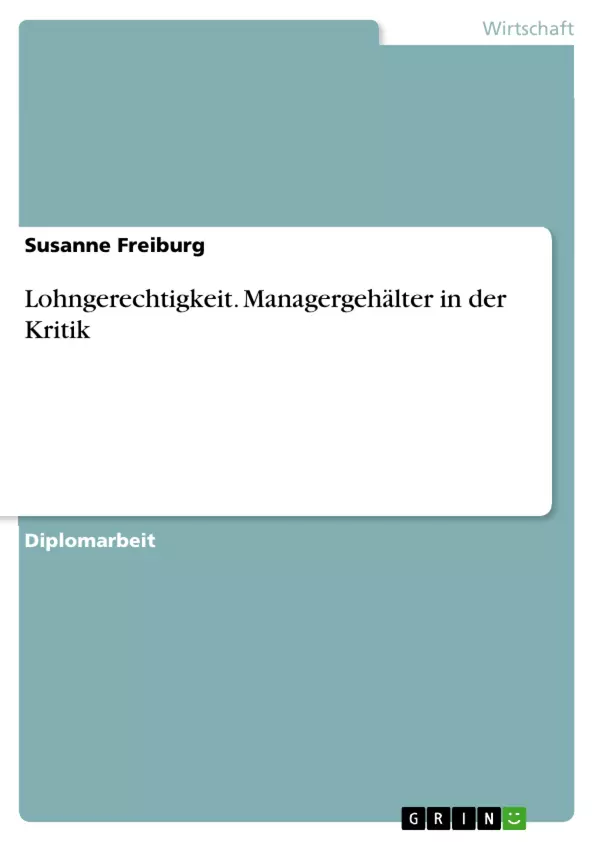„Kein volkswirtschaftlicher Preis hat größeren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der meisten Menschen als der Lohn. [...] Die Frage nach dem richtigen Lohn, dem gerechten Lohn oder dem Lohn, der nach Marktlage möglich ist, bestimmt deshalb den Alltag der Mehrheit unserer Bevölkerung.“
Die Vorbemerkung eines kürzlich veröffentlichten Zeitungsartikels betont die anhaltend hohe Relevanz der Lohngerechtigkeitsthematik. Nachdem die Diskussion um Gerechtigkeit unter ethischen und auch ökonomischen Gesichtspunkten lange Zeit vor dem Hintergrund einer unvereinbaren Meinungsvielfalt stillstand, mehren sich seit einiger Zeit wieder Beiträge in den Medien und unter Fachleuten zu der Thematik.
Die hohe Lohnspreizung in den letzten zehn Jahren, Sozialreformen, Nullrunden und Lohnverzicht, hohe Arbeitslosigkeit und Verlagerungen von Arbeitsplätzen ins Ausland, außerordentlich hohe Zusatzeinkommen von Führungskräften, Intransparenz in den Entlohnungssystemen und ein steigendes Bedürfnis nach sozialem Ausgleich und Gerechtigkeit sind sowohl Ursache als auch Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzungen.
Als Problem der Bestimmung eines „angemessenen Lebensunterhalts“ kam das Thema der Lohngerechtigkeit erstmals im Mittelalter auf. Im Laufe der Industrialisierung wurde die gerechte Verteilung von Mitteln als soziales Problem betrachtet. Heute steht vor allem die Relation der Vergütung im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern im Zentrum des Interesses und führt insofern zu verstärkter Sensibilität in Bezug auf eine angemessene und gerechte Entlohnung.
Insbesondere die Vergütung von Führungskräften befindet sich im Blickfeld scharfer Kritik. Schlechte Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und hohe Konzessionen seitens der Arbeitnehmer auf der einen Seite und rapide steigende Bezüge der Topmanager auf der anderen Seite intensivieren das Ungerechtigkeitsempfinden der Gesellschaft. Moralisch lässt sich diskutieren, ob die Kritik an den Bezügen Folge von sozialem Neid ist. Leugnen lässt sich jedoch nicht, dass die Relationen der Führungskräftegehälter sich im Vergleich zu durchschnittlichen Arbeitnehmerentgelten in den letzten Jahren immens verändert haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Thematik
- 2. Gerechtigkeit als Gegenstand der Ethik und Unternehmensphilosophie
- 2.1. Begriffliche Abgrenzung von Gerechtigkeit
- 2.1.1. Der formale Gerechtigkeitsbegriff
- 2.1.2. Der materiale Gerechtigkeitsbegriff
- 2.1.3. Der prozedurale Gerechtigkeitsbegriff
- 2.2. Gerechtigkeit als Unternehmensphilosophie
- 3. Dimensionen der Lohngerechtigkeit
- 3.1. Zur Definition von Lohngerechtigkeit
- 3.2. Grundsätze der gerechten Entlohnung
- 3.3. Gerechtigkeitsprinzipien
- 3.3.1. Die Kernprinzipien
- 3.3.1.1. Anforderungsgerechtigkeit
- 3.3.1.2. Leistungsgerechtigkeit
- 3.3.1.3. Marktgerechtigkeit
- 3.3.2. Die Randprinzipien
- 3.3.2.1. Bedarfs- und Sozialgerechtigkeit
- 3.3.2.2. Qualifikationsgerechtigkeit
- 3.3.2.3. Erfolgsgerechtigkeit
- 3.3.2.4. Verteilungsgerechtigkeit
- 3.4. Zusammenfassung und Relevanz einzelner Gerechtigkeitsprinzipien
- 4. Die Vergütungsstruktur von Führungskräften - Aufbau und Tendenzen
- 4.1. Aufbau der Führungskräftegehälter
- 4.1.1. Das Grundgehalt
- 4.1.2. Der variable Entgeltanteil
- 4.1.3. Die Zusatzleistungen
- 4.2. Anreizaspekte der Führungskräftegehälter
- 4.3. Tendenzen der Führungskräftegehälter
- 5. Sind überproportional hohe Managergehälter gerechtfertigt?
- 5.1. Rechtfertigungen auf der Basis von Gerechtigkeitsprinzipien
- 5.1.1. Rechtfertigung durch Anforderungsgerechtigkeit
- 5.1.2. Rechtfertigung durch Leistungsgerechtigkeit
- 5.1.3. Rechtfertigung durch Marktgerechtigkeit
- 5.1.4. Rechtfertigung durch Bedarfs- und Sozialgerechtigkeit
- 5.1.5. Rechtfertigung durch Qualifikationsgerechtigkeit
- 5.1.6. Rechtfertigung durch Erfolgsgerechtigkeit
- 5.1.7. Rechtfertigung durch Verteilungsgerechtigkeit
- 5.2. Weitere Ansätze zur Rechtfertigung
- 5.3. Zusammenfassung der Ansätze
- 6. Vergütungsentscheidungen und prozedurale Gerechtigkeit
- 6.1. Institutionelle Faktoren als Maßgabe für Führungskräftegehälter
- 6.2. Folgen ungerechter Entlohnung
- 6.3. Ansätze zu einer gerechteren Verteilung
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
- Gerechtigkeitsprinzipien in der Entlohnung
- Vergütungsstrukturen von Führungskräften
- Rechtfertigung von Managergehältern
- Prozedurale Gerechtigkeit bei Vergütungsentscheidungen
- Folgen ungerechter Entlohnung und Ansätze zur Verbesserung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage der Lohngerechtigkeit, insbesondere im Kontext von Managergehältern. Ziel ist es, die verschiedenen Dimensionen der Lohngerechtigkeit zu beleuchten und deren Relevanz für die Beurteilung von Managervergütungen zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Gerechtigkeitsprinzipien, die für die Rechtfertigung von Managergehältern herangezogen werden können, und untersucht, inwieweit diese Prinzipien in der Praxis Anwendung finden.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Lohngerechtigkeit ein und skizziert die Relevanz des Themas im Kontext von Managergehältern. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der Gerechtigkeit aus ethischer und unternehmerischer Perspektive. Dabei werden verschiedene Gerechtigkeitskonzepte vorgestellt und die Bedeutung von Gerechtigkeit für die Unternehmensphilosophie erläutert. Kapitel 3 widmet sich den verschiedenen Dimensionen der Lohngerechtigkeit. Es werden die wichtigsten Grundsätze und Prinzipien der gerechten Entlohnung dargestellt und deren Relevanz für die Beurteilung von Managervergütungen analysiert. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Vergütungsstruktur von Führungskräften. Es werden die verschiedenen Bestandteile von Managergehältern sowie aktuelle Trends in der Vergütungspraxis vorgestellt. Kapitel 5 befasst sich mit der Frage, ob überproportional hohe Managergehälter gerechtfertigt sind. Verschiedene Argumente und Ansätze zur Rechtfertigung werden beleuchtet und kritisch bewertet. Kapitel 6 analysiert die Bedeutung der prozeduralen Gerechtigkeit bei Vergütungsentscheidungen. Es werden die Auswirkungen von ungerechten Entlohnungsstrukturen und Ansätze zur Verbesserung der Verteilungsgerechtigkeit vorgestellt. Das abschließende Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Lohngerechtigkeit, Managergehälter, Gerechtigkeitsprinzipien, Anforderungsgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Marktgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Qualifikationsgerechtigkeit, Erfolgsgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, prozedurale Gerechtigkeit, Vergütungsstrukturen, Entlohnungspolitik, Unternehmensethik, Führungskräftevergütung, Rechtfertigung von Managergehältern.
- Arbeit zitieren
- Susanne Freiburg (Autor:in), 2005, Lohngerechtigkeit. Managergehälter in der Kritik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48926