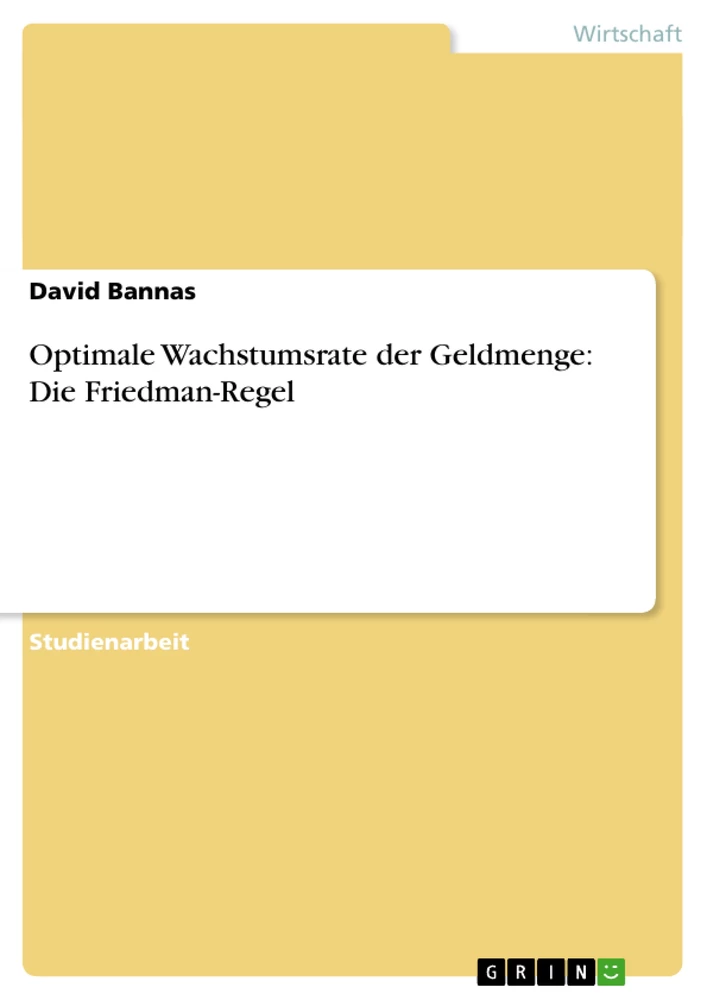Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Friedman-Regel, die Milton Friedman 1969 in seinem Aufsatz „The optimum quantity of money“ veröffentlichte und orientiert sich am Buch „The Foundations of Modern Macroeconomics“ von Ben J. Heijdra und Frederick van der Ploeg aus dem Jahre 2002. Im Rahmen der Hausarbeit wird der Grundgedanke der Friedman-Regel dargestellt und diese anhand von verschiedenen Modellen auf ihre Anwendbarkeit überprüft. Außerdem wird auf einige Kritikpunkte eingegangen, die an der Theorie von Friedman erwachsen sind und dargestellt, unter welchen Annahmen die Friedman-Regel keine Gültigkeit besitzt.
Nachdem in Kapitel 2 zunächst der Grundgedanke der Friedman-Regel erläutert wird, widmet sich Kapitel 3 einem einfachen, zweiperiodigen Gleichgewichtsmodell, dass die Intuition der Friedman-Regel recht anschaulich darstellen kann. Nach einer Kritik diese Modells und seiner Annahmen in Kapitel 4, beschäftigt sich Kapitel 5 mit einem komplexen, mehrperiodigen Modell, in dem insbesondere die Rolle des Staates in der Argumentation von Friedman herausgearbeitet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Grundgedanke der Friedman-Regel
- Die Friedman-Regel in einem einfachen Gleichgewichtsmodell
- Annahmen des Modells
- Herleitung des Gleichgewichts
- Gleichgewicht
- Einfluss des Staates: Variation von μ
- Kritik des Modells
- Modifikation des Grundmodells
- Gleichgewicht im modifizierten Grundmodell
- Einfluss von μ
- Schlussfolgerung
- Die Friedman-Regel im Mehrperiodenmodell
- Annahmen des Modells
- Haushalt
- Unternehmen
- Staat
- Nutzenmaximierung des Haushaltes
- Die Rolle des Staates: Das Problem der optimalen Steuer
- Die modifizierte Budgetbeschränkung des Haushaltes
- Die optimale Steuerrate
- Fall 1: Regulierung über Pauschalsteuern
- Fall 2: Regulierung ohne Pauschalsteuern
- Annahmen des Modells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit widmet sich der Friedman-Regel, die optimale Geldmenge in einer Volkswirtschaft betrachtet. Das Hauptziel ist es, den Grundgedanken dieser Regel zu erläutern und ihre Anwendbarkeit anhand von verschiedenen Modellen zu überprüfen. Darüber hinaus wird die Kritik an der Friedman-Regel untersucht und die Annahmen, unter denen sie nicht gültig ist, dargestellt.
- Der Grundgedanke der Friedman-Regel und das „full-liquidity“-Resultat
- Die Anwendung der Friedman-Regel in einfachen und komplexen Gleichgewichtsmodellen
- Die Rolle des Staates und die Auswirkungen von Steuern auf die Geldmenge
- Kritikpunkte an der Friedman-Regel und die Einschränkungen ihrer Anwendbarkeit
- Die optimale Geldpolitik und deren Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 erläutert den Grundgedanke der Friedman-Regel, die die gesellschaftlich optimale Geldmenge untersucht. Friedman argumentiert, dass im Optimum die sozialen Grenzkosten und der soziale Grenznutzen der Geldhaltung übereinstimmen müssen. Kapitel 3 präsentiert ein einfaches, zweiperiodiges Gleichgewichtsmodell, das die Intuition der Friedman-Regel veranschaulicht. Das Modell berücksichtigt die Nutzenfunktion eines repräsentativen Haushaltes, der aus Konsum und realer Geldhaltung Nutzen zieht. Kapitel 4 kritisiert das Modell aus Kapitel 3 und seine Annahmen. Es untersucht, unter welchen Bedingungen die Friedman-Regel nicht gültig ist. Kapitel 5 führt ein komplexeres, mehrperiodiges Modell ein, in dem die Rolle des Staates und die Auswirkungen von Steuern auf die optimale Geldmenge untersucht werden.
Schlüsselwörter
Friedman-Regel, optimale Geldmenge, „full-liquidity“-Resultat, Grenzkosten, Grenznutzen, Gleichgewichtsmodell, Zeitpräferenzrate, Haushaltsnutzen, staatliche Intervention, Steuern, Deflation.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Friedman-Regel?
Die Regel von Milton Friedman (1969) besagt, dass die optimale Geldmenge dann erreicht ist, wenn die nominalen Zinssätze bei null liegen, um die gesellschaftlichen Grenzkosten der Geldhaltung zu minimieren.
Was ist das "Full-Liquidity"-Resultat?
Es beschreibt einen Zustand, in dem Haushalte so viel Geld halten, wie sie für ihren Nutzen benötigen, weil die Opportunitätskosten der Geldhaltung (Zinsen) wegfallen.
Welche Rolle spielt der Staat laut Friedman?
Der Staat steuert die Geldmenge über die Zentralbank. Die Arbeit untersucht, wie staatliche Steuern und Pauschalzahlungen die optimale Geldpolitik beeinflussen.
Warum wird die Friedman-Regel kritisiert?
Kritikpunkte sind die unrealistischen Annahmen vollkommener Märkte und die Tatsache, dass Deflation (notwendig für Nullzinsen) andere wirtschaftliche Probleme verursachen kann.
Wie wirkt sich die Zeitpräferenzrate aus?
In den Gleichgewichtsmodellen zeigt sich, dass die optimale Wachstumsrate der Geldmenge eng mit der Zeitpräferenz der Haushalte und der Wachstumsrate der Wirtschaft verknüpft ist.
- Quote paper
- David Bannas (Author), 2003, Optimale Wachstumsrate der Geldmenge: Die Friedman-Regel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48832