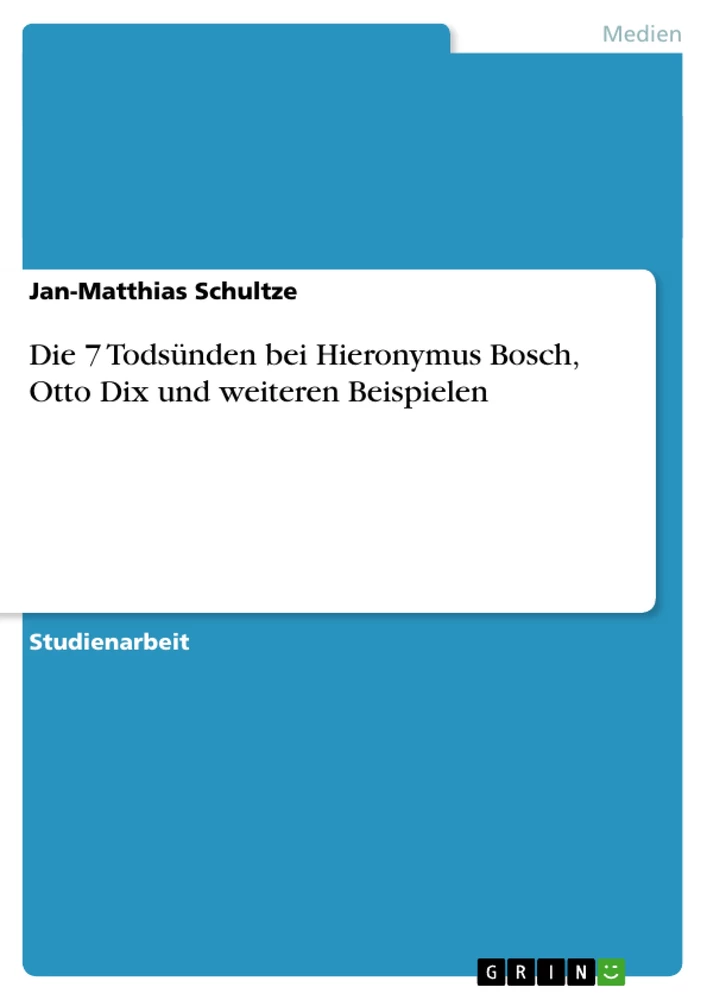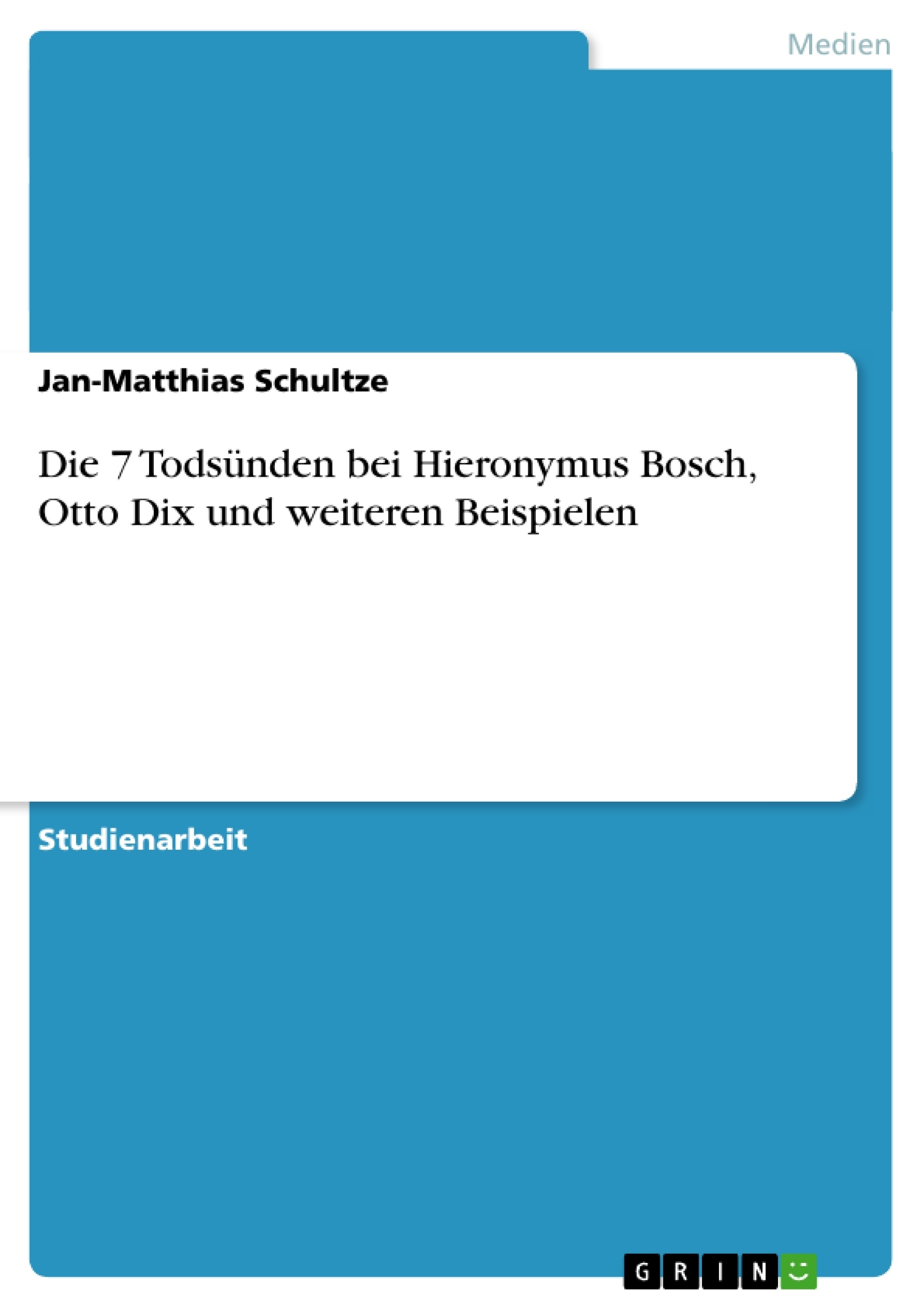Abraham Lincoln, amerikanischer Präsident im 19. Jahrhundert, soll einmal gesagt haben: „Menschen, die keine Laster haben, haben auch keine Tugenden.“ Kaum etwas ist faszinierender und mithin öfter ein Teil psychologischer Rezeptionsgeschichte wie die menschlichen Laster und Tugenden. Abnorme Verhaltensweisen waren schließlich seit je her ein wesentlicher Bestandteil unserer Existenz und sind es heute noch. Die Verfehlung als Symbol unkontrollierter Schwäche, als Zeichen leidenschaftlichen Handelns und Denkens ist ein Merkmal, das immer wieder seine Berücksichtigung sowohl in der Literatur als auch bildenden Kunst findet. Gerade die im Katholizismus begründeten sieben Todsünden stellen ein besonders interessantes Motiv dar, zumal hier die Verknüpfung zeitgeschichtlicher Wertevorstellungen mit der künstlerischen Verarbeitung eines weitgehend biblischen Begriffs den Versuch rechtfertigt, anhand bestimmter Werke das Todsündenthema diachronisch zu betrachten. In dieser Arbeit jedoch soll weder der Anspruch einer allumfassenden Interpretation noch die Vollständigkeit hinsichtlich der Aufzählung von Kunsterzeugnissen verfolgt werden, die das Thema der Tugenden und Sünden aufgreifen. Vielmehr soll der Versuch unternommen werden, einige wenige – durchaus repräsentative Werke – als Vorlage für die Betrachtung der einzelnen Todsünden und deren Auftreten in einigen Werken der Malerei und Literatur dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der geistesgeschichtliche Hintergrund der Sieben Todsünden
- Ursprung der Todsünden-Darstellung: Die Psychomachia des Prudentius
- Die 7 Todsünden: Zwei Beispiele
- Hieronymus Bosch
- Otto Dix
- Die 7 Todsünden: Die Allegorie in der Darstellung der einzelnen Laster
- Superbia
- Invidia
- Ira
- Acedia
- Avaritia
- Gula
- Luxuria
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der sieben Todsünden in Werken der Malerei und Literatur, insbesondere im späten Mittelalter. Sie konzentriert sich auf die allegorische und symbolische Verwendung dieser Motive und beleuchtet den geistesgeschichtlichen Hintergrund der Todsündenlehre. Die Analyse ausgewählter Werke soll die diachrone Betrachtung des Themas ermöglichen.
- Geistesgeschichtlicher Hintergrund der sieben Todsünden
- Ikonographische Entwicklung der Todsünden-Darstellung
- Allegorie und Symbolik in der Darstellung der einzelnen Todsünden
- Analyse ausgewählter Werke von Hieronymus Bosch und Otto Dix
- Vergleichende Betrachtung der künstlerischen Interpretationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sieben Todsünden ein und erläutert die Bedeutung dieser Motive in Kunst und Literatur. Sie betont den Fokus der Arbeit auf ausgewählte, repräsentative Werke und grenzt den Umfang der Untersuchung ab. Der einleitende Zitat von Abraham Lincoln verdeutlicht die universelle Relevanz von Tugenden und Lastern.
Der geistesgeschichtliche Hintergrund der 7 Todsünden: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung der Lehre der sieben Todsünden von ihren persisch-babylonischen Ursprüngen bis zur kanonischen Siebenzahl bei Papst Gregor dem Großen. Es beschreibt die verschiedenen Stadien der Entwicklung des Kanons, beginnend mit Evagrius von Pontius' acht Todsünden und der Weiterentwicklung durch Cassian und Gregor den Großen, der schließlich die heute bekannten sieben Todsünden festlegte. Das Kapitel betont den dauerhaften Einfluss dieses Katalogs auf Kunst und Literatur.
Ursprung der Todsünden-Darstellung: Die Psychomachia des Prudentius: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung von Prudentius' "Psychomachia" für die ikonographische Darstellung der sieben Todsünden. Die "Psychomachia", ein Epos aus dem Jahr 405, beschreibt den allegorischen Kampf zwischen Tugenden und Lastern als Personifikationen. Das Kapitel hebt die Bedeutung dieses Werkes als Grundlage für eine neue, bildliche Herangehensweise an christliche Motive im späten Mittelalter hervor.
Die 7 Todsünden: Zwei Beispiele: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der sieben Todsünden in Werken von Hieronymus Bosch. Es betont Boschs innovative, szenenhafte Darstellung im Vergleich zu früheren Buchmalereien und beschreibt die ikonographische Besonderheit seiner Werke. Die kreisförmige Struktur des Bildes und die Bedeutung des göttlichen Auges als Mittelpunkt werden erläutert.
Schlüsselwörter
Sieben Todsünden, Allegorie, Symbolik, Hieronymus Bosch, Otto Dix, Prudentius, Psychomachia, Ikonographie, mittelalterliche Kunst, Geistesgeschichte, Laster, Tugenden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung der Sieben Todsünden in Kunst und Literatur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der sieben Todsünden in Werken der Malerei und Literatur, insbesondere im späten Mittelalter. Der Fokus liegt auf der allegorischen und symbolischen Verwendung dieser Motive und dem geistesgeschichtlichen Hintergrund der Todsündenlehre. Ausgewählte Werke dienen der diachronen Betrachtung des Themas.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den geistesgeschichtlichen Hintergrund der sieben Todsünden, die ikonographische Entwicklung ihrer Darstellung, die Allegorie und Symbolik in der Darstellung der einzelnen Todsünden, eine Analyse ausgewählter Werke von Hieronymus Bosch und Otto Dix sowie einen Vergleich der künstlerischen Interpretationen.
Welche Künstler werden analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere die Darstellungen der sieben Todsünden bei Hieronymus Bosch und Otto Dix. Der Vergleich ihrer unterschiedlichen künstlerischen Interpretationen ist ein zentraler Aspekt der Arbeit.
Welche Rolle spielt die "Psychomachia" des Prudentius?
Die "Psychomachia" von Prudentius (405 n. Chr.) wird als entscheidend für die ikonographische Darstellung der sieben Todsünden betrachtet. Das Epos, welches den allegorischen Kampf zwischen Tugenden und Lastern beschreibt, gilt als Grundlage für die bildliche Herangehensweise an christliche Motive im späten Mittelalter.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, geistesgeschichtlichem Hintergrund der sieben Todsünden, dem Ursprung der Todsünden-Darstellung in der "Psychomachia", der Analyse ausgewählter Werke (Bosch und Dix) und einer Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sieben Todsünden, Allegorie, Symbolik, Hieronymus Bosch, Otto Dix, Prudentius, Psychomachia, Ikonographie, mittelalterliche Kunst, Geistesgeschichte, Laster, Tugenden.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung der sieben Todsünden in Kunst und Literatur zu untersuchen und deren Entwicklung und Interpretation über verschiedene Epochen hinweg zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse der allegorischen und symbolischen Elemente und dem Verständnis des geistesgeschichtlichen Kontextes.
Wo liegen die Ursprünge der Lehre der sieben Todsünden?
Die Arbeit verfolgt die historische Entwicklung der Lehre von ihren persisch-babylonischen Ursprüngen bis zur kanonischen Siebenzahl bei Papst Gregor dem Großen. Sie beschreibt die verschiedenen Stadien der Entwicklung des Kanons, beginnend mit Evagrius von Pontius' acht Todsünden und der Weiterentwicklung durch Cassian und Gregor den Großen.
- Citar trabajo
- Jan-Matthias Schultze (Autor), 2005, Die 7 Todsünden bei Hieronymus Bosch, Otto Dix und weiteren Beispielen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48782