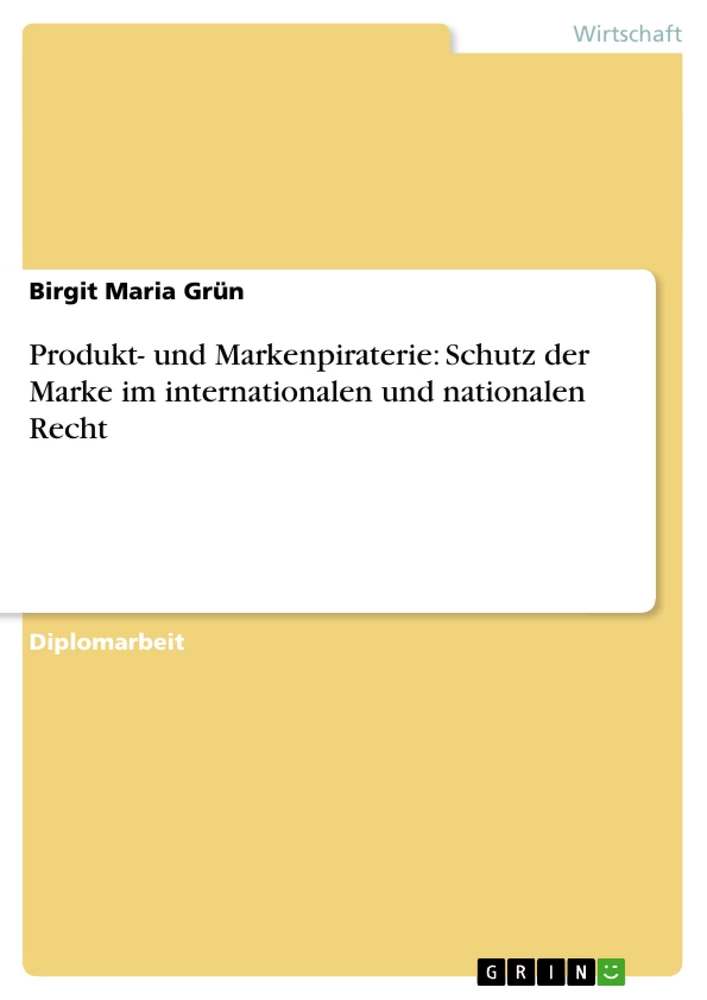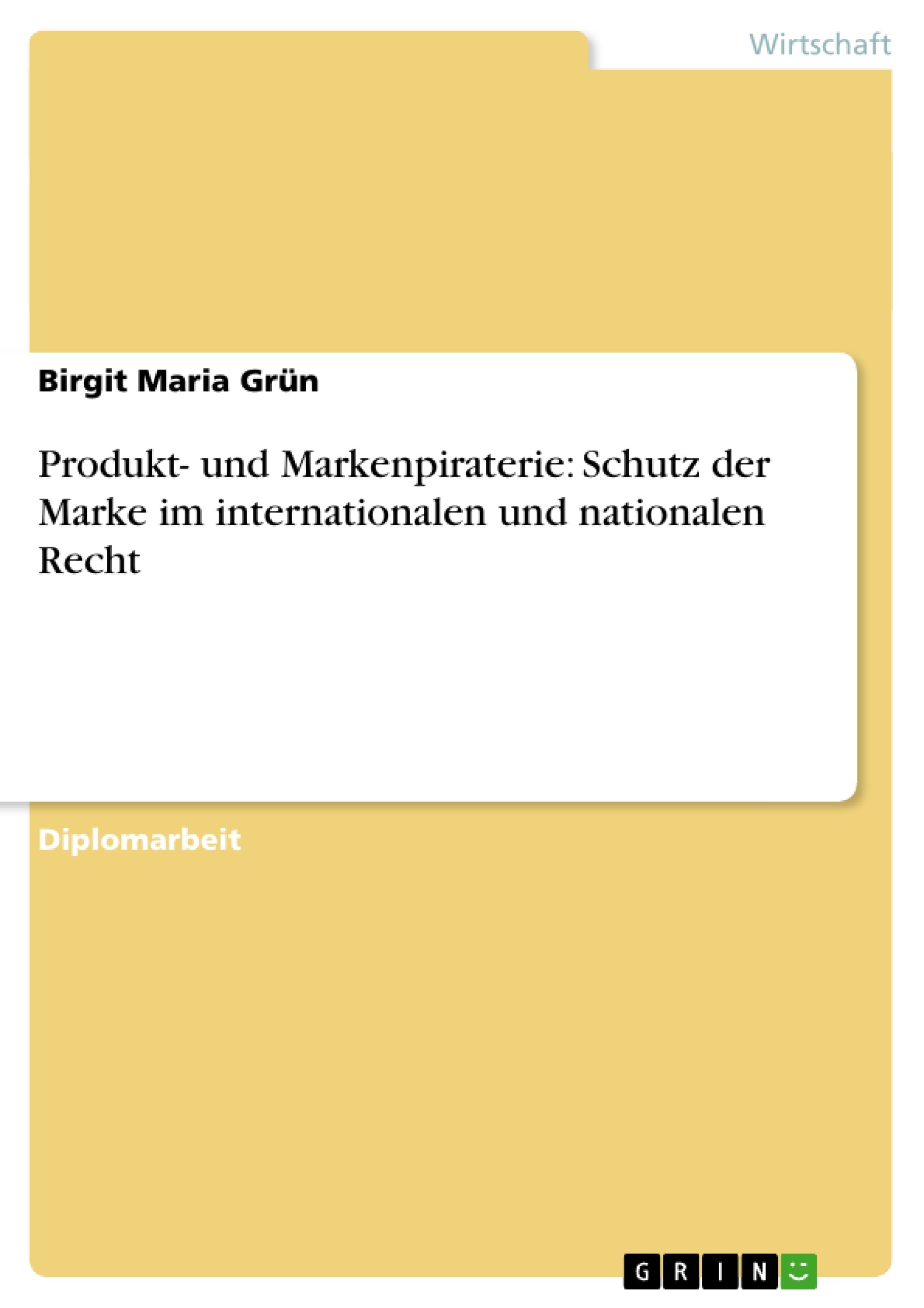Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht haben für die unternehmerische Tätigkeit enorme, manchmal sogar existentielle Bedeutung. Sie schützen nicht nur bestimmte unternehmerische Leistungen und Werte (zB eine Erfindung oder eine Marke) sondern sichern auch einen fairen Wettbewerb mit den Konkurrenten.
Im Rahmen einer zunehmenden Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft und des wachsenden Wettbewerbsdrucks werden die Marke sowie das Markenmanagement zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmenspolitik.
Schwerpunkt dieser Arbeit ist der Schutz der Marke eines Unternehmens in Österreich, auf EU-Ebene sowie durch internationale Abkommen in Zusammenhang mit Produkt- und Markenpiraterie.
Nicht im Detail behandelt werden die markenrechtlichen Probleme des Internets, sowie geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen.
Im ersten Teil der Arbeit wird der Begriff der Marke näher erläutert, ihre Bedeutung, und die Funktionen, die eine Marke für ein Unternehmen und die Konsumenten ausübt. Weiters wird auf die verschiedenen Markenarten, die keineswegs abschließend sind, eingegangen.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich näher mit der Problematik der Produkt-und Markenpiraterie. Eine Definition dieser beiden Begriffe und somit eine Abgrenzung ist leider nicht möglich. Ein kurzer Überblick über die aktuelle Entwicklung soll einen Überblick über das Ausmaß der Piraterie geben. Nach der Untersuchung der Ursachen werden die betroffenen Produktkategorien, sowie die Folgen der Piraterie auf Unternehmen, Konsumenten und die Volkswirtschaft im Allgemeinen gezeigt.
Den Abschluss bildet die Untersuchung über den rechtlichen Schutz der Marke. Auf internationaler Ebene sind hier vor allem die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums aus dem Jahr 1883, das die Grundlage für alle weiteren Abkommen darstellt, und das Abkommen über die handelsbezogenen Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums der WTO (World Trade Organization) zu nennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriff der Marke
- 2.1 Bedeutung der Marke
- 2.2 Markenarten
- 2.2.1 Markenfähigkeit
- 2.2.2 Die Marke als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen
- 2.2.3 Einteilung nach dem Markeninhaber
- 2.2.4 Unterschiede nach der Art der Benützung und der Bestimmung
- 2.3 Funktionen der Marke
- 2.3.1 Herkunftsfunktion
- 2.3.2 Unterscheidungs-, Kennzeichnungsfunktion/Individualisierungsfunktion, Identifizierungsfunktion
- 2.3.3 Qualitäts-, Garantie- oder Vertrauensfunktion
- 2.3.4 Kommunikations- bzw Werbefunktion
- 2.3.5 Monopolisierungsfunktion
- 3 Problematik der Produkt- und Markenpiraterie
- 3.1 Aktuelle Entwicklungen
- 3.2 Begriffliche Abgrenzung
- 3.3 Die Ursachen der Produkt- und Markenpiraterie und ihre Bedeutung
- 3.4 Betroffene Produktkategorien
- 3.5 Folgen der Produkt- und Markenpiraterie
- 3.5.1 für den Markeninhaber bzw. das Unternehmen
- 3.5.2 für die Konsumenten
- 3.5.3 für die Volkswirtschaft
- 3.6 Schutzmöglichkeiten: Strategien internationaler Unternehmen
- 3.7 Anti-Piraterie-Organisationen – Nationale und internationale Verbände und Organisationen
- 3.8 Zoll
- 3.9 Rolle der MOEL hinsichtlich des EU-Beitrittes
- 4 Der rechtliche Schutz der Marke
- 4.1 Entwicklung des Markenschutzes
- 4.2 International
- 4.2.1 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums - „PVÜ“
- 4.2.2 World Trade Organisation (WTO) – „TRIPS-Abkommen“
- 4.3 EU/Europa
- 4.3.1 Markenrechtsrichtlinie – „MarkenRL“
- 4.3.2 Die Gemeinschaftsmarkenverordnung – „GMV“
- 4.3.3 Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der VO (EG) Nr 40/95 über die Gemeinschaftsmarke vom 27.12.2002
- 4.3.4 EG-Verordnung über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren in den zollrechtlichen freien Verkehr
- 4.3.5 Produktpiraterie-Verordnung
- 4.3.6 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum
- 4.3.7 Verordnung (EG) Nr 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen
- 4.4 Österreich
- 4.4.1 Historische Entwicklung und Überblick
- 4.4.2 Piraterie in Österreich
- 4.4.3 Das Kennzeichenrecht
- 4.4.4 Markenschutzgesetz – „MSchG“
- 4.4.5 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb – „UWG“
- 4.4.6 Produktpirateriegesetz – „PPG“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Problematik der Produkt- und Markenpiraterie und beleuchtet den rechtlichen Schutz von Marken im internationalen und nationalen Kontext. Die Arbeit analysiert die Ursachen, Folgen und Bekämpfungsmöglichkeiten dieser illegalen Praktiken.
- Definition und Bedeutung von Marken
- Ursachen und Folgen der Produkt- und Markenpiraterie
- Nationale und internationale Rechtsrahmen zum Markenschutz
- Strategien zur Bekämpfung von Markenpiraterie
- Analyse des österreichischen Rechtsrahmens im Kontext der EU-Gesetzgebung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Produkt- und Markenpiraterie ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie begründet die Relevanz des Themas und stellt die Forschungsfrage dar.
2 Begriff der Marke: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Marke" und differenziert zwischen verschiedenen Markenarten und deren Funktionen. Es erläutert die Bedeutung der Marke als Unterscheidungs- und Identifizierungsmerkmal und deren Rolle im Wettbewerb. Die verschiedenen Funktionen einer Marke, von der Herkunftsfunktion bis zur Monopolisierungsfunktion, werden detailliert dargestellt und ihre Bedeutung für Unternehmen und Konsumenten herausgearbeitet. Der Exkurs über die Eintragung neuer Markenformen in der EU erweitert den Kontext und zeigt die dynamische Entwicklung des Markenrechts auf.
3 Problematik der Produkt- und Markenpiraterie: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Entwicklung der Produkt- und Markenpiraterie, grenzt den Begriff ab und untersucht die Ursachen sowie die weitreichenden Folgen für Unternehmen, Konsumenten und die Volkswirtschaft. Es werden betroffene Produktkategorien benannt und Strategien internationaler Unternehmen zur Bekämpfung der Piraterie vorgestellt. Die Rolle von Anti-Piraterie-Organisationen, Zollbehörden und der MOEL im Hinblick auf den EU-Beitritt wird beleuchtet. Der Exkurs über Parallelimporte und Erschöpfung vertieft das Verständnis der rechtlichen Grauzonen.
4 Der rechtliche Schutz der Marke: Dieses Kapitel befasst sich mit dem rechtlichen Schutz von Marken auf internationaler, europäischer und österreichischer Ebene. Es analysiert die Entwicklung des Markenschutzes, wichtige internationale Abkommen wie die PVÜ und das TRIPS-Abkommen, sowie die europäische Markenrechtsrichtlinie und die Gemeinschaftsmarkenverordnung. Es beschreibt detailliert den österreichischen Rechtsrahmen, inklusive Markenschutzgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und Produktpirateriegesetz, und beleuchtet die historischen Entwicklungen sowie aktuelle Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Produktpiraterie, Markenpiraterie, Markenschutz, Markenrecht, internationales Recht, nationales Recht, EU-Recht, Österreichisches Recht, Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), TRIPS-Abkommen, Markenrechtsrichtlinie, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Markenfähigkeit, Markenfunktionen, wirtschaftliche Folgen, Konsumentenschutz, Zoll, Anti-Piraterie-Strategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Produkt- und Markenpiraterie
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Problematik der Produkt- und Markenpiraterie und den rechtlichen Schutz von Marken im internationalen und nationalen Kontext. Sie analysiert die Ursachen, Folgen und Bekämpfungsmöglichkeiten dieser illegalen Praktiken mit Fokus auf den österreichischen Rechtsrahmen im Kontext der EU-Gesetzgebung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Bedeutung von Marken, die Ursachen und Folgen der Produkt- und Markenpiraterie, nationale und internationale Rechtsrahmen zum Markenschutz, Strategien zur Bekämpfung von Markenpiraterie und eine Analyse des österreichischen Rechtsrahmens im Kontext der EU-Gesetzgebung. Sie umfasst eine detaillierte Betrachtung der verschiedenen Markenarten und -funktionen, sowie die rechtlichen Schutzmöglichkeiten auf internationaler (PVÜ, TRIPS), europäischer (MarkenRL, GMV) und österreichischer Ebene (MSchG, UWG, PPG).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff der Marke (inkl. Markenarten und -funktionen), ein Kapitel zur Problematik der Produkt- und Markenpiraterie (inkl. Ursachen, Folgen und Bekämpfungsmöglichkeiten) und ein Kapitel zum rechtlichen Schutz der Marke auf internationaler, europäischer und österreichischer Ebene. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterpunkte, die die jeweiligen Themengebiete umfassend behandeln.
Welche konkreten Rechtsakte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert eine Vielzahl an relevanten Rechtsakten, darunter die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), das TRIPS-Abkommen der WTO, die Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL), die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV), das österreichische Markenschutzgesetz (MSchG), das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) und das Produktpirateriegesetz (PPG). Zusätzlich werden weitere relevante EU-Verordnungen und Richtlinien zum Thema Markenschutz und Bekämpfung von Produktpiraterie betrachtet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Problematik der Produkt- und Markenpiraterie zu vermitteln und den rechtlichen Schutz von Marken im internationalen und nationalen Kontext zu beleuchten. Sie soll die Ursachen und Folgen dieser illegalen Aktivitäten analysieren und Strategien zu deren Bekämpfung aufzeigen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse des österreichischen Rechtsrahmens im Kontext der EU-Gesetzgebung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Produktpiraterie, Markenpiraterie, Markenschutz, Markenrecht, internationales Recht, nationales Recht, EU-Recht, Österreichisches Recht, Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), TRIPS-Abkommen, Markenrechtsrichtlinie, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Markenfähigkeit, Markenfunktionen, wirtschaftliche Folgen, Konsumentenschutz, Zoll, Anti-Piraterie-Strategien.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem Thema Markenschutz, Produktpiraterie und dem rechtlichen Umfeld des geistigen Eigentums befassen, insbesondere für Studierende, Wissenschaftler, Unternehmen im Bereich des Markenmanagements und Rechtsanwälte.
- Quote paper
- Mag. Birgit Maria Grün (Author), 2004, Produkt- und Markenpiraterie: Schutz der Marke im internationalen und nationalen Recht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48420