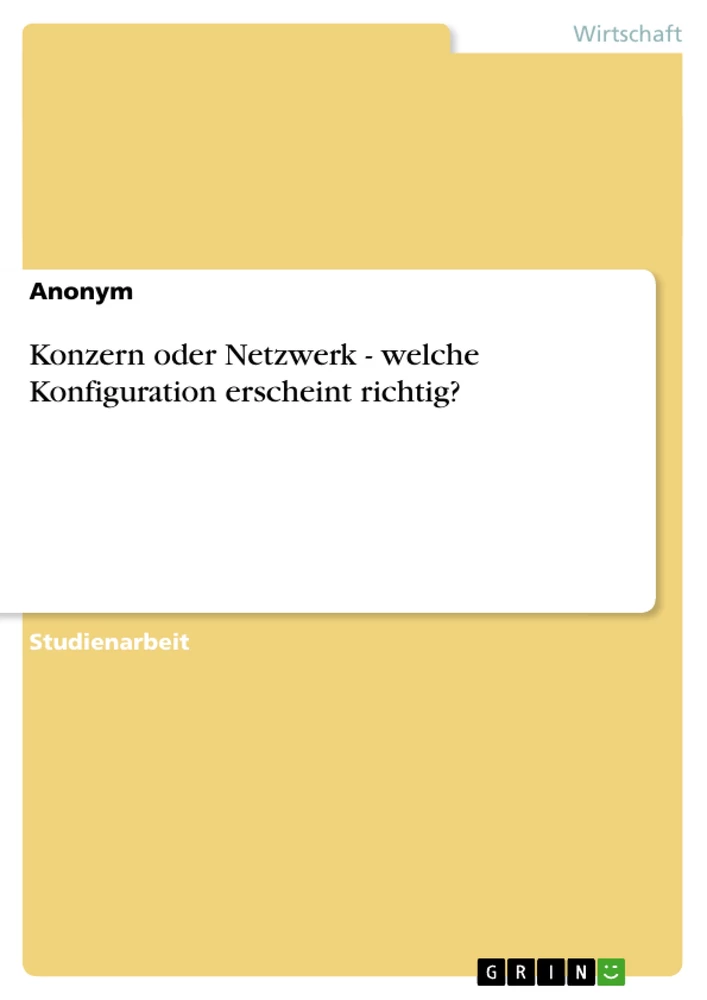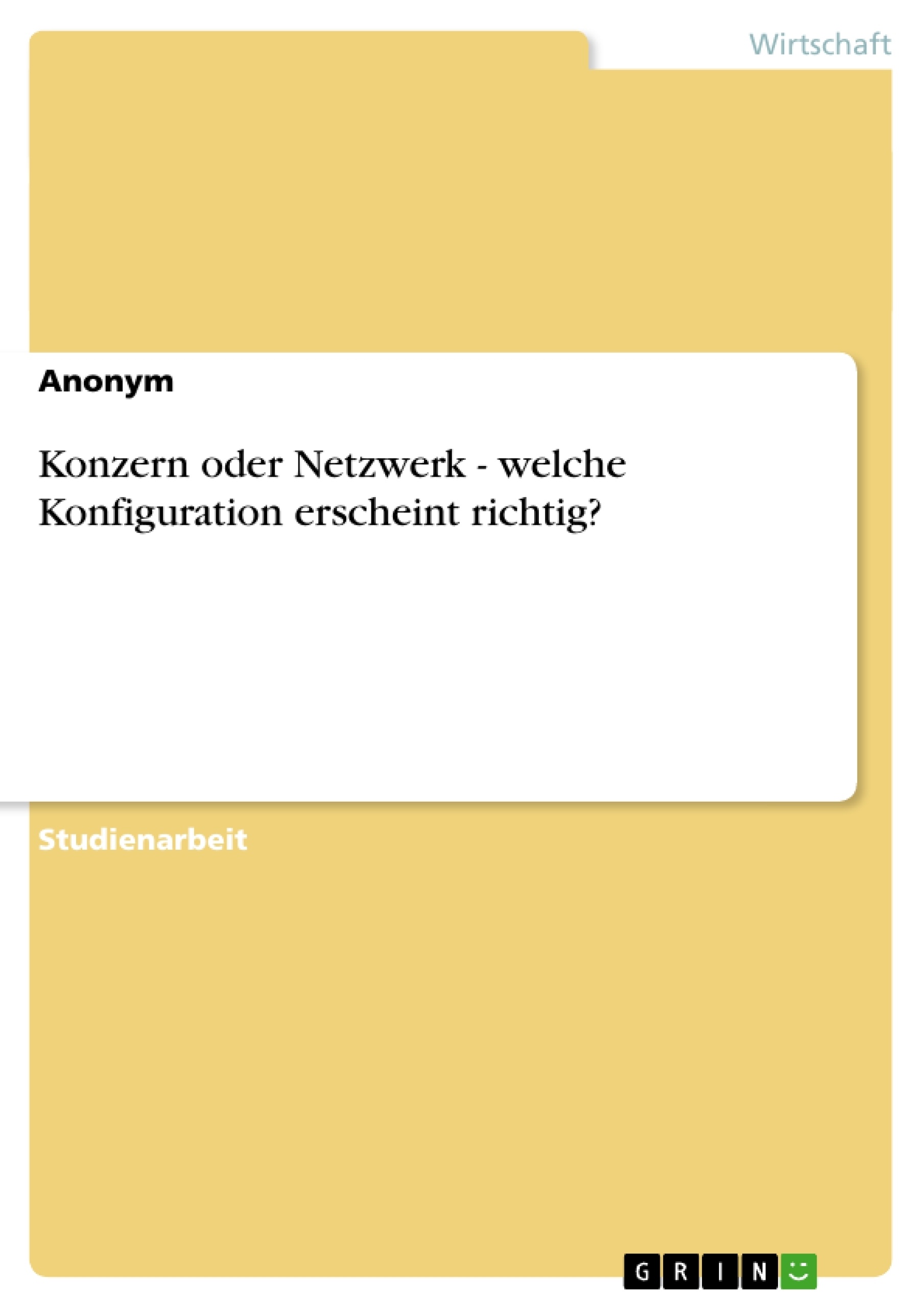Viele Unternehmen sehen sich aktuell einer tief greifenden Veränderung ihres Wettbewerbsumfeldes ausgesetzt. Immer anspruchsvollere Kunden auf Käufermärkten, eine verschärfte Wettbewerbssituation durch die Liberalisierung und Globalisierung der Märkte oder eine Innovationsdynamisierung, nicht zuletzt aufgrund stetig verbesserter Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, machen Flexibilität, Innovations- und Kommunikationsfähigkeit, sowie die ganzheitliche Betrachtung von Prozessen zu den neuen Unternehmensleitbildern. Diese Herausforderungen stellen Unternehmen vor die Entscheidung, ob einzelne Teilaufgaben des Wertschöpfungsprozesses selbst intern durchgeführt oder fremdbezogen werden sollen. Es geht dabei aber nicht nur um eine reine Leistungstiefenoptimierung durch Make- or Buy-Entscheidungen,sondern um die zum Teil nur schwer revidierbare Wahl der für das Unternehmen effizientesten Organisations- bzw. Koordinationsform dieses Teilprozesses. Als eine mögliche Unternehmensstrategie, in Reaktion auf die Entwicklungen im Unternehmensumfeld und die damit einhergehende Dynamisierung des Wettbewerbs, ist in den letzten Jahren die Unternehmenskooperation intensiv diskutiert worden. Vor allem die betriebswirtschaftliche Netzwerktheorie weist auf die Vorteile kleiner, auf Kernkompetenzen spezialisierter und miteinander vernetzter Einheiten hin.
Dem stehen große Konzerne mit einer intensiven Marktdurchdringung, einem relativ hohen vertikalen Integrationsgrad und dem Ziel Skaleneffekte auszunutzen, entgegen. Durch zahlreiche Unternehmensübernahmen und Zusammenschlüsse steht auch der Konzentrationsprozess in starkem Interesse.
Diese Arbeit vergleicht die Organisationsformen Netzwerk und Konzern miteinander und geht der Frage nach, welche dieser in der Koordination wirtschaftlicher Teilprozesse effizienter ist. Theoretische Grundlage dieser Untersuchung ist der Transaktionskostenansatz.
Im folgenden Kapitel werden zunächst die Grundlagen des Transaktionskostenansatzes dargestellt. Um die zentrale Fragestellung mit Hilfe seiner Anwendung zu beantworten, ist eine genaue Abgrenzung der betrachteten Organisationsformen notwendig. Zunächst werden in Kapitel 3 und 4 die Grundlagen des Netzwerks und des Konzerns dargestellt. Kapitel 4.3 nimmt dann zum Verhältnis von Netzwerk und Konzern Stellung und zeigt, dass eine generelle Abgrenzung nicht möglich ist. Eine leichte Umdeutung der Fragestellung wird notwendig.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen des Transaktionskostenansatzes
- 2.1 Grundbegriffe des Transaktionskostenansatzes
- 2.1.1 Transaktion
- 2.1.2 Transaktionsphasen
- 2.2 Verhaltensannahmen des Transaktionskostenansatzes
- 2.3 Transaktionsmerkmale
- 2.4 Der Transaktionskostenansatz als Entscheidungskriterium für die Wahl der Koordinationsform
- 2.1 Grundbegriffe des Transaktionskostenansatzes
- 3. Grundlagen des Netzwerkes
- 3.1 Kooperation: Zwischen Markt und Hierarchie
- 3.2 Unternehmensnetzwerke
- 3.2.1 Strategische Netzwerke
- 3.2.2 Regionale Netzwerke
- 3.2.3 Virtuelle Unternehmung
- 4. Grundlagen des Konzerns
- 4.1 Betriebswirtschaftlicher Ansatz
- 4.2 Rechtswissenschaftlicher Ansatz
- 4.2.1 Unterordnungskonzern
- 4.2.2 Der Gleichordnungskonzern
- 4.3 Das Verhältnis von Netzwerk und Konzern
- 4.3.1 Gleichordnungskonzern
- 4.3.2 Unterordnungskonzern
- 5. Kooperation vs. Hierarchie
- 5.1 Transaktionskostentheoretische Untersuchung
- 5.1.1 Transaktionskostenansatz nach Williamson
- 5.1.2 Transaktionskostenansatz nach Picot
- 5.1.3 Zusammenfassende Analyse
- 5.1.4 Grenzen des Transaktionskostenansatzes
- 5.1.5 Erweiterter Transaktionskostenansatz nach Picot
- 5.2 Aktuelle Entwicklungen und die optimale Organisationsform
- 5.1 Transaktionskostentheoretische Untersuchung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Effizienz von Netzwerken und Konzernen als Koordinationsformen wirtschaftlicher Teilprozesse. Die Zielsetzung besteht darin, mithilfe des Transaktionskostenansatzes einen Vergleich beider Organisationsformen durchzuführen und zu beurteilen, welche Form unter welchen Bedingungen effizienter ist. Die Arbeit berücksichtigt aktuelle Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld.
- Vergleich von Netzwerk und Konzern als Organisationsformen
- Anwendung des Transaktionskostenansatzes zur Effizienzbewertung
- Analyse der Vor- und Nachteile beider Organisationsformen
- Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld
- Untersuchung der Grenzen des Transaktionskostenansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel des Wettbewerbsumfeldes und die damit verbundenen Herausforderungen für Unternehmen. Sie führt die Notwendigkeit der Wahl einer effizienten Organisations- bzw. Koordinationsform für Teilprozesse ein und benennt die Unternehmenskooperation und Konzernbildung als zwei strategische Reaktionen auf diese Entwicklungen. Die Arbeit kündigt den Vergleich von Netzwerk und Konzern unter Anwendung des Transaktionskostenansatzes an.
2. Grundlagen des Transaktionskostenansatzes: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es die Kernbegriffe des Transaktionskostenansatzes wie Transaktion, Transaktionsphasen und Verhaltensannahmen erläutert. Es werden die relevanten Transaktionsmerkmale definiert und der Ansatz als Entscheidungskriterium für die Wahl der Koordinationsform positioniert. Dies bildet die Basis für die spätere Analyse von Netzwerken und Konzernen.
3. Grundlagen des Netzwerkes: Dieses Kapitel definiert und beschreibt die grundlegenden Konzepte von Unternehmensnetzwerken. Es beleuchtet die Kooperation als eine Organisationsform zwischen Markt und Hierarchie und differenziert zwischen strategischen, regionalen und virtuellen Netzwerken. Die jeweiligen Charakteristika und Vorteile dieser Netzwerkformen werden herausgestellt.
4. Grundlagen des Konzerns: Das Kapitel behandelt die Grundlagen des Konzerns aus betriebswirtschaftlicher und rechtswissenschaftlicher Perspektive. Es unterscheidet zwischen Unterordnungs- und Gleichordnungskonzernen und analysiert deren jeweilige Strukturen und Merkmale. Der Abschnitt zum Verhältnis von Netzwerk und Konzern verdeutlicht die Komplexität der Abgrenzung und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung.
5. Kooperation vs. Hierarchie: In diesem Kapitel erfolgt die transaktionskostentheoretische Untersuchung und Gegenüberstellung von Hierarchie (Konzern) und Kooperation (Netzwerk). Es werden die Ansätze von Williamson und Picot zum Transaktionskostenansatz diskutiert, eine zusammenfassende Analyse präsentiert und die Grenzen des Ansatzes aufgezeigt. Der erweiterte Ansatz von Picot wird ebenfalls berücksichtigt, um die Komplexität der Entscheidung für die optimale Organisationsform zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Transaktionskostenansatz, Netzwerk, Konzern, Kooperation, Hierarchie, Williamson, Picot, Effizienz, Koordinationsform, Wettbewerb, Organisationsform, Make-or-Buy, Vertikale Integration, Skaleneffekte, Unternehmenskooperation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Transaktionskostenansatz, Netzwerke und Konzerne
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Effizienz von Netzwerken und Konzernen als Koordinationsformen wirtschaftlicher Teilprozesse. Sie untersucht, welche Organisationsform unter welchen Bedingungen effizienter ist, mithilfe des Transaktionskostenansatzes und unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld.
Welche Methoden werden verwendet?
Die zentrale Methode ist die Anwendung des Transaktionskostenansatzes. Dieser Ansatz wird genutzt, um die Vor- und Nachteile von Netzwerken und Konzernen zu analysieren und deren Effizienz zu bewerten. Die Arbeit berücksichtigt dabei verschiedene Perspektiven, inklusive der Ansätze von Williamson und Picot.
Welche Organisationsformen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Unternehmensnetzwerke (strategische, regionale und virtuelle Netzwerke) und Konzerne (Unterordnungs- und Gleichordnungskonzern). Der Vergleich beleuchtet die Unterschiede in ihren Strukturen, Merkmalen und Effizienz unter verschiedenen Bedingungen.
Was sind die zentralen Thesen der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Grenzen des traditionellen Transaktionskostenansatzes und berücksichtigt aktuelle Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld, um die Wahl der optimalen Organisationsform zu beleuchten. Sie argumentiert, dass die Wahl zwischen Netzwerk und Konzern von spezifischen Transaktionsmerkmalen und den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängt.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlagen des Transaktionskostenansatzes, Grundlagen des Netzwerkes, Grundlagen des Konzerns, Kooperation vs. Hierarchie und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik, von der theoretischen Fundierung über die Beschreibung der Organisationsformen bis hin zur vergleichenden Analyse und Schlussfolgerung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Transaktionskostenansatz, Netzwerk, Konzern, Kooperation, Hierarchie, Williamson, Picot, Effizienz, Koordinationsform, Wettbewerb, Organisationsform, Make-or-Buy, vertikale Integration, Skaleneffekte, Unternehmenskooperation.
Welche Aspekte des Transaktionskostenansatzes werden behandelt?
Die Arbeit erläutert die Grundbegriffe des Transaktionskostenansatzes (Transaktion, Transaktionsphasen, Verhaltensannahmen), die relevanten Transaktionsmerkmale und die Anwendung des Ansatzes als Entscheidungskriterium für die Wahl der Koordinationsform. Sie diskutiert auch die Ansätze von Williamson und Picot, zeigt die Grenzen des Ansatzes auf und berücksichtigt einen erweiterten Ansatz nach Picot.
Wie werden Netzwerke und Konzerne definiert und unterschieden?
Die Arbeit definiert Netzwerke als Kooperationen zwischen Unternehmen, die zwischen Markt und Hierarchie angesiedelt sind. Sie unterscheidet zwischen strategischen, regionalen und virtuellen Netzwerken. Konzerne werden sowohl betriebswirtschaftlich als auch rechtswissenschaftlich definiert, wobei Unterordnungs- und Gleichordnungskonzern unterschieden werden. Das Verhältnis zwischen Netzwerken und Konzernen wird ebenfalls analysiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der vergleichenden Analyse von Netzwerken und Konzernen zusammen und formuliert Schlussfolgerungen zur Wahl der effizientesten Koordinationsform unter verschiedenen Bedingungen. Die Arbeit betont die Abhängigkeit der optimalen Organisationsform von den spezifischen Transaktionsmerkmalen und dem dynamischen Wettbewerbsumfeld.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2004, Konzern oder Netzwerk - welche Konfiguration erscheint richtig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48346