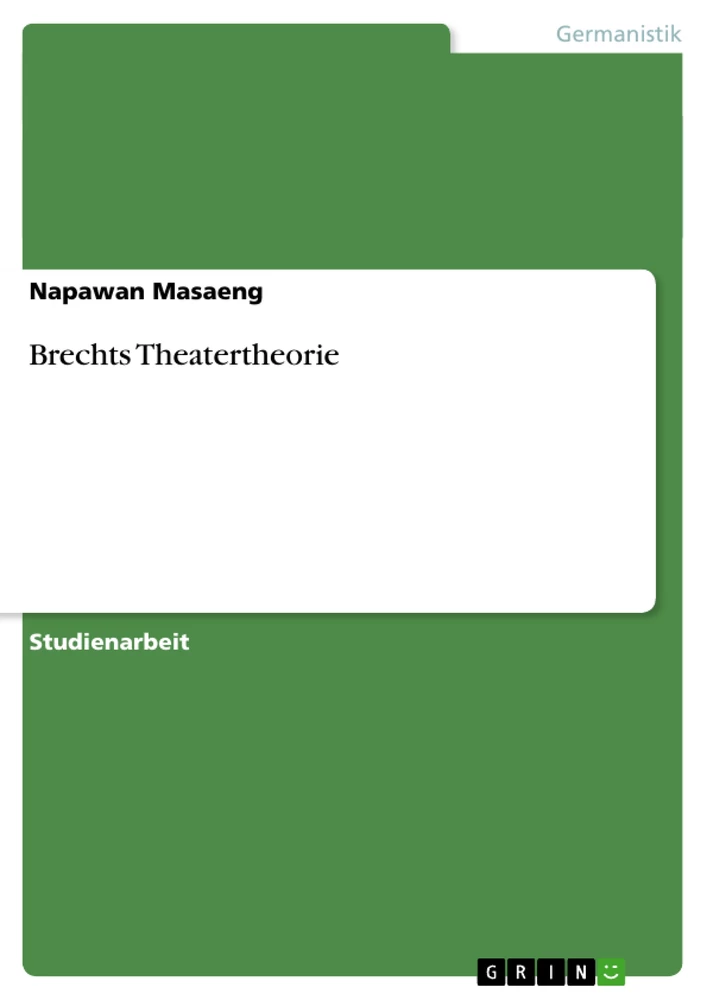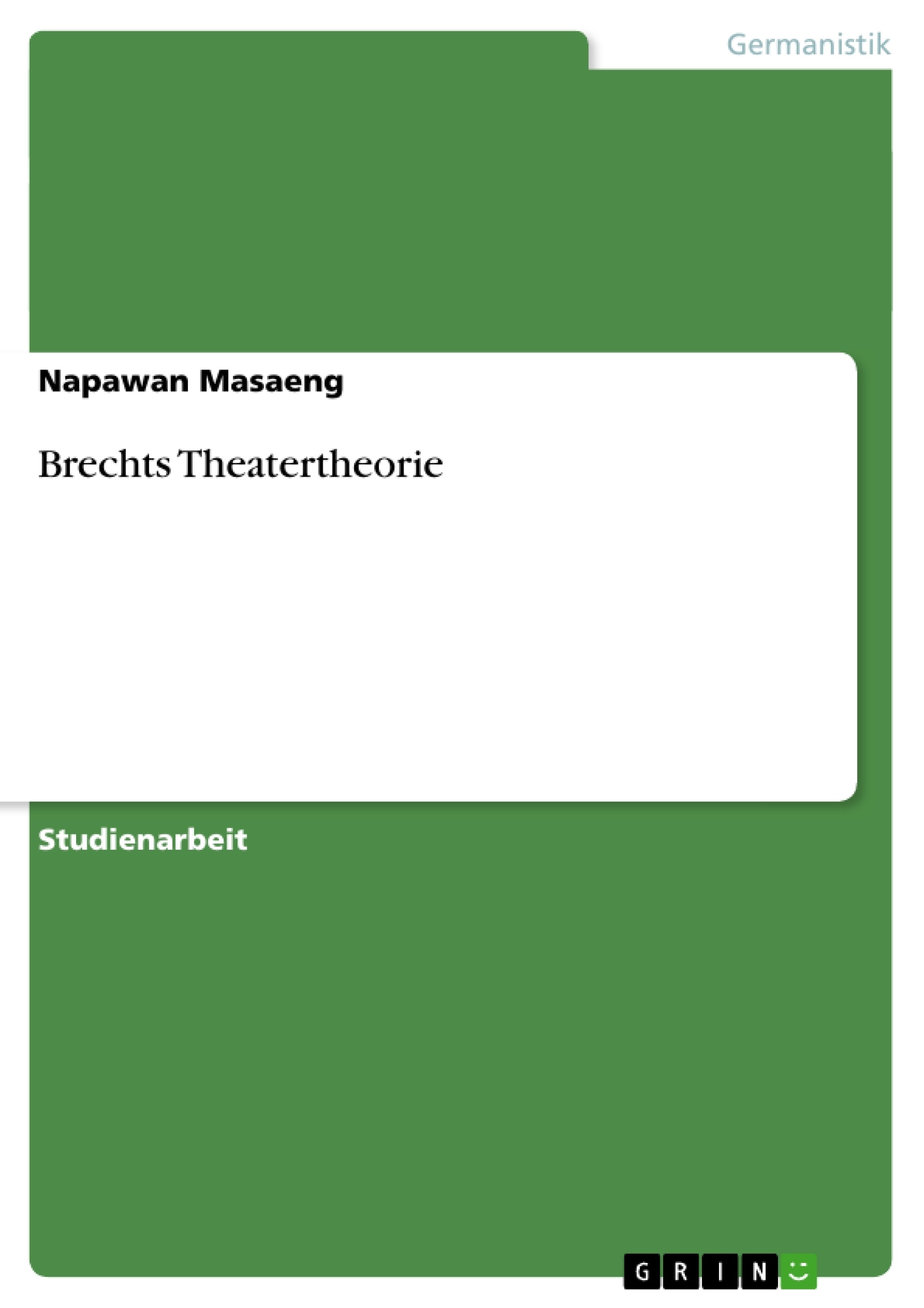Zum Begriff :
Epik : Bezeichnung für alle erzählenden und berichtenden Dichtungsformen
Episch : erzählend/ erzählerisch
Das epische Theater Brechts ist eine Bezeichnung, unter Anlehnung an den Begriff der Epik , für eine von ihm praktizierte und geprägte Darstellungsform des modernen Theaters.
Grundgedanke :
Seit 1925 hat Brecht als Dramaturg mit seiner eigenen Theatertheorie, dem epischen Theater, begonnen und erste Grundsätze formuliert, die das Bürgertum mit dem absolutistischen Adel gegenüberstellen. Das epische Theater Brechts ist folglich mit den gesellschaftlichen Veränderungen im marxistischen Sinne geprägt.
Brechts marxistischer Gedanke lag in der Idee der Veränderung, d.h. in der Dialektik. Er meinte, alles sollte immer in Bewegung sein, diskutiert und verbessert werden. Man sollte immer weitersuchen und weiterdenken. Er glaubte an
die Notwendigkeit der sozialistischen Revolution
die Macht der Vernunft
die heraufkommende neue Zeit
In den 20iger und frühen 30iger Jahren schrieb Brecht viele kommunistische Lehrstücke. Er schrieb sie, weil er glaubte, das Theater sei ein Mittel zur politischen Aufklärung der proletarischen Massen. Das Theater soll revolutionäre Verhältnisse demonstrieren, auch soll man diese Themen auf der Bühne diskutieren. Das Theater hatte das Ziel zu lehren.
In den Lehrstücken ( z.B. die Maßnahme ) Brechts ist das Individuum weniger wichtig als die Masse, und das Individuum muss lernen, sich der Masse zu fügen. Es gab eine absolute Unterordnung des Einzelnen unter die Idee der sozialistischen Revolution, ja der Einzelne wurde sogar ausgelöscht. Später schrieb er Stücke, die weniger politisch waren, d.h., sie hatten noch immer eine klare ideologische Linie, aber diese war nicht so vordergründig wie in den früheren Werken.
Um seine Ziele zu erreichen, entwickelte Brecht Theorien über das Drama und das Theater, die für seine Werke, aber auch für das Theater des 20. Jahrhunderts von großer Bedeutung waren.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Zum Begriff:
- Grundgedanke:
- Das Wesentliche vom epischen Theater in Kürze:
- Das ideale epische Theater...
- Der ideale Zuschauer..
- Bauelemente des epischen Theaters.
- Die Rolle der Schauspieler...
- Brechts Intention.
- Das Lernen am Lehrstück Brechts.
- Biographie Brechts:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Werk befasst sich mit dem epischen Theater Bertolt Brechts, einem bedeutenden Theaterkonzept, das die traditionelle dramatische Form in Frage stellte. Die Arbeit analysiert Brechts Grundgedanken und Zielsetzungen sowie die zentralen Bausteine seines epischen Theaters. Darüber hinaus werden die Unterschiede zwischen dem aristotelischen und dem epischen Theater sowie Brechts Ansatz des "Lernens am Lehrstück" behandelt.
- Brechts Kritik am aristotelischen Theater
- Die Prinzipien des epischen Theaters
- Die Rolle des Zuschauers im epischen Theater
- Die Bedeutung des Lehrstücks
- Brechts politischer und sozialer Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Zum Begriff: Dieser Abschnitt definiert den Begriff "episches Theater" im Kontext der literarischen Gattung der Epik und erläutert Brechts Adaption dieses Begriffs für seine Theaterform.
- Grundgedanke: Hier werden die grundlegenden Ideen hinter Brechts epischem Theater vorgestellt. Dabei wird Brechts marxistischer Hintergrund und seine Auffassung von Dialektik, gesellschaftlichem Wandel und der Rolle des Theaters als Mittel der politischen Aufklärung beleuchtet.
- Das Wesentliche vom epischen Theater in Kürze: Dieser Abschnitt bietet eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale des epischen Theaters, wie beispielsweise das offene Drama, die politische Weltanschauung und die Betonung der Vernunft statt der Emotion.
- Das ideale epische Theater...: In diesem Kapitel werden die Ziele und Ideale des epischen Theaters hinsichtlich der Zuschauerrolle, der Handlungsgestaltung und der Vermeidung von emotionaler Verwicklung erläutert. Es wird betont, dass der Zuschauer zum aktiven Betrachter und zum kritischen Denker werden soll.
- Der ideale Zuschauer..: Dieser Abschnitt beschreibt die Eigenschaften des idealen Zuschauers im epischen Theater. Er soll aktiv an der Handlung teilhaben, sie kritisch hinterfragen und eigene Entscheidungen treffen. Der Zuschauer soll sich von emotionalen Reaktionen lösen und die Welt des Stücks mit einem analytischen Blick betrachten.
- Bauelemente des epischen Theaters.: Hier werden die wichtigsten Bausteine des epischen Theaters vorgestellt, wie z.B. die Verwendung von Verfremdungseffekten, die Betonung des gesellschaftlichen Kontextes und die aktive Einbeziehung des Zuschauers in den Prozess der Erkenntnisgewinnung.
- Die Rolle der Schauspieler...: In diesem Abschnitt werden die spezifischen Anforderungen an Schauspieler im epischen Theater hervorgehoben. Die Schauspieler sollen nicht nur die Figuren verkörpern, sondern auch eine Distanz zu ihnen bewahren und gleichzeitig die gesellschaftlichen Verhältnisse reflektieren.
- Brechts Intention.: Hier wird Brechts Intention mit dem epischen Theater beleuchtet. Er strebte danach, das Theater zu einem Werkzeug der sozialen Veränderung und politischen Aufklärung zu machen, indem er die Zuschauer zum kritischen Denken und Handeln anregte.
- Das Lernen am Lehrstück Brechts.: Dieser Abschnitt beleuchtet Brechts "Lehrstücke" und deren pädagogischen Anspruch. Er verdeutlicht, wie Brechts Werke das Individuum dazu anregen sollten, sich der Gesellschaft anzupassen und die Ideen der sozialistischen Revolution zu akzeptieren.
Schlüsselwörter
Das epische Theater, Bertolt Brecht, Dramaturgie, Lehrstück, Verfremdungseffekt, Dialektik, Marxismus, politische Aufklärung, sozialistische Revolution, aristotelisches Theater, Zuschauerrolle, Handlungsstruktur, gesellschaftlicher Kontext, Vernunft, Emotion, kritisches Denken, Veränderung.
- Quote paper
- Napawan Masaeng (Author), 2002, Brechts Theatertheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4803