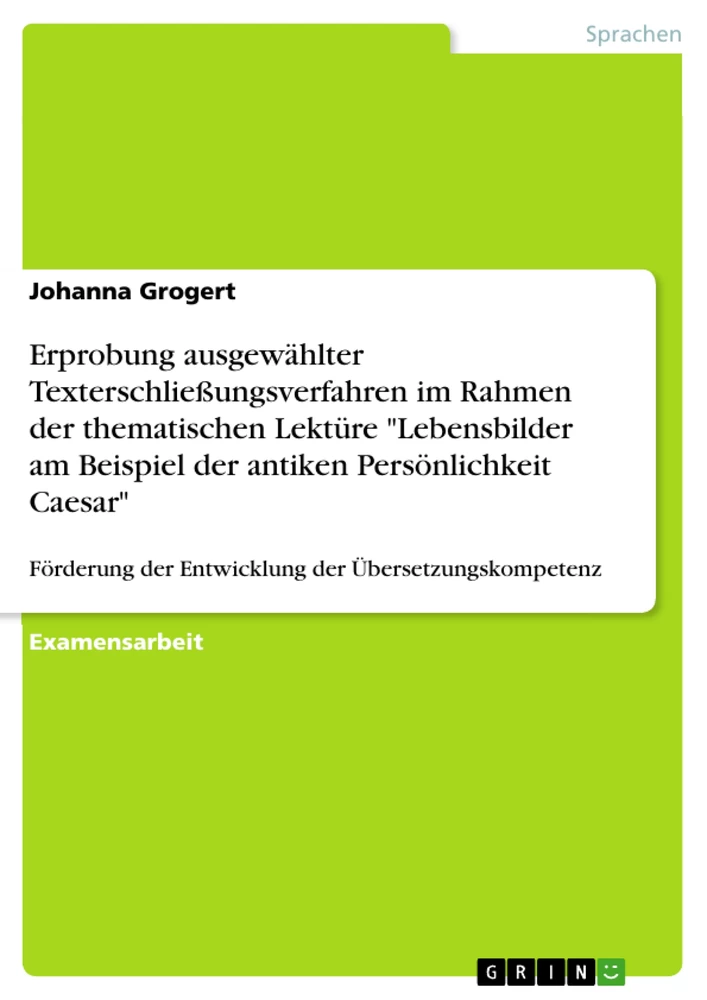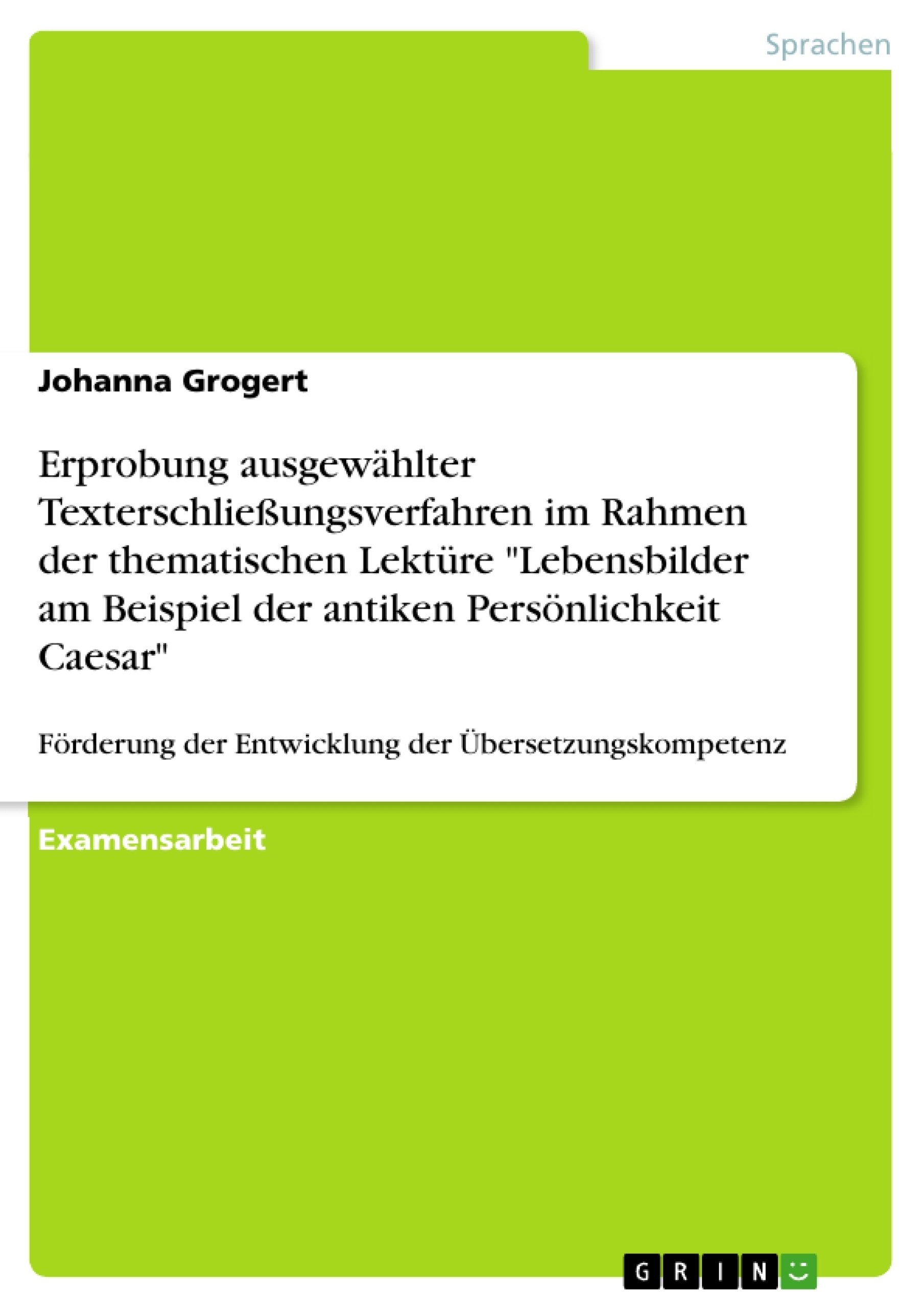Trotz divergierender Ansichten bezüglich der Verfahren zur Förderung der Übersetzungsfähigkeit sind sich doch Fachdidaktiker mehrheitlich darin einig, dass das„Erschließen und Übersetzen lateinischer Texte das zentrale Geschehen im Lateinunterricht darstellen. Nach einem vierjährigen Lateinkurs, in dem die Spracherwerbsphase und eine Phase der Übergangslektüre durchlaufen wurden, setzten die Schüler meines Fundamentalkurses dieser Anforderung eine äußerst geringe Motivation entgegen: „Wir wollen nicht übersetzen, das ist so kompliziert.“ Der Übersetzungsvorgang meiner Lerngruppe endete daher oft in einem chaotischen Durcheinander.
Neben dem für die Übergangs- und Anfangslektüre typischen Lektüreschock ließ sich die Resignation und Hilflosigkeit in Übersetzungsphasen des Unterrichts auf eine kaum vorhandene beziehungsweise fehlende Strukturierung des Übersetzungsvorgangs zurückführen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit besteht aus diesem Grund in der Erprobung ausgewählter Texterschließungsverfahren mit dem Ziel, die Übersetzungskompetenz der Schüler so zu fördern, dass sie zu einer selbständigen und sicheren Vorgehensweise bei dem komplexen Vorgang des Übersetzens angeleitet werden
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Vorüberlegungen
- Lebensbilder am Beispiel der antiken Persönlichkeit Caesar
- Der Übersetzungsvorgang im Lateinunterricht
- Texterschließungsverfahren
- Phrastische Erschließungsverfahren
- Transphrastische Erschließungsverfahren
- Lineares Dekodieren kombiniert mit textlinguistischen Erschließungsverfahren
- Lerngruppendiagnose
- Allgemeine Unterrichtsvoraussetzungen
- Spezielle Lerngruppendiagnose in Bezug auf die schwerpunktmäßig zu fördernde Kompetenz
- Schlussfolgerungen aus den theoretischen Vorüberlegungen in Bezug auf die Lerngruppe
- Untersuchungsfragen und Arbeitshypothesen
- Kompetenzen und Standards
- Planung der Unterrichtssequenz
- Auswahl der Lektüretexte (Sachstrukturanalyse und didaktische Reduktion)
- Methodisch-didaktische Überlegungen
- Synopse mit Abkürzungsverzeichnis (Siehe S. 49 im Anhang)
- Durchführung der Unterrichtssequenz am Beispiel von drei Schwerpunktstunden
- Die Einführung des Linearen Dekodierens (Doppelstunde)
- Sachstrukturanalyse mit Erwartungshorizont
- Didaktischer Kommentar
- Analyse der durchgeführten Doppelstunde
- Einzelelement einer Übungsstunde: Das interaktive Übersetzungsprotokoll
- Sachstrukturanalyse mit Erwartungshorizont
- Didaktischer Kommentar
- Analyse des interaktiven Übersetzungsprotokolls
- Einzelelement zur zusammenfassenden Strukturierung des Übersetzungsvorgangs: das Flussdiagramm
- Sachstrukturanalyse mit Erwartungshorizont
- Didaktischer Kommentar
- Analyse der Flussdiagramme
- Die Einführung des Linearen Dekodierens (Doppelstunde)
- Gesamtevaluation
- Gesamtreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Übersetzungskompetenz von Schülern im Lateinunterricht zu verbessern, indem sie ihnen eine strukturierte Vorgehensweise beim Übersetzen lateinischer Texte vermittelt. Die Unterrichtssequenz, die in dieser Arbeit analysiert wird, soll dazu beitragen, dass Schüler ein selbstständiges und sicheres Vorgehen bei der Übersetzung komplexer Texte erlernen.
- Analyse von Texterschließungsverfahren im Lateinunterricht
- Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Übersetzungskompetenz
- Anwendung des Linearen Dekodierens in Verbindung mit textsemantischen, textsyntaktischen und textpragmatischen Erschließungsverfahren
- Entwicklung eines methodischen Rahmens für die Übersetzung von lateinischen Texten
- Analyse der Wirksamkeit der eingesetzten Methoden anhand von konkreten Unterrichtseinheiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Ausgangssituation im Lateinunterricht dar und begründet die Notwendigkeit einer Verbesserung der Übersetzungskompetenz der Schüler. Sie führt den Schwerpunkt der Arbeit, die Erprobung ausgewählter Texterschließungsverfahren, ein.
- Die Kapitel „Theoretische Vorüberlegungen“ und „Lerngruppendiagnose“ bilden die Grundlage für die Planung und Durchführung der Unterrichtssequenz. Sie analysieren die Thematik „Lebensbilder“ im Lateinunterricht, stellen verschiedene Texterschließungsverfahren vor und skizzieren die Lerngruppe und ihre spezifischen Bedürfnisse.
- Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Planung und Durchführung der Unterrichtssequenz. Kapitel 5 beleuchtet die Auswahl der Lektüretexte und die methodisch-didaktischen Überlegungen. Die folgenden Kapitel (6.1, 6.2, 6.3) analysieren einzelne Unterrichtseinheiten im Detail und zeigen die konkrete Umsetzung der erprobten Methoden.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Übersetzungskompetenz, Texterschließungsverfahren, Lineares Dekodieren, Lebensbilder, antike Persönlichkeiten, Lateinunterricht, didaktische Reduktion, methodische Kompetenz, Unterrichtssequenz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Texterschließungsverfahren im Lateinunterricht?
Ziel ist es, Schülern eine strukturierte Methode zu vermitteln, um den "Lektüreschock" zu überwinden und lateinische Texte selbstständig und sicher zu übersetzen.
Was versteht man unter "Linearem Dekodieren"?
Es ist ein Verfahren, bei dem der Text Wort für Wort in der vorgegebenen Reihenfolge analysiert wird, anstatt sofort nach dem Prädikat zu suchen.
Welche Rolle spielt die Figur Caesar in dieser Unterrichtseinheit?
Caesar dient als thematisches Beispiel für "Lebensbilder", um das Interesse der Schüler durch eine bedeutende antike Persönlichkeit zu wecken.
Was ist ein interaktives Übersetzungsprotokoll?
Ein methodisches Werkzeug, mit dem Schüler ihren eigenen Übersetzungsvorgang reflektieren und strukturieren können.
Was sind phrastische und transphrastische Erschließungsverfahren?
Phrastische Verfahren beziehen sich auf die Analyse einzelner Sätze, während transphrastische Verfahren den gesamten Textzusammenhang und die Logik berücksichtigen.
- Citation du texte
- Johanna Grogert (Auteur), 2008, Erprobung ausgewählter Texterschließungsverfahren im Rahmen der thematischen Lektüre "Lebensbilder am Beispiel der antiken Persönlichkeit Caesar", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/477144