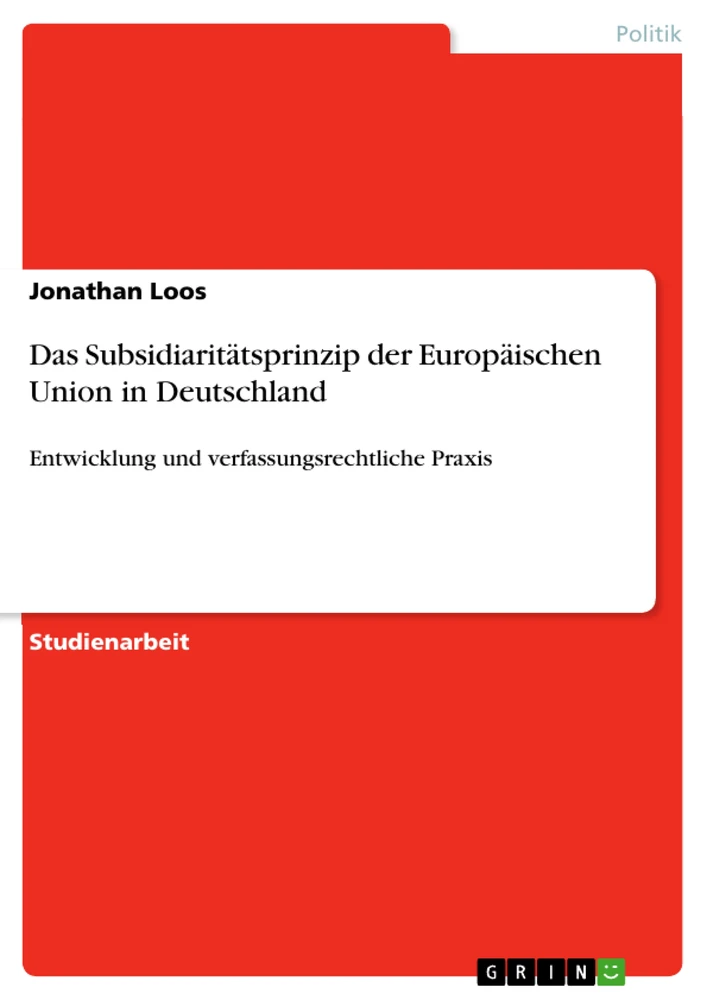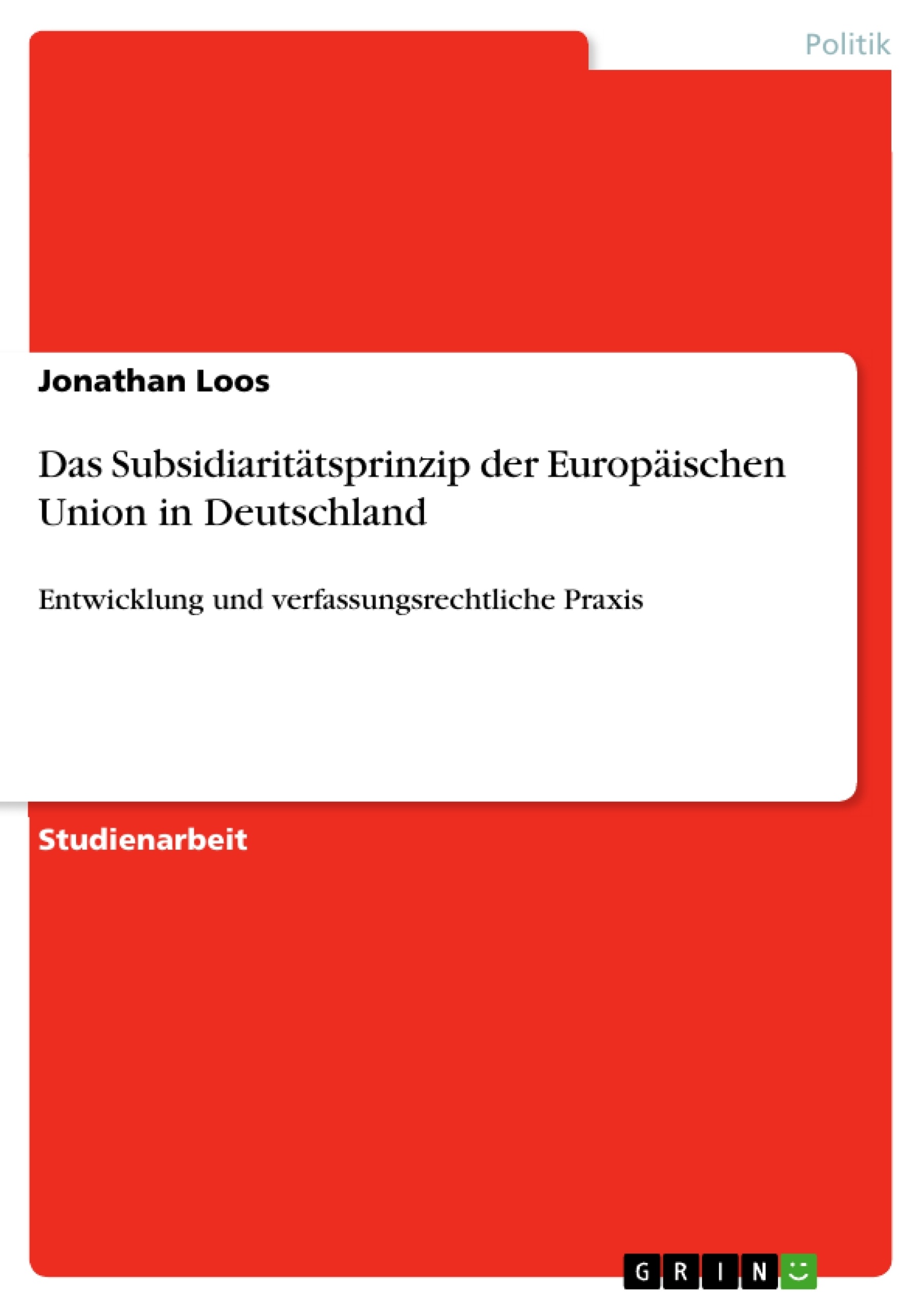In dieser Arbeit wird dargelegt, wie sich das Subsidiaritätsprinzip der EU unter Mitwirkung deutscher Akteure bis zu seiner Festsetzung im Vertrag von Maastricht entwickelt hat und wie es in der verfassungsrechtlichen Praxis in Deutschland zum Tragen kommt. Insbesondere wird darauf eingegangen, inwiefern das Subsidiaritätsprinzip als effektiver Kontrollmechanismus des Bundes und der Länder gegenüber einer Überregulierung durch die Europäische Union in Deutschland Wirkung zeigt.
Das Subsidiaritätsprinzip ist eines der grundlegendsten Prinzipien der Europäischen Union (EU). Es sichert den Nationalstaaten im Staatenverbund der EU zu, dass ihre Kompetenzen nicht übergangen werden und gestattet den nationalen Parlamenten und Regionen weitgreifende Kontrollbefugnisse gegenüber der Gesetzgebung der Europäischen Union. Der allgemeine Sinn und Zweck des Subsidiaritätsprinzips liegt darin, einer untergeordneten Behörde, insbesondere einer lokalen Behörde gegenüber der Zentralgewalt, ein bestimmtes Maß an Unabhängigkeit zu sichern. Somit schützt das Subsidiaritätsprinzip die Handlungsfähigkeit der Mitgliedsstaaten.
Im Rahmen der Europäischen Union kommt das Subsidiaritätsprinzip dann zum Tragen, wenn Kompetenzbereiche betroffen sind, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen. Die Union "darf in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig [werden], sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind".
Diese Formulierung wirft allerdings bereits mehrere Fragen aus. Zunächst erscheint es unmöglich, genaue Parameter festzulegen, an denen auszumachen wäre, wann eine Maßnahme auf Unionsebene "besser" verwirklicht werden kann. Anschließend stellt sich zwangsläufig auch die Frage nach einer Kontrollierbarkeit des Subsidiaritätsprinzips durch die nationalen Parlamente. Wie ist es den nationalen Parlamenten sowie Parlamentskammern möglich, einem ungerechtfertigten Kompetenzverlust hin zu den europäischen Gesetzgebern vorzubeugen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips
- Das Subsidiaritätsprinzip vor Maastricht
- Interpretationen der Gemeinschaftsnormen
- Die Bundesrepublik als Unterstützer des Subsidiaritätsprinzips
- Das Subsidiaritätsprinzip nach Maastricht
- Das Subsidiaritätsprinzip vor Maastricht
- Die Kontrollmöglichkeiten Deutschlands über die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips in der Europäischen Union
- Informationspflicht der EU gegenüber den nationalen Parlamenten
- Kontrollmechanismen des Subsidiaritätsprinzips
- Die Subsidiaritätsrüge
- Die Subsidiaritätsklage
- Bewertung der Effektivität der Subsidiaritätskontrolle durch Bundestag und Bundesrat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und die verfassungsrechtliche Praxis des Subsidiaritätsprinzips der Europäischen Union in Deutschland. Sie beleuchtet den Weg des Prinzips bis zu seiner Verankerung im Vertrag von Maastricht und analysiert die Kontrollmechanismen, die Deutschland zur Verfügung stehen, um die Einhaltung des Prinzips durch die EU zu gewährleisten.
- Historische Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips vor und nach Maastricht
- Interpretationen des Subsidiaritätsprinzips in Gemeinschaftsnormen
- Rolle Deutschlands in der Entwicklung und Durchsetzung des Prinzips
- Kontrollmechanismen des Subsidiaritätsprinzips auf nationaler Ebene
- Effektivität der Subsidiaritätskontrolle durch Bundestag und Bundesrat
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Subsidiaritätsprinzip in der EU ein und erläutert dessen grundlegende Bedeutung für die Wahrung nationalstaatlicher Kompetenzen. Sie hebt die zentrale Frage nach der Kontrollierbarkeit des Prinzips durch nationale Parlamente hervor und skizziert den Fokus der Arbeit auf die historische Entwicklung und die verfassungsrechtliche Praxis in Deutschland. Die Einleitung stellt die Frage nach der praktischen Umsetzung des Prinzips und seiner Effektivität als Kontrollmechanismus gegen Überregulierung durch die EU.
Historische Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips vor seiner formalen Verankerung im Vertrag von Maastricht. Es analysiert unterschiedliche Interpretationen des Prinzips in Gemeinschaftsnormen vor 1993, insbesondere im Kontext des EGKS- und EWG-Vertrags, wobei der Fokus auf dem Erforderlichkeitsgrundsatz und dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung liegt. Das Kapitel beschreibt die Rolle der Bundesrepublik Deutschland als frühen Unterstützer des Prinzips, unter anderem durch den Einfluss auf den Entwurf eines Vertrags zur Gründung einer Europäischen Union von 1984 und die Reaktion auf die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1987, wobei die "Zehn Münchner Thesen" der Landesregierungschefs als Ausdruck der Sorge um die zunehmende Zentralisierung der Macht hervorgehoben werden. Die Bedeutung der deutschen Beteiligung an der europäischen Integration und der Einfluss auf die Ausgestaltung des Subsidiaritätsprinzips werden detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Subsidiaritätsprinzip, Europäische Union, Deutschland, nationale Parlamente, Kompetenzverteilung, Kontrollmechanismen, Maastricht-Vertrag, Überregulierung, Bundestag, Bundesrat, Verfassungsrecht, Europäische Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung und verfassungsrechtliche Praxis des Subsidiaritätsprinzips der Europäischen Union in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und die verfassungsrechtliche Praxis des Subsidiaritätsprinzips der Europäischen Union in Deutschland. Sie beleuchtet den Weg des Prinzips bis zu seiner Verankerung im Vertrag von Maastricht und analysiert die Kontrollmechanismen, die Deutschland zur Verfügung stehen, um die Einhaltung des Prinzips durch die EU zu gewährleisten. Im Fokus steht die praktische Umsetzung des Prinzips und seine Effektivität als Kontrollmechanismus gegen Überregulierung durch die EU.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips vor und nach Maastricht, die Interpretationen des Prinzips in Gemeinschaftsnormen, die Rolle Deutschlands in der Entwicklung und Durchsetzung des Prinzips, die Kontrollmechanismen des Subsidiaritätsprinzips auf nationaler Ebene und die Effektivität der Subsidiaritätskontrolle durch Bundestag und Bundesrat.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips (vor und nach Maastricht, inklusive der Rolle Deutschlands), ein Kapitel zu den deutschen Kontrollmöglichkeiten über die Einhaltung des Prinzips in der EU (Informationspflicht, Subsidiaritätsrüge, Subsidiaritätsklage und deren Effektivität), und abschließende Kapitel mit Zusammenfassung und Schlüsselwörtern.
Welche Kontrollmechanismen Deutschlands werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Informationspflicht der EU gegenüber den nationalen Parlamenten und die Kontrollmechanismen des Subsidiaritätsprinzips, insbesondere die Subsidiaritätsrüge und die Subsidiaritätsklage. Die Effektivität dieser Mechanismen durch Bundestag und Bundesrat wird bewertet.
Welche Rolle spielte Deutschland in der Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips?
Die Arbeit beschreibt die Bundesrepublik Deutschland als frühen Unterstützer des Prinzips, unter anderem durch den Einfluss auf den Entwurf eines Vertrags zur Gründung einer Europäischen Union von 1984 und die Reaktion auf die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1987 ("Zehn Münchner Thesen"). Die deutsche Beteiligung an der europäischen Integration und der Einfluss auf die Ausgestaltung des Subsidiaritätsprinzips werden detailliert dargestellt.
Welche Bedeutung hat der Vertrag von Maastricht?
Der Vertrag von Maastricht markiert einen wichtigen Meilenstein, da das Subsidiaritätsprinzip darin formal verankert wurde. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Prinzips sowohl vor als auch nach diesem Vertrag.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Subsidiaritätsprinzip, Europäische Union, Deutschland, nationale Parlamente, Kompetenzverteilung, Kontrollmechanismen, Maastricht-Vertrag, Überregulierung, Bundestag, Bundesrat, Verfassungsrecht, Europäische Integration.
- Quote paper
- Jonathan Loos (Author), 2014, Das Subsidiaritätsprinzip der Europäischen Union in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471305