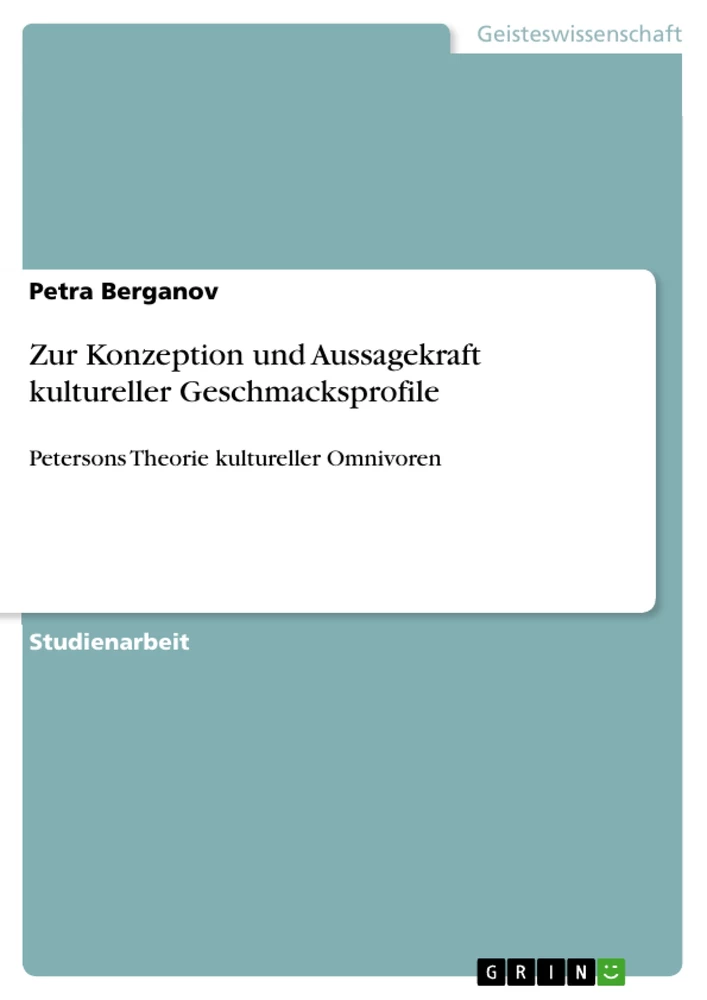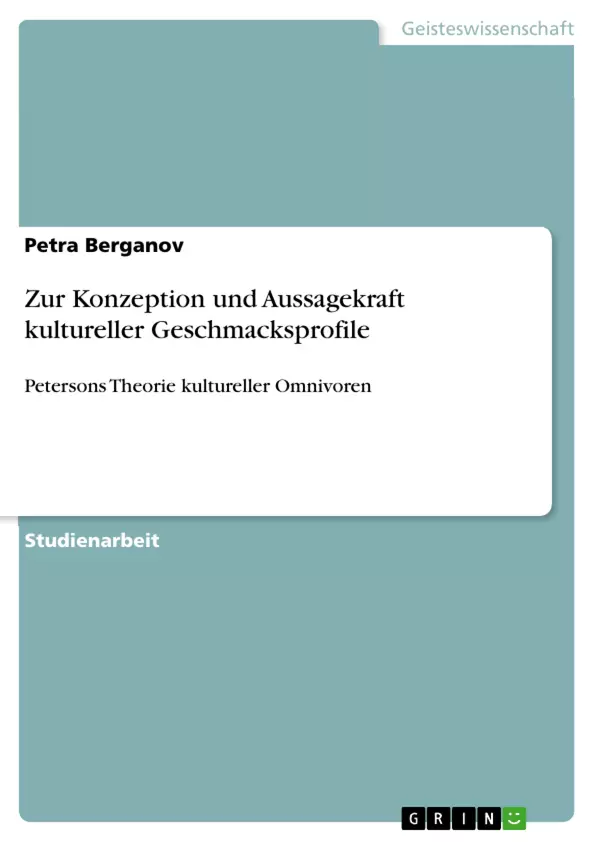In dieser Arbeit werden zunächst Pierre Bourdieus Konzepte von kultureller Distinktion und Statusreproduktion vorgestellt, da sie die kulturtheoretische Grundlage der hier im Zentrum stehenden kulturellen Distinktion ausmachen. Anschließend soll Petersons Modell der Omnivorizität in seinen Grundzügen nachgezeichnet und kritisch diskutiert werden. Es werden mögliche (weitere) theoretische Kategorien zur Bestimmung kultureller Profile vorgestellt. Dabei werden methodische und theoretische Probleme aufgezeigt, die zur Annahme von Omnivorizität als neuem Statusindikator geführt haben, obwohl eine gesamtgesellschaftliche Zunahme dissonanter Kulturprofile bereits damals erkennbar war.
Petersons Konzept der kulturellen Allesfresser basiert auf der Beobachtung einer Reihe von Anomalien in den Geschmacks- und Partizipationsprofilen der höheren sozialen Klassen. Diese waren bei einem Vergleich von Daten zwischen 1982 und 1992 scheinbar deutlich stärker kulturell omnivor geworden und ihre Omnivorizität war überdies ausgeprägter als die anderer, ebenfalls omnivorer Gruppen. Mit Omnivorizität geht die Offenheit einher, verschiedene Kulturformen wertzuschätzen; sie ist also gewissermaßen antithetisch zum Snobismus, durch den sich höhere Statusgruppen vormals auszeichneten.
Die nachweisliche Zunahme dissonanter kultureller Geschmacks- und Partizipationsprofile bietet einen überraschend ergiebigen Ausgangspunkt für die Reflexion kultursoziologischer Praktiken und Vorannahmen, mit denen typischerweise operiert wird. Insofern ist die Auseinandersetzung mit Omnivorizität, auch wenn die These als solche inzwischen als verworfen gilt, höchst interessant, um ganz unterschiedliche Aspekte in den Blick zu nehmen, die mit dem Kulturwandel und der Veränderlichkeit sozialer Distinktionsmerkmale zusammenhängen.
Zugleich ermöglichen sie einen kritischen Blick auf tradierte kultursoziologische Methodologie. Es stellt sich die Frage, ob Menschen ihre Identität wirklich über ihre kulturellen Vorlieben oder über die Vielfalt ihrer Partizipation definieren. Der statistische Blick scheint Individuen zu abstrakten, offiziellen Repräsentanten ihrer sozialen Klasse zu machen; der wahre Gehalt ihrer kulturellen Identität und dessen Komplexität bleiben dabei möglicherweise verborgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Distinktion und Statusreproduktion
- Kulturelles Kapital
- Kunstgeschmack als Distinktionsmerkmal
- Kulturelle Omnivoren
- Mögliche Erklärungen für Omnivorizität
- Popularität und Limitationen der Omnivoren-These
- Die Konzeption kultureller Profile
- Geschmack
- Partizipation
- Volumen vs. Komposition
- Annahme einer kulturellen Hierarchie
- Zur Aussagekraft kultureller Profile
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Konzeption und Aussagekraft kultureller Geschmacksprofile am Beispiel von Petersons Theorie kultureller Omnivoren. Sie analysiert die Entwicklung der Omnivoren-These und ihre Implikationen für die Kultursoziologie, insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie kultureller Geschmack zur Statusreproduktion beiträgt.
- Die Rolle von kulturellem Kapital und Distinktion in der Statusreproduktion
- Die Omnivoren-These: Entwicklung, Argumentation und Kritik
- Methodische und theoretische Herausforderungen bei der Konzeptionierung kultureller Profile
- Die Bedeutung kultureller Dissonanz für die Analyse von Geschmackspräferenzen
- Kritische Betrachtung traditioneller kultursoziologischer Methodologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der erste Teil der Arbeit stellt Pierre Bourdieus Konzepte von kultureller Distinktion und Statusreproduktion vor, welche die Grundlage für Petersons Omnivoren-These bilden. Es werden insbesondere Bourdieus Konzepte von Habitus und kulturellem Kapital erläutert.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel widmet sich Petersons Modell der kulturellen Omnivorizität. Es skizziert die zentralen Argumente der These und beleuchtet kritische Diskussionen, die sich um ihre Validität und Aussagekraft drehen.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel werden verschiedene theoretische Kategorien zur Bestimmung kultureller Profile vorgestellt. Es werden methodische und theoretische Probleme aufgezeigt, die zur Annahme von Omnivorizität als neuem Statusindikator geführt haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Kultursoziologie, wie kulturelle Distinktion, Statusreproduktion, kulturelles Kapital, Geschmacksbildung, Omnivorizität, kulturelle Dissonanz und methodische Herausforderungen der Kulturforschung. Es werden insbesondere die Arbeiten von Pierre Bourdieu und Richard Peterson analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „kulturelle Omnivorizität“?
Das Konzept von Richard Peterson beschreibt Personen (meist aus höheren sozialen Schichten), die eine Offenheit für verschiedenste Kulturformen – von Hochkultur bis Populärkultur – zeigen.
Wie unterscheidet sich Omnivorizität vom Snobismus?
Während sich Snobismus durch die exklusive Bevorzugung von Hochkultur und Abgrenzung auszeichnet, ist die Omnivorizität durch Vielfalt und kulturelle Offenheit geprägt.
Welche Rolle spielt Pierre Bourdieu in dieser Debatte?
Bourdieu lieferte mit seinen Konzepten von Habitus, kulturellem Kapital und Distinktion die theoretische Grundlage für die Untersuchung von Geschmacksprofilen zur Statusreproduktion.
Was sind „dissonante Kulturprofile“?
Dissonante Profile liegen vor, wenn der kulturelle Geschmack einer Person nicht den typischen Erwartungen ihrer sozialen Klasse entspricht oder widersprüchliche Vorlieben kombiniert.
Dient kultureller Geschmack noch der Statusreproduktion?
Ja, aber die Merkmale haben sich gewandelt. Heute kann gerade die Vielfalt und Breite des kulturellen Wissens (Omnivorizität) als neues Statusmerkmal fungieren.
- Citation du texte
- Petra Berganov (Auteur), 2018, Zur Konzeption und Aussagekraft kultureller Geschmacksprofile, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471292