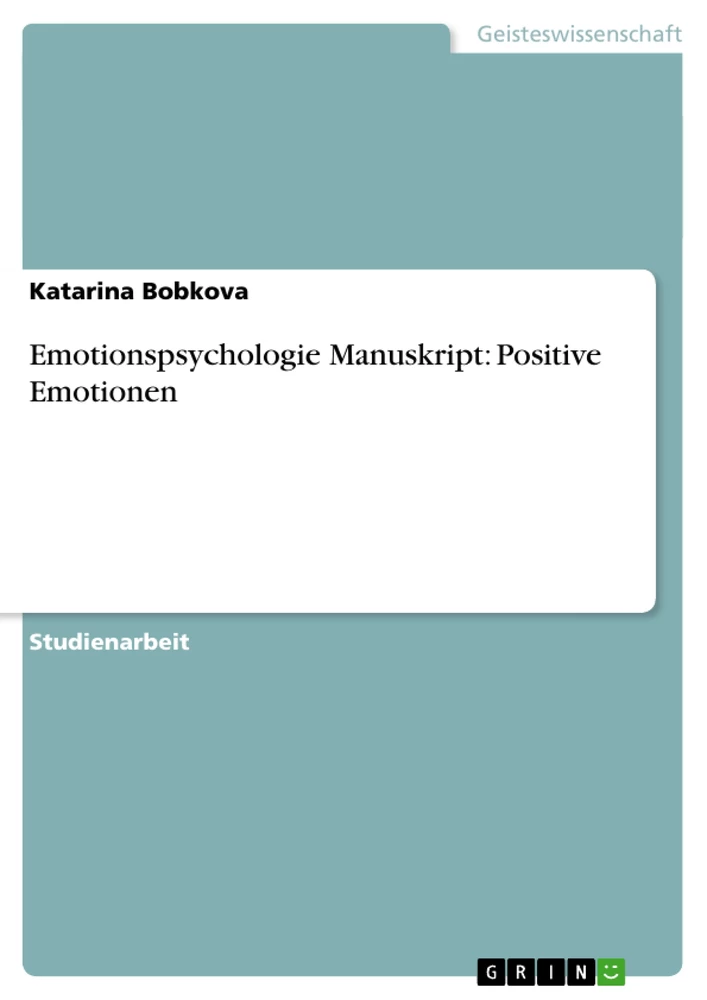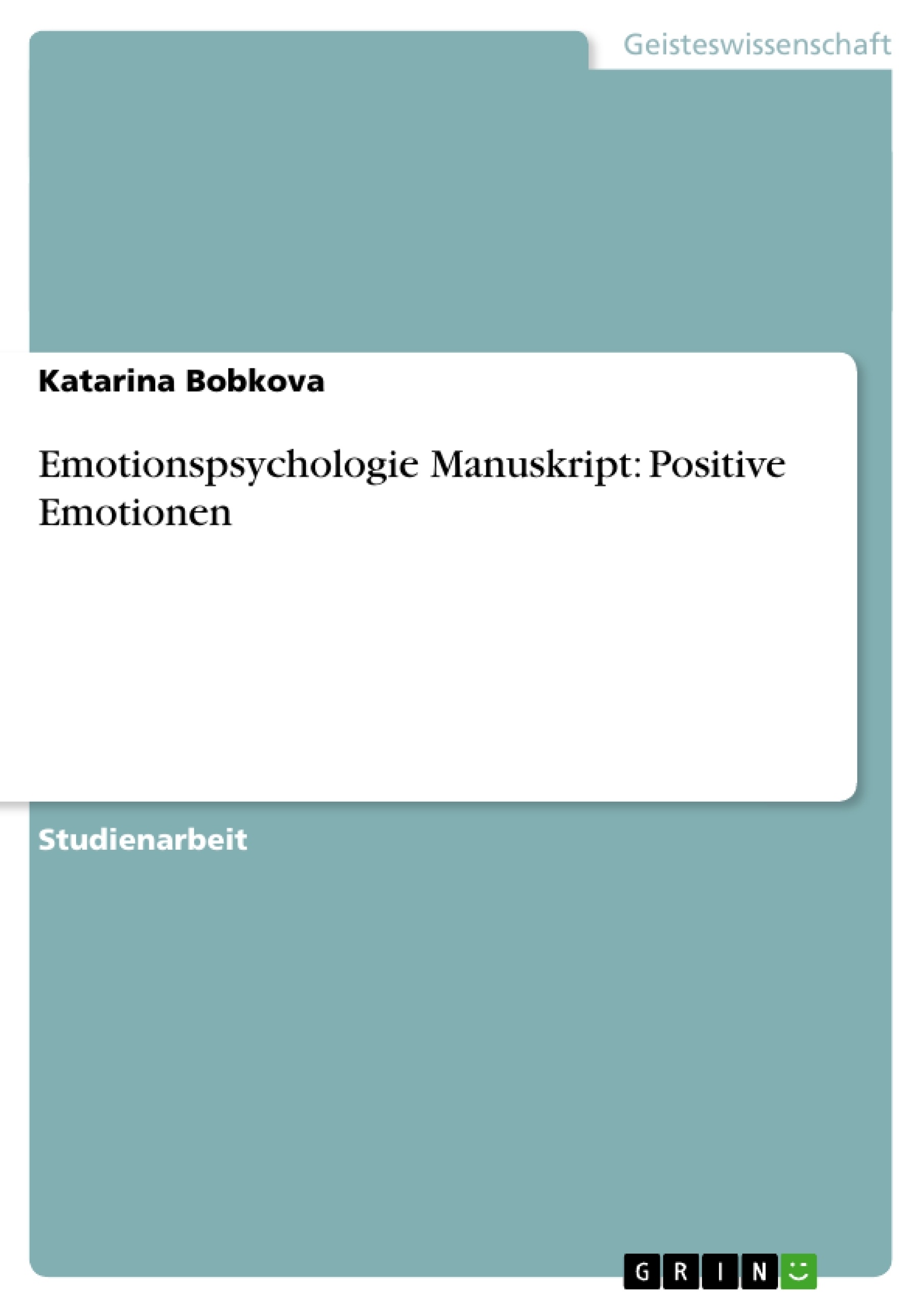Mit der Ergründung Positiver Emotionen beschäftigt man sich in der psychologischen Forschung erst seit relativ kurzem. Vor etwa fünf Jahren entstand ein neuer Forschungszweig in der Psychologie, diePositive Psychologie.Als Vater der Positiven Psychologie wird der amerikanische Psychologe und ehemalige Präsident der APA (American Psychological Association)Martin E. P. Seligmanbezeichnet. Sein Anliegen ist es Methoden zu finden, die den Menschen helfen würden, ihre persönliche Erfüllung zu finden und sich nicht nur auf die Untersuchung und Heilung psychischer Erkrankungen zu beschränken.
Im Vergleich zu den so genannten Negativen Emotionen, wie zum Beispiel, Furcht, Traurigkeit, o.a. wurden Positive Emotionen bislang in der Forschung eher stiefmütterlich behandelt. Dafür lassen sich mehrere Gründe anführen. (siehe auch Fredrickson, 2003, S. 39). Die Untersuchung Positiver Emotionen scheint sich komplizierter zu gestalten, als vielleicht erwartet. Z. B. sind Positive Emotionen physisch äußerlich nur schwer voneinander differenzierbar, im Vergleich zu Negativen Emotionen. Sie lassen sich auf ein und dieselbe Art des physischen Ausdrucks reduzieren, das durch den Forscher Paul Ekman beschriebene Duchenne-Lächeln (hochgezogene Mundwinkel, charakteristische Fältchenbildung um die Augen, verschmälerte bzw. geschlossene Augen). Hinzu kommt, dass Negative Emotionen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen eher (auch häufiger) als Ursachen bzw. Symptome erkannt werden. Was die Sache nicht vereinfacht, ist der Fakt, dass sich im menschlichen Gehirn kein ausgesprochenes Lustzentrum lokalisieren lässt. Hat ein Mensch Positive Emotionen, so kommt es zu einer, vielleicht als netzartig zu beschreibende Aktivierung verschiedenster Hirnregionen.
Das Ungleichgewicht der Positiven und Negativen Emotionen spiegelt sich auch in unserer Sprache wider. Die Anzahl der sogenannten negativen Emotionswörter überwiegt die, der positiven bei weitem. Das Wort Glück z. B. fand seinen Eingang in die deutsche Sprache erst um das Jahr 1160. Es leitet sich vom mittelhochdeutschen „gelücke“ ab, was in etwa „passend“ oder „gelungen“ bedeutet. Man muss bis heute für „Glück haben“ und „Glück empfinden“ mit einem Begriff auskommen. Alle anderen europäischen Sprachen unterscheiden in dieser Hinsicht sauber, das Englische etwa in „luck“ und „hapiness“. Die Sprache im alten Indien kennt ein gutes Dutzend Wörter für die verschiedenen Weisen, Glück zu empfinden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition/Begriffsklärung
- 3. Das Lachen
- 3.1. Ausdruck der Freude
- 3.2. Lachen als Symptom
- 4. Neurobiologische Zusammenhänge und ihre Auswirkungen
- 4.1. Dopamin/Endorphine/Enkephaline
- 4.2. Luliberin
- 5. Effekte von positiven Emotionen
- 5.1. Kognitive Effekte
- 5.1.1. Denken
- 5.1.2. Kreatives Problemlösen, Innovation, kognitive Flexibilität
- 5.1.3. Entscheidungsbereitschaft
- 5.1.4. Soziale Interaktion
- 5.1.5. Motivation
- 5.2. Körperliche Effekte von Positiven Emotionen
- 5.1. Kognitive Effekte
- 6. Flow-Konzept
- 7. Die Glück(Sinn)suche
- 7.1. Alltagsansatz
- 7.2. Therapieansatz
- 8. Zusammenfassung
- 9. Problemfragen und Thesen für die Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Erforschung positiver Emotionen, einem relativ neuen Forschungsgebiet in der Psychologie. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von positiven Emotionen wie Freude, Zufriedenheit und Glück zu entwickeln und deren Auswirkungen auf kognitive und körperliche Prozesse zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die neurobiologischen Grundlagen und den Ausdruck positiver Emotionen, insbesondere des Lachens.
- Definition und Abgrenzung positiver Emotionen (Freude, Zufriedenheit, Glück)
- Neurobiologische Korrelate positiver Emotionen
- Kognitive und körperliche Effekte positiver Emotionen
- Das Phänomen des Lachens als Ausdruck von Freude
- Der Zusammenhang zwischen positiven Emotionen und dem Streben nach Glück
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Forschungsgebiet der positiven Emotionen ein und hebt die relative Neuheit dieses Forschungszweigs hervor, der im Kontext der Positiven Psychologie entstanden ist. Sie vergleicht die Forschungslage zu positiven und negativen Emotionen, wobei die Schwierigkeit der Untersuchung positiver Emotionen aufgrund ihrer vielfältigen und weniger klar abgrenzbaren Ausdrucksweisen herausgestellt wird. Das Ungleichgewicht in der sprachlichen Repräsentation von positiven und negativen Emotionen wird ebenfalls thematisiert.
2. Definition/Begriffsklärung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe wie Emotion, Gefühl, Freude, Zufriedenheit und Glück. Es wird auf bestehende Klassifikationen von Charakterstärken und Tugenden Bezug genommen und die Schwierigkeiten bei der Definition positiver Emotionen aufgrund widersprüchlicher Ansätze in der Forschung thematisiert. Die Kapitel definiert die verwendeten Begriffe für den weiteren Verlauf des Textes.
3. Das Lachen: Dieses Kapitel analysiert das Lachen als Ausdruck von Freude. Es präsentiert die Forschungsarbeit von Paul Ekman zu den universellen Aspekten der Mimik und unterscheidet zwischen echtem und unechtem Lächeln, wobei das Duchenne-Lächeln als Kennzeichen für authentisches Lächeln hervorgehoben wird. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der Mimikforschung für das Verständnis von Emotionen.
4. Neurobiologische Zusammenhänge und ihre Auswirkungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den neurobiologischen Grundlagen positiver Emotionen. Es wird auf die Rolle von Neurotransmittern wie Dopamin, Endorphine und Enkephaline eingegangen und der Einfluss von Luliberin auf positive Emotionen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der komplexen neuronalen Aktivierung, die mit positiven Emotionen einhergeht, im Gegensatz zu einer lokalisierbaren „Lustzentrum“.
5. Effekte von positiven Emotionen: Dieses Kapitel erörtert die Auswirkungen positiver Emotionen auf kognitive und körperliche Prozesse. Die kognitiven Effekte umfassen Aspekte wie Denken, kreatives Problemlösen, Entscheidungsfindung, soziale Interaktion und Motivation. Die körperlichen Effekte werden ebenfalls angesprochen, wobei jedoch keine konkreten Beispiele genannt werden.
6. Flow-Konzept: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel dem Flow-Konzept gewidmet ist, jedoch ist im bereitgestellten Text kein Inhalt zu diesem Thema vorhanden. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
7. Die Glück(Sinn)suche: Dieses Kapitel untersucht das Streben nach Glück aus alltags- und therapiepraktischen Perspektiven. Es werden unterschiedliche Ansätze zur Erreichung von Glück und Wohlbefinden betrachtet, sowohl im Alltag als auch im therapeutischen Kontext. Die Kapitel bietet unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Glück.
Schlüsselwörter
Positive Emotionen, Freude, Zufriedenheit, Glück, Lachen, Mimik, Neurobiologie, Dopamin, Endorphine, Kognitive Effekte, Körperliche Effekte, Flow-Konzept, Positive Psychologie, Duchenne-Lächeln.
Häufig gestellte Fragen zu: Positive Emotionen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema positive Emotionen. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition der zentralen Begriffe, eine Analyse des Lachens als Ausdruck von Freude, die neurobiologischen Grundlagen positiver Emotionen, deren kognitive und körperliche Effekte, das Flow-Konzept und schließlich die Glückssuche aus alltags- und therapiepraktischen Perspektiven. Zusätzlich bietet sie eine Zusammenfassung, Problemfragen und Schlüsselbegriffe.
Welche positiven Emotionen werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Erforschung von Freude, Zufriedenheit und Glück und deren Auswirkungen. Das Lachen wird als spezifischer Ausdruck von Freude detailliert analysiert.
Welche neurobiologischen Aspekte werden behandelt?
Der Text beleuchtet die Rolle von Neurotransmittern wie Dopamin, Endorphinen und Enkephalinen sowie den Einfluss von Luliberin auf positive Emotionen. Er betont die komplexe neuronale Aktivierung, die mit positiven Emotionen verbunden ist.
Welche kognitiven und körperlichen Effekte positiver Emotionen werden beschrieben?
Kognitive Effekte umfassen Denken, kreatives Problemlösen, Entscheidungsfindung, soziale Interaktion und Motivation. Körperliche Effekte werden erwähnt, jedoch ohne konkrete Beispiele.
Welche Rolle spielt das Lachen in der Arbeit?
Das Lachen wird als Ausdruck von Freude analysiert. Die Arbeit bezieht sich auf die Forschung von Paul Ekman zu universellen Aspekten der Mimik und unterscheidet zwischen echtem und unechtem Lächeln (Duchenne-Lächeln).
Wie wird das Flow-Konzept behandelt?
Obwohl das Flow-Konzept im Inhaltsverzeichnis aufgeführt ist, enthält der bereitgestellte Text keine Informationen dazu. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.
Wie wird die Glückssuche betrachtet?
Die Glückssuche wird aus alltags- und therapiepraktischen Perspektiven beleuchtet. Es werden verschiedene Ansätze zur Erreichung von Glück und Wohlbefinden betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Positive Emotionen, Freude, Zufriedenheit, Glück, Lachen, Mimik, Neurobiologie, Dopamin, Endorphine, Kognitive Effekte, Körperliche Effekte, Flow-Konzept, Positive Psychologie, Duchenne-Lächeln.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis positiver Emotionen zu entwickeln und deren Auswirkungen auf kognitive und körperliche Prozesse zu beleuchten. Sie untersucht die neurobiologischen Grundlagen und den Ausdruck positiver Emotionen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert in Kapitel, beginnend mit einer Einleitung und Definition der Begriffe, gefolgt von der Analyse des Lachens, neurobiologischen Zusammenhängen, den Effekten positiver Emotionen, dem Flow-Konzept, der Glückssuche und abschließend einer Zusammenfassung und Diskussion.
- Citar trabajo
- Katarina Bobkova (Autor), 2004, Emotionspsychologie Manuskript: Positive Emotionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47063