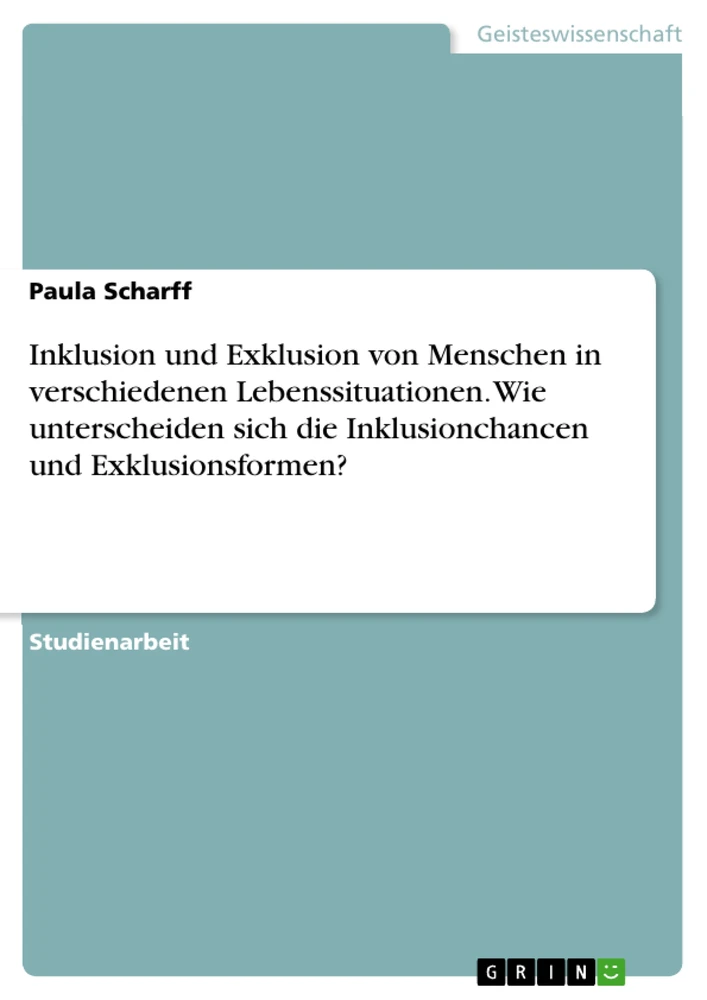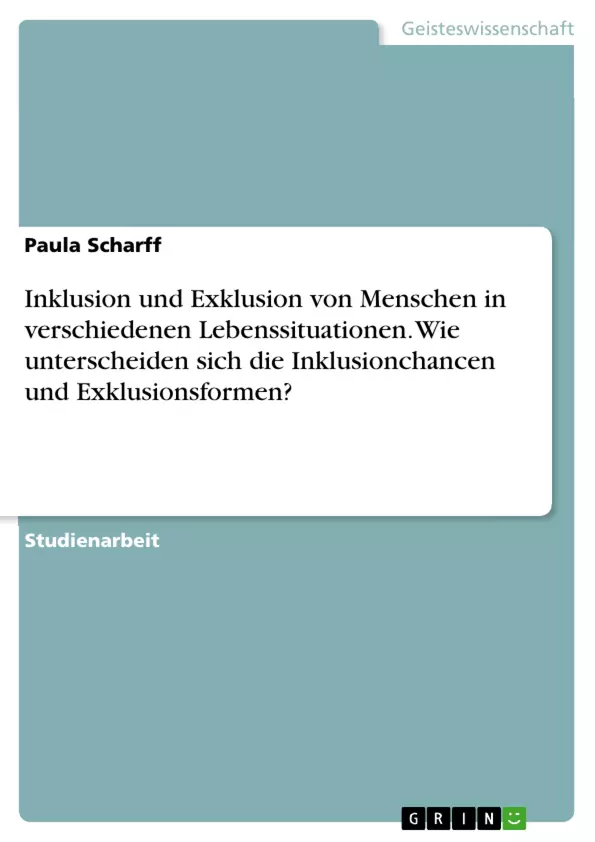Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Begriffe Inklusion und Exklusion genauer zu erklären. Im ersten Abschnitt geht es um die Begriffsbestimmung von Inklusion und Integration, um zu prüfen welche Unterschiede diese Themen aufweisen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den drei Gruppen "Familie", "alte Menschen" und "Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen". Diese werden getrennt voneinander definiert und es werden sowohl Inklusionschancen, als auch Exklusionsformen aufgezeigt. Zum Schluss werden alle drei Gruppen verglichen. Als letztes folgt ein Fazit, welches Handlungsoptionen für die Soziale Arbeit aufzeigt.
Unter Inklusion versteht man die uneingeschränkte und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen. Dabei zielt sie auf Vielfältigkeit ab und möchte diese als Normalität in der Gesellschaft verwirklichen. Exklusion als Gegenstück bezieht sich auf Ausgrenzungserfahrungen, die bestimmten Personen oder auch Personengruppen in ihrem Leben zu spüren bekommen. Dabei haben Exklusionsereignisse immer einen mehrdimensionalen Charakter und können aufeinander aufbauen. Inklusion und Exklusion spielen in der Sozialen Arbeit eine grundlegende Rolle.Das Konzept der Inklusion stellt sich in der heutigen Gesellschaft noch als Herausforderung dar und befindet sich in einem Wandel. Exklusionserfahrungen hingegen müssen aufgezeigt und vorgebeugt werden. Familien, alte Menschen und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zählen zu den Gruppen, welche von beiden Phänomenen betroffen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Begriff Inklusion
- 2.1 Inklusion und Integration – Unterschiede
- 3 Der Begriff Exklusion
- 3.1 Exklusion in Verbindung mit Mehrdimensionalität, Rationalität und Dynamik im Lebenslauf
- 4 Inklusion und Exklusion in verschiedenen Lebenslagen
- 4.1 Familie
- 4.2 Alte Menschen
- 4.3 Menschen mit psychischen/physischen Beeinträchtigungen
- 5 Vergleich
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Begriffe Inklusion und Exklusion und deren Auswirkungen auf Familien, alte Menschen und Menschen mit psychischen/physischen Beeinträchtigungen. Ziel ist es, die beiden Begriffe zu definieren, ihre Unterschiede aufzuzeigen und ihre Relevanz in den genannten Lebenslagen zu analysieren.
- Begriffsbestimmung von Inklusion und Integration
- Analyse von Exklusionserfahrungen und deren mehrdimensionalen Charakter
- Untersuchung von Inklusions- und Exklusionsprozessen in Familien
- Untersuchung von Inklusions- und Exklusionsprozessen bei alten Menschen
- Untersuchung von Inklusions- und Exklusionsprozessen bei Menschen mit psychischen/physischen Beeinträchtigungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Inklusion und Exklusion ein und erläutert die zentrale Fragestellung der Arbeit. Sie benennt Familien, alte Menschen und Menschen mit psychischen/physischen Beeinträchtigungen als betroffene Gruppen und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Begriffsklärung, die Analyse der jeweiligen Lebenslagen und einen abschließenden Vergleich konzentriert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Herausforderungen des Inklusionskonzepts in der heutigen Gesellschaft und der Notwendigkeit, Exklusionserfahrungen aufzuzeigen und zu vermeiden.
2 Der Begriff Inklusion: Dieses Kapitel definiert Inklusion als uneingeschränkte und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, ungeachtet von Geschlecht, physischen oder psychischen Einschränkungen. Es betont den gleichberechtigten Zugang zu Institutionen und die Akzeptanz von Vielfalt als Normalität. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung von gegenseitiger Ergänzung und gleichberechtigter Teilhabe, auch bei unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten. Inklusion wird als ein positives und ergänzendes Konzept dargestellt, das Verschiedenheiten als Bereicherung versteht.
2.1 Inklusion und Integration – Unterschiede: Dieser Abschnitt differenziert zwischen Inklusion und Integration. Während Integration die aktive Einbindung von Menschen mit Einschränkungen in die Gesellschaft beschreibt, fokussiert Inklusion auf die uneingeschränkte Zugehörigkeit und die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen ohne vorherige Anpassung oder Bedingung. Der Abschnitt kritisiert die potenzielle Stigmatisierung und Zwei-Klassen-Gesellschaft, die durch Integration entstehen kann, und hebt die Stärken des Inklusionsansatzes hervor, der auf Akzeptanz von Vielfalt und individuellen Bedürfnissen basiert.
Schlüsselwörter
Inklusion, Exklusion, Integration, Familie, alte Menschen, Menschen mit Behinderungen, psychische Beeinträchtigungen, physische Beeinträchtigungen, soziale Arbeit, Teilhabe, Gleichberechtigung, Vielfalt, gesellschaftliche Teilhabe, Exklusionserfahrungen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Inklusion und Exklusion
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Begriffe Inklusion und Exklusion und deren Auswirkungen auf Familien, alte Menschen und Menschen mit psychischen/physischen Beeinträchtigungen. Sie definiert die Begriffe, zeigt ihre Unterschiede auf und analysiert ihre Relevanz in den genannten Lebenslagen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Begriffsbestimmung von Inklusion und Integration, Analyse von Exklusionserfahrungen und deren mehrdimensionalen Charakter, Untersuchung von Inklusions- und Exklusionsprozessen in Familien, bei alten Menschen und bei Menschen mit psychischen/physischen Beeinträchtigungen.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Inklusion (mit Unterkapitel zu Inklusion und Integration), Exklusion, Inklusion und Exklusion in verschiedenen Lebenslagen (Familie, alte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen), einen Vergleich und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Begriffe und ihre Relevanz in den verschiedenen Lebenslagen.
Was versteht die Hausarbeit unter Inklusion?
Inklusion wird definiert als uneingeschränkte und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, ungeachtet von Geschlecht, physischen oder psychischen Einschränkungen. Es wird der gleichberechtigte Zugang zu Institutionen und die Akzeptanz von Vielfalt als Normalität betont.
Wie unterscheidet die Hausarbeit zwischen Inklusion und Integration?
Die Hausarbeit unterscheidet zwischen Inklusion als uneingeschränkte Zugehörigkeit und Teilhabe ohne vorherige Anpassung und Integration als aktive Einbindung von Menschen mit Einschränkungen. Integration wird kritisch betrachtet, da sie potenziell zu Stigmatisierung führen kann.
Welche Lebenslagen werden im Hinblick auf Inklusion und Exklusion untersucht?
Die Hausarbeit untersucht die Auswirkungen von Inklusion und Exklusion auf Familien, alte Menschen und Menschen mit psychischen/physischen Beeinträchtigungen.
Welche Schlüsselwörter sind für die Hausarbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Inklusion, Exklusion, Integration, Familie, alte Menschen, Menschen mit Behinderungen, psychische Beeinträchtigungen, physische Beeinträchtigungen, soziale Arbeit, Teilhabe, Gleichberechtigung, Vielfalt, gesellschaftliche Teilhabe, Exklusionserfahrungen.
Welches ist das zentrale Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist es, die Begriffe Inklusion und Exklusion zu definieren, ihre Unterschiede aufzuzeigen und ihre Relevanz in den betrachteten Lebenslagen zu analysieren. Ein weiterer Fokus liegt auf der Darstellung der Herausforderungen des Inklusionskonzepts und der Notwendigkeit, Exklusionserfahrungen aufzuzeigen und zu vermeiden.
- Arbeit zitieren
- Paula Scharff (Autor:in), 2019, Inklusion und Exklusion von Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Wie unterscheiden sich die Inklusionchancen und Exklusionsformen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468475