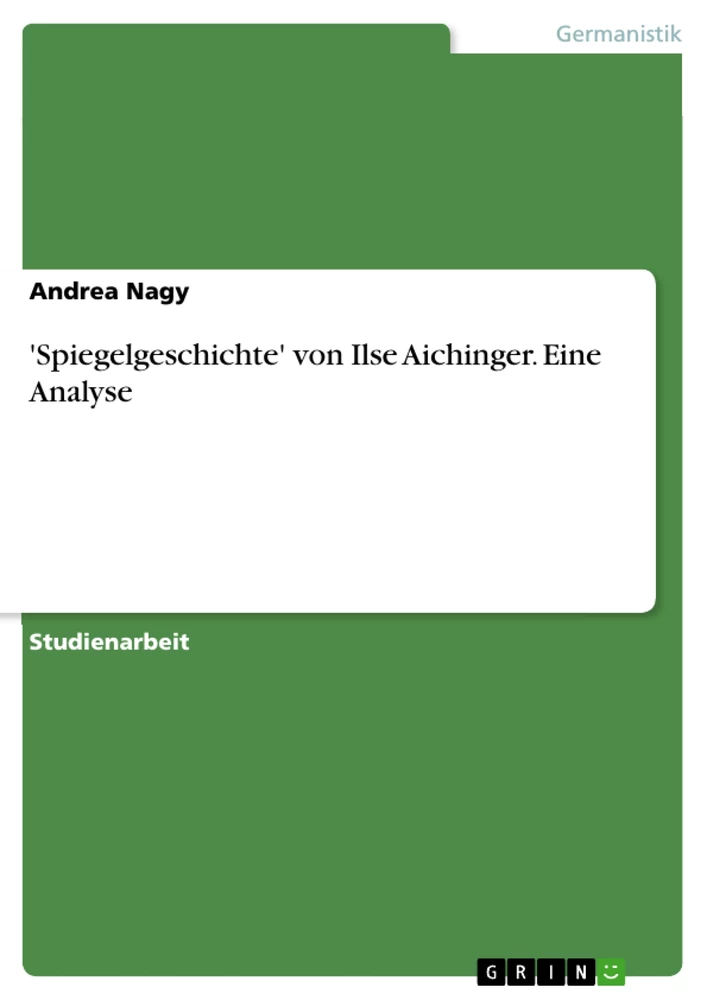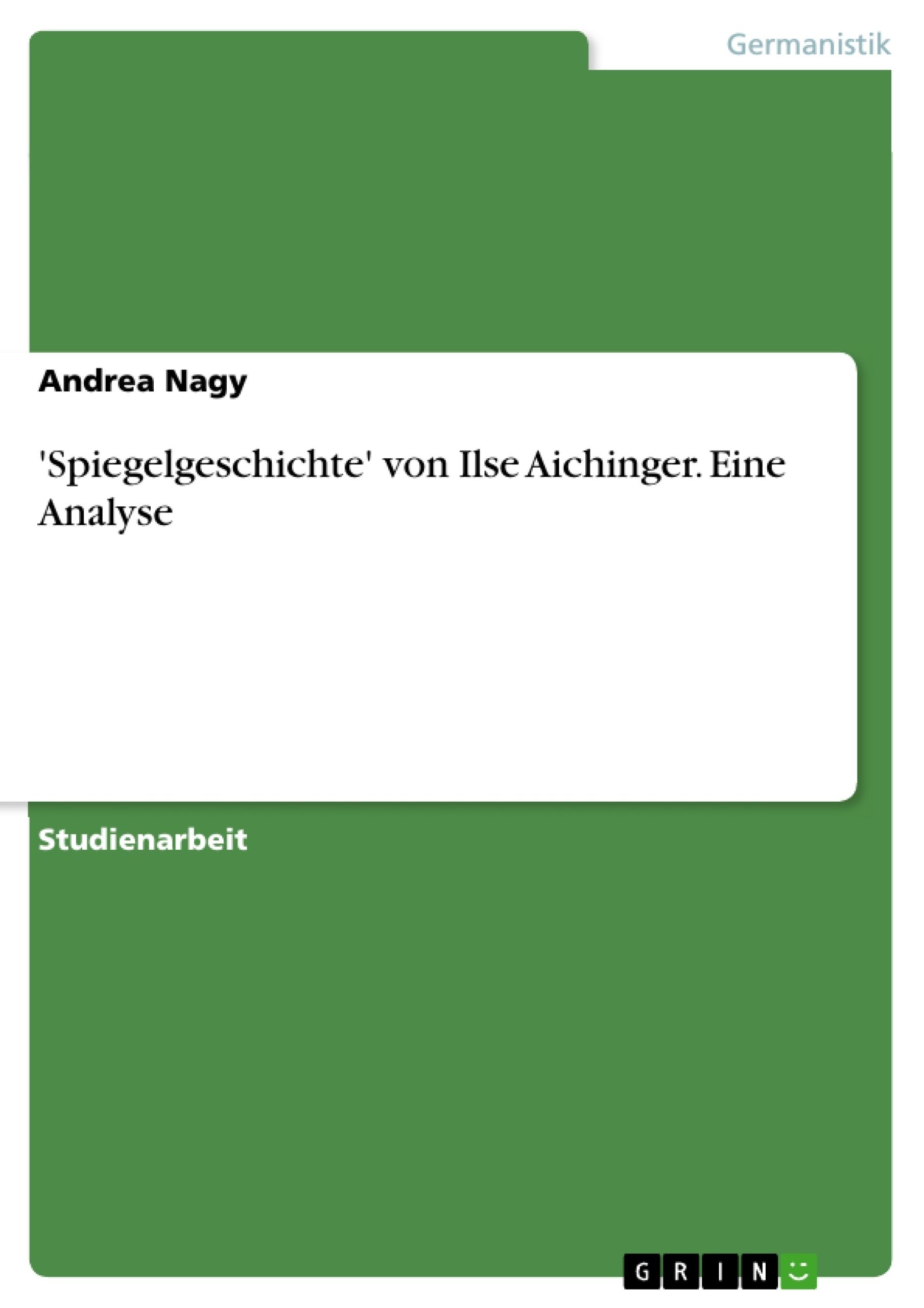Zunächst beginne ich mit einer klassischen Textanalyse, in der Erzählverhalten und Erzählhaltung untersucht werden sollen. Dabei möchte ich auf die besondere Sprechsituation eingehen, welche die „Spiegelgeschichte“ zur ungewöhnlichen und einzigartigen Erzählkunst macht. Um die Sprechsituation erschließen zu können, muss die Erzählung über die Textanalyse hinaus, in einen spezifischen literaturhistorischen Kontext gesetzt werden.
Ich möchte untersuchen, inwiefern Aichingers neue Erzählkunst, die den Kahlschlag ablöst, als kafkaesk bezeichnet werden kann und einem Muster folgt, das charakteristisch ist für die österreichische Sprachskepsistradition. Zur Annäherung an Aichingers transitorischen Ort des Poetischen möchte ich außerdem detailliert auf die Symbolik in „Spiegelgeschichte“ eingehen. Eine zentrale Bedeutung fällt dem Motiv des Spiegels zu, der nicht nur die biologische Ordnung auf den Kopf stellt, sondern auch die sprachliche. Es soll deutlich werden, dass der Spiegel als Schlüssel zur Eröffnung einer poetologischen Dimension dient. Neben dem Spiegel gibt es noch weitere wichtige Motive, deren Funktion ich ebenfalls erörtern möchte.
Mein weiterführendes Ziel ist es, die wichtigsten Voraussetzungen zu benennen, welche für Aichingers Dichtung gelten. Damit klärt sich die Frage, weshalb ein Großteil der intellektuellen Bevölkerung der westlichen Hemisphäre und der Literaturkritiker, ihr skeptisch gegenüberstehen und ihre Texte dennoch zum festen Bestandteil der heutigen Schullektüre gehören.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spiegelgeschichte
- Eine Lebensgeschichte im Spiegel
- Der Du-Erzähler
- Erzählverhalten und Erzählhaltung
- Symbolik
- Der Spiegel
- Der Spiegel - Die Infragestellung von Autorschaft
- Kindtopos
- Die Weiblichkeit
- Das Meer
- Der Spiegel
- Zeitlichkeit und Glück - Zukunftsverhältnis
- Schreiben zur Stunde Null
- Sprache als Anarchie
- Fremdwörter
- Der Schriftsteller und die Wirklichkeit
- Das Schreiben, „vom Ende her“
- Hinwendung zur Kurzprosa
- Die absurde Prosa
- Das Kafkaeske
- Die Überwindung des klassischen Weltbildes
- Der Glaube an die Gleichheit
- Die negative Schöpfungstheorie
- Wiener Empiriokritizismus
- „Das Ich ist unrettbar“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Analyse von Ilse Aichingers „Spiegelgeschichte“ und versucht, die Überwindungsstrategie des Schriftstellers in einer verlorenen Wirklichkeit aufzuzeigen. Die Arbeit fokussiert auf die besondere Sprechsituation in der Erzählung, die durch den in Du-Anrede geführten inneren Dialog geprägt ist. Neben einer klassischen Textanalyse, die Erzählverhalten und Erzählhaltung untersucht, wird die Erzählung in einen literaturhistorischen Kontext gestellt, um die kafkaesken Elemente und die österreichische Sprachskepsistradition zu beleuchten. Die Analyse der Symbolik, insbesondere des Motivs des Spiegels, soll die poetologische Dimension der Erzählung erhellen.
- Die Überwindungsstrategie des Schriftstellers in einer verlorenen Wirklichkeit
- Die besondere Sprechsituation und der in Du-Anrede geführte innere Dialog
- Die literaturhistorischen Kontextualisierung der Erzählung mit Bezug auf Kafka und die österreichische Sprachskepsistradition
- Die Analyse der Symbolik, insbesondere des Motivs des Spiegels, und deren poetologische Dimension
- Die wichtigsten Voraussetzungen für Aichingers Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die „Spiegelgeschichte“ als ein Muster einer neuen Erzählkunst dar, die den Kahlschlag der Nachkriegszeit ablöst. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie der Schriftsteller eine Überwindungsstrategie für die Wirklichkeit finden kann, wenn die wirkliche Wirklichkeit verloren ist.
Das Kapitel „Spiegelgeschichte“ beleuchtet die Lebensgeschichte der Protagonistin, die im Sterben ihr Leben im Spiegel wieder erlebt. Die konsequente Verwendung der Du-Anrede zieht den Leser in ihren Bann und erzeugt eine Spannung zwischen dem Erzähler und dem Adressaten.
Der Abschnitt „Der Du-Erzähler“ analysiert den inneren Dialog in der Erzählung und zeigt die Funktion des Erzählers als sprechendes Ich auf, das sich zum Rücklauf selbst antreibt.
Das Kapitel „Symbolik“ behandelt das Motiv des Spiegels, das die biologische und sprachliche Ordnung infrage stellt. Der Spiegel dient als Schlüssel zur Eröffnung einer poetologischen Dimension.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Ilse Aichinger, Spiegelgeschichte, Du-Erzähler, Symbolik, Spiegel, Sprachskepsis, Kafkaeske, Überwindungsstrategie, Nachkriegsliteratur, österreichische Literatur.
- Quote paper
- Andrea Nagy (Author), 2004, 'Spiegelgeschichte' von Ilse Aichinger. Eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46674