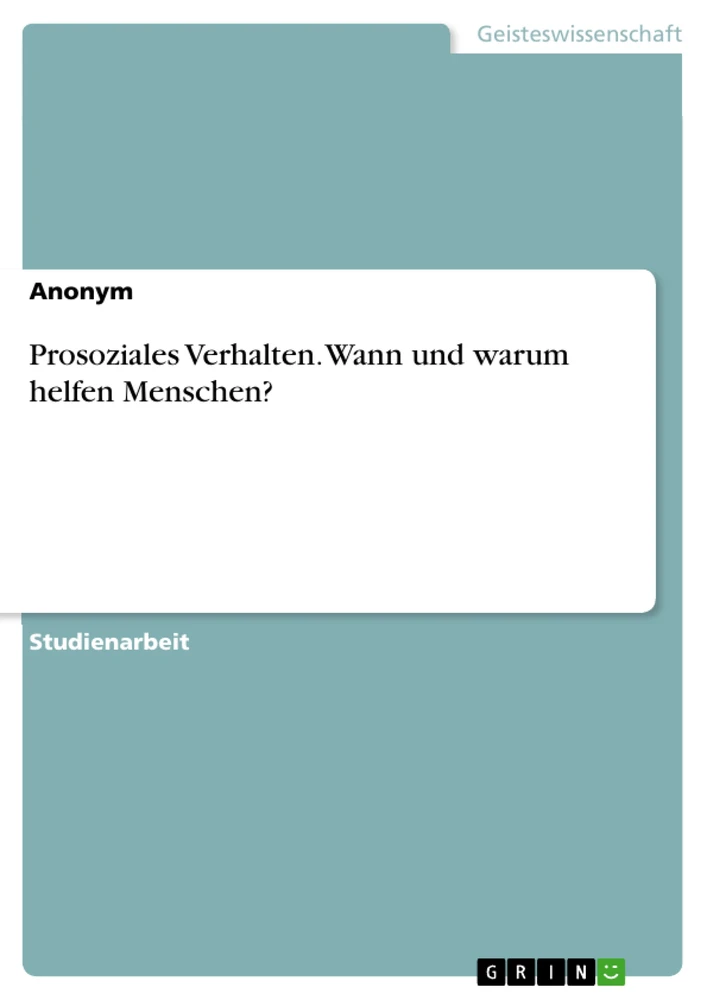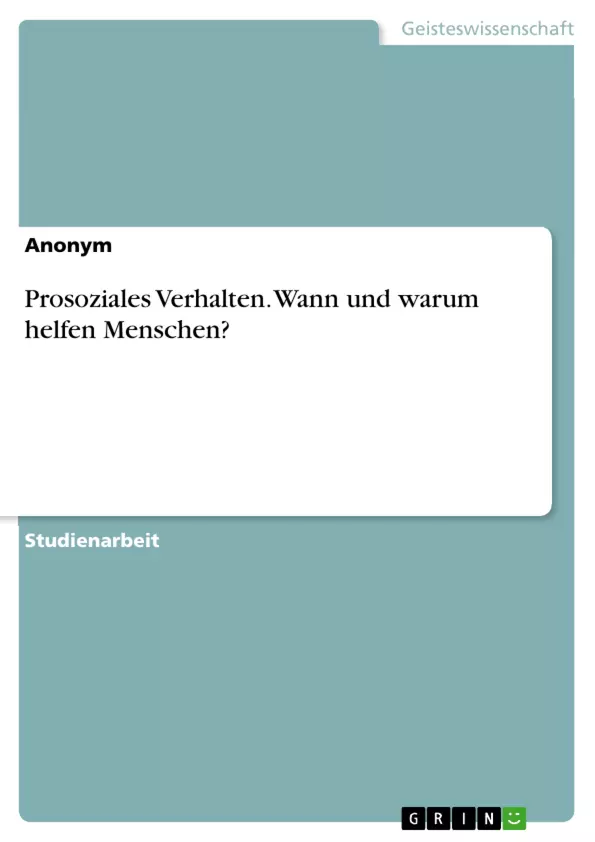Diese Hausarbeit grenzt zunächst die Begriffe Empathie, prosoziales Verhalten und Altruismus erklärt und voneinander ab, um eine Basis für die Beantwortung der Fragestellung, wann und warum Menschen helfen, zu finden. Danach werden verschiedene Ansätze des Entstehens von prosozialem Verhalten thematisiert sowie das Hilfeverhalten und der Prozess vom Wahrnehmen einer Situation bis hin zu einer konkreten Aktion untersucht. Dieser Prozess ist dabei immer abhängig von verschiedensten Einflüssen. Im letzten Teil der Hausarbeit werden Untersuchungen und Tests über spezielle fördernde und hemmende Einflüsse für prosoziales Verhalten betrachtet.
Die 28-jährige Amerikanerin Kitty Genovese wurde im März 1964 in Queens, New York, grausam auf dem Hof ihres Wohnblocks von einem jungen Mann misshandelt und schließlich von ihm getötet. Das Unglaubliche daran ist, dass 37 Zeugen anwesend in diesem Heim waren, die ihre Hilferufe und Schreie gehört haben. Keiner von ihnen kam ihr zu Hilfe oder rief die Polizei. Warum tätigte niemand in dieser halben Stunde voller Schmerzensschreie des Opfers einen Anruf bei der Polizei, der den Mord verhindern hätte können? Viele Theorien wurden aufgestellt und Experimente durchgeführt, um Erklärungsansätze für das passive Verhalten der Beobachter zu finden. Dieses gesellschaftliche Phänomen wird als Bystander-Effekt verstanden und ist nun nach Miss Genovese benannt worden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in das Thema
- 2. Begriffserklärung
- 2.1. Empathie
- 2.2. Prosoziales Verhalten
- 2.3. Altruismus
- 3. Entwicklung des prosozialen Verhaltens
- 3.1. Biologischer Ansatz
- 3.1.1. Spiegelneurone als Grundlage für Empathie
- 3.1.2. Evolutionspsychologische Erklärung
- 3.2. Lerntheoretischer Ansatz
- 4. Die Hilfeleistung
- 4.1. Der Hilfeprozess nach Shalom H. Schwartz
- 4.2. Hilfestrategien
- 5. Situative Einflüsse auf das prosoziale Verhalten
- 5.1. Ausgewählte fördernde Faktoren
- 5.1.1. Beziehung zwischen Helfer und Betroffenem
- 5.1.2. Stimmung
- 5.1.3. Männer- und Frauenrolle
- 5.1.4. Vorteile prosozialen Verhaltens
- 5.2. Ausgewählte hemmende Faktoren
- 5.2.1. Zeitdruck
- 5.2.2. Bystander-Effekt
- 5.2.3. Lokalität der Notsituation
- 5.2.4. Risiken und Kosten prosozialen Verhaltens
- 6. Wie kann prosoziales Verhalten gefördert werden?
- 7. Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen und Bedingungen prosozialen Verhaltens. Ziel ist es, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wann und warum Menschen helfen – oder eben nicht helfen. Die Arbeit beleuchtet sowohl fördernde als auch hemmende Faktoren und betrachtet verschiedene theoretische Ansätze.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Empathie, prosoziales Verhalten und Altruismus
- Biologische und lerntheoretische Ansätze zur Entwicklung prosozialen Verhaltens
- Der Prozess der Hilfeleistung und seine Einflussfaktoren
- Fördernde und hemmende situative Faktoren auf prosoziales Verhalten
- Ansätze zur Förderung prosozialen Verhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in das Thema: Die Einleitung nutzt das Zitat Albert Einsteins als Ausgangspunkt, um die Bedeutung von Empathie und Hilfsbereitschaft hervorzuheben. Der Mordfall Kitty Genovese dient als schockierendes Beispiel für den Bystander-Effekt und motiviert die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema prosoziales Verhalten. Die Arbeit skizziert den weiteren Aufbau und die Forschungsfragen.
2. Begriffserklärung: Dieses Kapitel definiert und differenziert die zentralen Begriffe Empathie, prosoziales Verhalten und Altruismus. Empathie wird als die Fähigkeit beschrieben, sich in andere hineinzuversetzen und emotional Anteil zu nehmen. Prosoziales Verhalten wird als willentliches, nutzenbringendes Handeln für andere definiert, während Altruismus als selbstloses Handeln charakterisiert wird. Die Kapitel verdeutlicht die Beziehungen und Unterscheidungen zwischen diesen Konzepten.
3. Entwicklung des prosozialen Verhaltens: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung von prosozialem Verhalten aus biologischer und lerntheoretischer Perspektive. Der biologische Ansatz fokussiert auf Spiegelneurone und evolutionspsychologische Erklärungen für Empathie und Hilfsbereitschaft. Der lerntheoretische Ansatz beleuchtet den Einfluss von Lernen und Sozialisation auf die Entwicklung prosozialen Verhaltens.
4. Die Hilfeleistung: Hier wird der Prozess der Hilfeleistung, insbesondere das Modell von Shalom H. Schwartz, detailliert beschrieben. Es werden verschiedene Hilfestrategien und deren Anwendung in unterschiedlichen Situationen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Analyse des Ablaufs von der Wahrnehmung einer Notsituation bis zur konkreten Handlung.
5. Situative Einflüsse auf das prosoziale Verhalten: Dieses Kapitel analysiert detailliert die situativen Faktoren, die prosoziales Verhalten fördern oder hemmen können. Es werden verschiedene Faktoren wie die Beziehung zwischen Helfer und Betroffenem, die Stimmung des Helfers, geschlechtsspezifische Rollen und die Kosten-Nutzen-Abwägung eingehend untersucht. Der Bystander-Effekt wird als ein besonders stark hemmender Faktor im Detail beleuchtet.
6. Wie kann prosoziales Verhalten gefördert werden?: Dieser Abschnitt (basierend auf dem gegebenen Text, der keinen konkreten Inhalt dieses Kapitels enthält) würde im vollständigen Dokument voraussichtlich Strategien und Maßnahmen zur Förderung von prosozialem Verhalten erörtern. Dies könnte den Einsatz von Interventionsprogrammen, pädagogischen Maßnahmen oder gesellschaftlichen Initiativen beinhalten.
Schlüsselwörter
Empathie, prosoziales Verhalten, Altruismus, Hilfeleistung, Bystander-Effekt, Hilfeprozess, Spiegelneurone, Evolutionspsychologie, Lerntheorie, situative Einflüsse, fördernde Faktoren, hemmende Faktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Prosoziales Verhalten
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen und Bedingungen prosozialen Verhaltens. Sie beleuchtet die Definition und Abgrenzung der Begriffe Empathie, prosoziales Verhalten und Altruismus, betrachtet biologische und lerntheoretische Ansätze zur Entwicklung prosozialen Verhaltens, analysiert den Prozess der Hilfeleistung und seine Einflussfaktoren, sowie fördernde und hemmende situative Faktoren. Zusätzlich werden Ansätze zur Förderung prosozialen Verhaltens diskutiert.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert und differenziert die zentralen Begriffe Empathie (die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen), prosoziales Verhalten (willentliches, nutzenbringendes Handeln für andere) und Altruismus (selbstloses Handeln). Die Beziehungen und Unterscheidungen zwischen diesen Konzepten werden verdeutlicht.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Erklärung prosozialen Verhaltens herangezogen?
Die Arbeit betrachtet sowohl biologische als auch lerntheoretische Ansätze. Der biologische Ansatz fokussiert auf Spiegelneurone und evolutionspsychologische Erklärungen. Der lerntheoretische Ansatz beleuchtet den Einfluss von Lernen und Sozialisation.
Wie wird der Prozess der Hilfeleistung beschrieben?
Der Hilfeprozess wird detailliert beschrieben, insbesondere anhand des Modells von Shalom H. Schwartz. Verschiedene Hilfestrategien und deren Anwendung in unterschiedlichen Situationen werden beleuchtet, vom Wahrnehmen einer Notsituation bis zur konkreten Handlung.
Welche situativen Faktoren beeinflussen prosoziales Verhalten?
Die Arbeit analysiert detailliert situative Faktoren, die prosoziales Verhalten fördern (z.B. Beziehung zwischen Helfer und Betroffenem, Stimmung, Vorteile prosozialen Verhaltens) oder hemmen (z.B. Zeitdruck, Bystander-Effekt, Risiken und Kosten prosozialen Verhaltens). Der Bystander-Effekt wird besonders ausführlich behandelt.
Wie kann prosoziales Verhalten gefördert werden?
Dieser Abschnitt würde im vollständigen Dokument Strategien und Maßnahmen zur Förderung von prosozialem Verhalten erörtern, z.B. den Einsatz von Interventionsprogrammen, pädagogischen Maßnahmen oder gesellschaftlichen Initiativen. Der gelieferte Auszug enthält jedoch keine konkreten Inhalte dazu.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Empathie, prosoziales Verhalten, Altruismus, Hilfeleistung, Bystander-Effekt, Hilfeprozess, Spiegelneurone, Evolutionspsychologie, Lerntheorie, situative Einflüsse, fördernde Faktoren, hemmende Faktoren.
Welche Beispiele werden in der Einleitung verwendet?
Die Einleitung verwendet das Zitat Albert Einsteins, um die Bedeutung von Empathie und Hilfsbereitschaft hervorzuheben. Der Mordfall Kitty Genovese dient als Beispiel für den Bystander-Effekt.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2015, Prosoziales Verhalten. Wann und warum helfen Menschen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465725