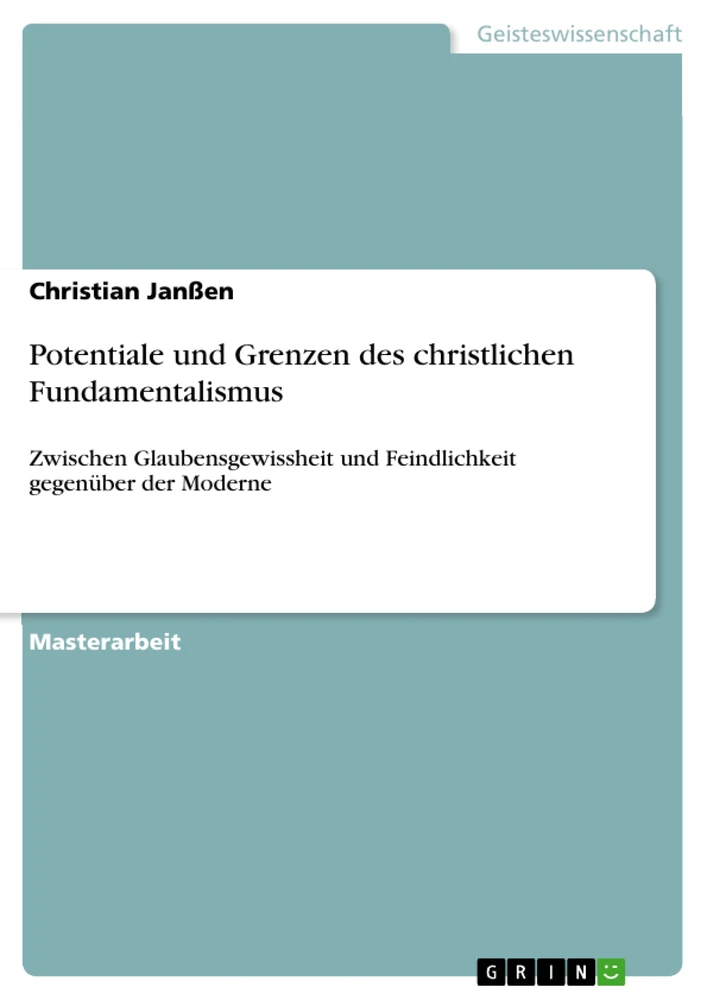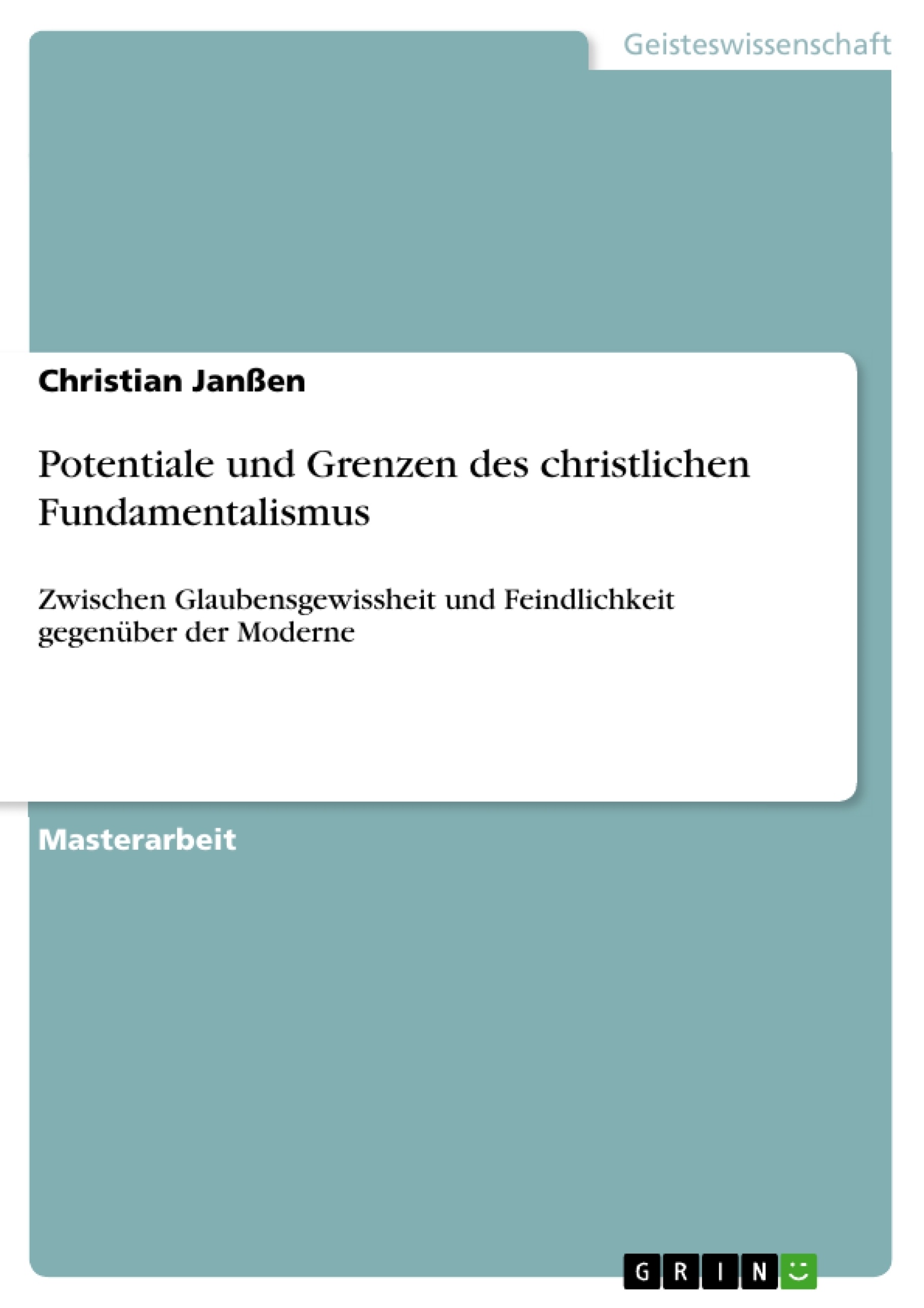Diese Arbeit beschäftigt sich speziell mit dem christlichen Fundamentalismus und will ihn nicht von vornherein verurteilen sondern ihn ernst nehmen und ihm im Dialog entgegentreten. Daher wird sich im Folgenden unter Berücksichtigung der offenkundigen Grenzen mit den Potentialen christlichen Fundamentalismus und damit, was man von ihm lernen kann, beschäftigt. Das größte Potential des christlichen Fundamentalismus sehe ich darin, eine Gewissheit im eigenen Glauben zu haben, die sich als unerschütterlich erweist.
Das Thema christlicher Fundamentalismus ist aktueller denn je. Nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 rief Expräsident George Bush gewissermaßen als Vorsänger vieler evangelikaler Christen in den USA zum heiligen Krieg gegen den Terror auf. Einer der derzeitigen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump, plädiert für ein Einreiseverbot für Muslime in die USA, auch um Stimmen aus dem evangelikalen Lager zu
gewinnen. Nach von Stosch ist in allen Konfessionen des Christentums eine stärker werdende Zuwendung zu fundamentalistischen Positionen zu beobachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken und Struktur der Arbeit
- Begriffsannäherung: Christlicher Fundamentalismus
- Fundamentalismus allgemein
- Christlicher Fundamentalismus
- Ursprung und Verbreitung des christlichen Fundamentalismus
- Christlicher Fundamentalismus in den USA
- Christlicher Fundamentalismus in Westeuropa, mit Augenmerk auf Deutschland
- Unterschiedliche Spielarten des christlichen Fundamentalismus
- Grundlagen der Sprachphilosophie nach Wittgenstein
- Was ist ein Sprachspiel und was machen Sprachspiele aus?
- Unterschiedliche Arten von Sätzen in Sprachspielen
- Kognitiv-propositional bzw. enzyklopädische Sätze
- Grammatische bzw. regulative Sätze
- Das Weltbild und seine Dynamik
- Weltbildinterne und -externe Begründungsfiguren
- Verortung religiöser Überzeugungen - Eine erste Vorbemerkung
- Das Gewissheitsmodell nach Heim
- Glaubensgewissheit im einlinigen Gewissheitsmodell
- Glaubensgewissheit im zweilinigen Gewissheitsmodell
- Glaubensgewissheit im Einlinigen Gewissheitsmodell
- Reformed Epistemology - Gewährter Glaube
- Kritik an der natürlichen Theologie
- Glaube an Gott als angemessene Weise basal
- Einwände (Defeaters) und die Widerlegung der Einwände (Defeaters)
- Gewährleisteter Glaube (warranted belief)
- Parallelen und Einschränkungen durch die Spätphilosophie Wittgensteins
- Ein interessanter Ansatz: Mit Wittgenstein glauben, mit Tillich zweifeln
- Reformed Epistemology - Gewährter Glaube
- Konkretisierung der vorher gewonnenen Ergebnisse
- Das Gebet – Ein Beispiel für einen internen Zweifel
- Ein Beispiel eines konkreten religiösen Glaubenssatzes
- Resümee
- Reflexion des eigenen Vorgehensweise
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Potentiale und Grenzen christlichen Fundamentalismus. Ziel ist es, den christlichen Fundamentalismus nicht verurteilend, sondern im Dialog zu betrachten und seine Potentiale zu ergründen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Glaubensgewissheit als zentrales Merkmal. Die Arbeit fragt nach der Rechtfertigung dieser Gewissheit im Kontext der Moderne und sucht nach Möglichkeiten, diese im Dialog mit der Spätphilosophie Ludwig Wittgensteins zu verstehen.
- Analyse des christlichen Fundamentalismus: Merkmale, Ursprung und Verbreitung
- Anwendung der Sprachphilosophie Wittgensteins auf religiöse Überzeugungen
- Untersuchung des Konzepts der Glaubensgewissheit
- Relevanz des Gewissheitsmodells nach Heim
- Konkretisierung der Ergebnisse anhand von Beispielen (Gebet).
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Gedanken und Struktur der Arbeit: Die Arbeit untersucht den christlichen Fundamentalismus, insbesondere die daraus resultierende Glaubensgewissheit, vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse und gesellschaftlicher Herausforderungen. Sie geht von der Annahme aus, dass diese Gewissheit positive Auswirkungen auf das Leben Betroffener haben kann, und sucht nach einer philosophischen Fundierung dieser Gewissheit im Dialog mit der Spätphilosophie Wittgensteins. Die Arbeit wird strukturiert durch die schrittweise Annäherung an die Thematik: von der Begriffsklärung über die philosophischen Grundlagen bis hin zur konkreten Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse.
Begriffsannäherung: Christlicher Fundamentalismus: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des christlichen Fundamentalismus, seiner historischen Entwicklung, Verbreitung und unterschiedlichen Ausprägungen. Es werden verschiedene Strömungen und ihre jeweiligen Charakteristika beleuchtet. Der Fokus liegt darauf, ein differenziertes Bild des Phänomens zu zeichnen, das über vereinfachte Stereotypen hinausgeht und die Komplexität des christlichen Fundamentalismus aufzeigt. Die verschiedenen Strömungen werden differenziert beschrieben, um den Lesern ein umfassendes Verständnis zu vermitteln. Die historische Entwicklung wird nachgezeichnet, um die Entstehung und Verbreitung der verschiedenen Strömungen des christlichen Fundamentalismus nachzuvollziehen.
Grundlagen der Sprachphilosophie nach Wittgenstein: Dieses Kapitel stellt die relevanten Konzepte der Spätphilosophie Ludwig Wittgensteins vor, insbesondere den Begriff des Sprachspiels und die Unterscheidung verschiedener Satzarten (kognitiv-propositionale und grammatische Sätze). Es wird erläutert, wie Wittgensteins Philosophie ein Verständnis religiöser Überzeugungen ermöglichen kann. Der Begriff des Weltbildes und dessen Dynamik wird im Kontext der Sprachspiel-Philosophie erläutert, um eine Basis für die spätere Analyse der Glaubensgewissheit zu schaffen. Die Bedeutung der Weltbildinternen und -externen Begründungsfiguren wird im Kontext des Sprachspiels dargestellt.
Das Gewissheitsmodell nach Heim: Dieses Kapitel beschreibt das Gewissheitsmodell von Heim, das ein ein- und ein zweilinienmodell unterscheidet. Im einlinigen Modell ist die Glaubensgewissheit ohne Zweifel, während im zweilinigen Modell der Zweifel eine wichtige Rolle spielt. Die Unterscheidung dieser beiden Modelle bildet die Grundlage für die anschließende Analyse der Glaubensgewissheit im Kontext des christlichen Fundamentalismus. Es wird erläutert, wie beide Modelle die Glaubensgewissheit unterschiedlich konzeptualisieren und welche Auswirkungen diese unterschiedlichen Konzeptualisierungen auf das Verständnis des Glaubens haben.
Glaubensgewissheit im Einlinigen Gewissheitsmodell: Dieses Kapitel analysiert die Glaubensgewissheit im einlinigen Gewissheitsmodell, insbesondere im Kontext der Reformed Epistemology. Die Arbeit beleuchtet Plantings Ansatz, der religiöse Erfahrungen als epistemisch basale Erfahrungen betrachtet, die jedem Zweifel enthoben sind. Der Vergleich mit Wittgensteins Sprachspiel-Philosophie und die Integration des Ansatzes von Andrejč, der die regulative Kraft religiöser Überzeugungen mit dem dynamischen Glauben nach Tillich verbindet, werden ausführlich diskutiert. Die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze werden kritisch hinterfragt.
Konkretisierung der vorher gewonnenen Ergebnisse: Dieses Kapitel wendet die zuvor gewonnenen Erkenntnisse auf konkrete Beispiele an, nämlich das Gebet und einen konkreten Glaubenssatz. Es wird gezeigt, wie die Sprachspiel-Philosophie und die unterschiedlichen Gewissheitsmodelle zur Analyse dieser Beispiele herangezogen werden können. Durch die Anwendung wird die theoretische Diskussion praxisrelevant und verständlicher gemacht. Es wird aufgezeigt, wie die vorherigen Kapitel in der Praxis angewendet werden können.
Schlüsselwörter
Christlicher Fundamentalismus, Glaubensgewissheit, Sprachspiel, Wittgenstein, Reformed Epistemology, Gewissheitsmodell (Heim), Glauben, Zweifel, Religion, Moderne, Weltbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Christlicher Fundamentalismus und Glaubensgewissheit im Kontext der Spätphilosophie Wittgensteins
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den christlichen Fundamentalismus und die damit verbundene Glaubensgewissheit. Sie analysiert die Potentiale und Grenzen des christlichen Fundamentalismus im Dialog, nicht im Sinne einer Verurteilung, sondern mit dem Ziel, seine positiven Aspekte zu ergründen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rechtfertigung der Glaubensgewissheit im Kontext der Moderne und deren Verständnis im Dialog mit der Spätphilosophie Ludwig Wittgensteins.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Analyse des christlichen Fundamentalismus (Merkmale, Ursprung, Verbreitung), Anwendung der Sprachphilosophie Wittgensteins auf religiöse Überzeugungen, Untersuchung des Konzepts der Glaubensgewissheit, Relevanz des Gewissheitsmodells nach Heim, und die Konkretisierung der Ergebnisse anhand von Beispielen (z.B. Gebet).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einleitenden Gedanken und einer Beschreibung der Struktur. Es folgt eine Begriffsannäherung zum christlichen Fundamentalismus, eine Darstellung der Grundlagen der Sprachphilosophie Wittgensteins, die Erläuterung des Gewissheitsmodells nach Heim, eine Analyse der Glaubensgewissheit im einlinigen Gewissheitsmodell (inkl. Reformed Epistemology), eine Konkretisierung der Ergebnisse anhand von Beispielen (Gebet), ein Resümee, eine Reflexion des Vorgehens und ein Ausblick.
Welche Konzepte der Spätphilosophie Wittgensteins werden verwendet?
Die Arbeit verwendet zentrale Konzepte der Spätphilosophie Wittgensteins, insbesondere den Begriff des „Sprachspiels“ und die Unterscheidung verschiedener Satzarten (kognitiv-propositionale und grammatische Sätze). Der Begriff des „Weltbildes“ und dessen Dynamik sowie die Unterscheidung zwischen weltbildinternen und -externen Begründungsfiguren spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Rolle spielt das Gewissheitsmodell nach Heim?
Die Arbeit beschreibt Heims Gewissheitsmodell mit seinen ein- und zweilinigen Modellen. Die Unterscheidung dieser Modelle bildet die Grundlage für die Analyse der Glaubensgewissheit im Kontext des christlichen Fundamentalismus. Es wird untersucht, wie beide Modelle die Glaubensgewissheit unterschiedlich konzeptualisieren und welche Auswirkungen diese Unterschiede haben.
Wie wird die Reformed Epistemology behandelt?
Die Arbeit analysiert die Glaubensgewissheit im einlinigen Gewissheitsmodell, insbesondere im Kontext der Reformed Epistemology. Plantings Ansatz, der religiöse Erfahrungen als epistemisch basale Erfahrungen betrachtet, wird beleuchtet. Ein Vergleich mit Wittgensteins Sprachspiel-Philosophie und die Integration des Ansatzes von Andrejč (der die regulative Kraft religiöser Überzeugungen mit dem dynamischen Glauben nach Tillich verbindet) werden diskutiert.
Welche konkreten Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit wendet die gewonnenen Erkenntnisse auf konkrete Beispiele an, nämlich das Gebet und einen konkreten Glaubenssatz. Dies dient dazu, die theoretische Diskussion praxisrelevant zu machen und die Anwendung der theoretischen Konzepte zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Christlicher Fundamentalismus, Glaubensgewissheit, Sprachspiel, Wittgenstein, Reformed Epistemology, Gewissheitsmodell (Heim), Glauben, Zweifel, Religion, Moderne, Weltbild.
- Quote paper
- Christian Janßen (Author), 2016, Potentiale und Grenzen des christlichen Fundamentalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465593