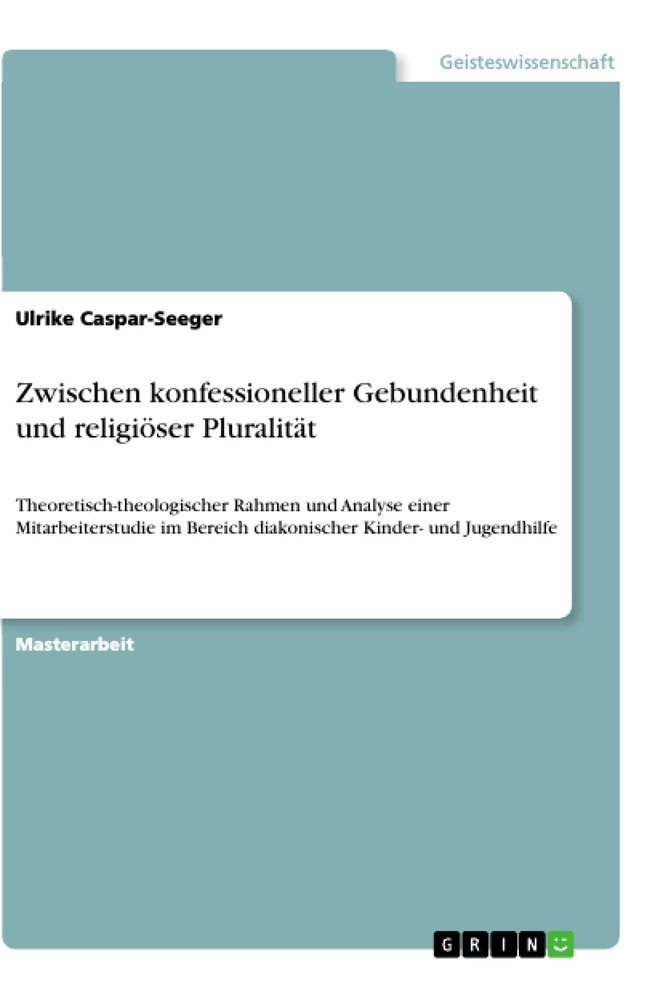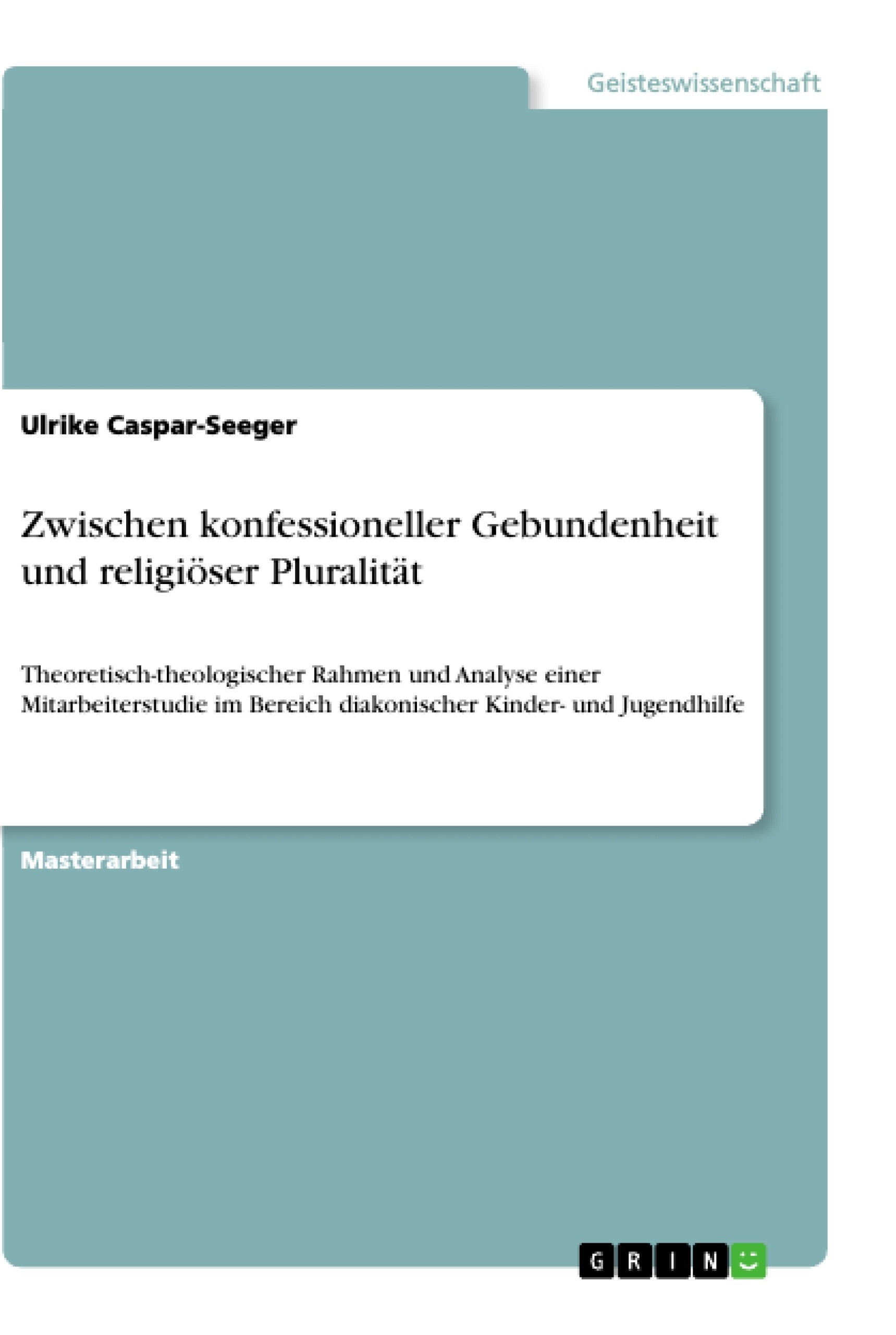Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Mitarbeiterstudie und versucht, folgende Forschungsfrage zu beantworten: "Wie ist die subjektive Bedeutung und individuelle Struktur von Religiosität der Mitarbeitenden einer diakonischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung und welche Vorstellungen über den Umgang mit religiöser Pluralität und einer möglichen interreligiösen Öffnung der Diakonie gibt es?" Theoretisch werden die Forschungsergebnisse mit den Arbeiten der Theologin Manuela Kalsky verbunden. In ihren Publikationen drängt sie auf die Notwendigkeit eines neuen Wir-Bewusstseins, welches in Anerkennung der religiösen und nicht-religiösen Vielfalt in der Gesellschaft ein gutes Leben für alle ermöglicht.
Diakonische Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen: Die Kirchenzugehörigkeit ihrer Mitarbeitenden ist nicht mehr selbstverständlich, eine interkulturelle und interreligiöse Öffnung ist notwendig. Damit sind auf der einen Seite viele Chancen verbunden, aber gleichzeitig stehen die Unternehmen der Herausforderung gegenüber, das christliche Profil der Diakonie zu wahren bzw. weiter zu entwickeln. Es bedarf sorgfältiger Analysen und Überlegungen, um für eine Aufhebung der Kirchenzugehörigkeit in bestimmten Bereichen der diakonischen Arbeit zu plädieren (im Dezember 2016 gab es hierzu entsprechende Änderungen in der Loyalitätsrichtlinie der EKD, die die Anforderungen an die Mitarbeitenden formuliert). Entscheidend ist dabei auch die Haltung der Mitarbeitenden diakonischer Einrichtungen. Wenn die Diakonie sich in die religiöse Pluralität der Gesellschaft hinsichtlich der Mitarbeiterschaft öffnen soll, ist es wertvoll, Aufschluss über ihre Einstellungen bezüglich der eigenen Religiosität und religiöser Pluralisierung zu bekommen.
Im Rahmen des Projekts "Religions- und Kultursensibilität als Schwerpunkt der ressourcenorientierten Pädagogik" eines diakonischen Kinder- und Jugendhilfeträgers einer norddeutschen Großstadt, wurde in Zusammenarbeit mit der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg zwischen 2012 und 2014 eine qualitativ-empirische Studie sowohl mit Jugendlichen als auch mit den Mitarbeitenden des Trägers durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Dank
- I. Einleitung
- 1.1 Relevanz des Themas
- 1.2 Stand der Forschung
- 1.2.1 Interkulturelle Öffnung der Diakonie in der Binnen- und Außenperspektive
- 1.2.2 Mitarbeiterstudien in Wohlfahrtsverbänden zum Thema Religiosität
- 1.3 Ziel der Arbeit, Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
- II. Theoretisch-theologischer Rahmen
- 2.1 Manuela Kalsky: Die Vision eines guten Lebens für alle im Bewusstsein eines „neuen Wir“ indem religiöse Vielfalt genutzt wird
- 2.2 Zwischenfazit und Exkurse
- 2.2.1 Ephraim Meir: Martin Bubers dialogisches Beziehungsmodell
- 2.2.2 Paul Knitter: Das Modell der Akzeptanz
- 2.2.3 Richard Traunmüller: Die Kontakthypothese
- III. Mitarbeiterstudie eines diakonischen Kinder- und Jugendhilfeträgers im Rahmen des Projekts “Religionssensible Pädagogik”
- 1. Überblick über das Projekt „Religions- und Kultursensibilität als Schwerpunkt der ressourcenorientierten Pädagogik“
- 1.1 Martin Lechner und Angelika Gabriel: Ein dreistufiger Religionsbegriff
- 1.2 Modell des dreistufigen Religionsbegriffs nach Lechner und Gabriel
- 2. Methodologischer Rahmen der Mitarbeiterbefragung
- 2.1 Qualitativ-heuristische Methodologie
- 2.2 Sample, Erhebungsmethode, Erhebungszeitraum und Auswertungsmethoden
- 3. Auswertung der empirischen Studie
- 3.1 Existenzglaube
- 3.1.1 Religionsverständnis, individuelle Deutungen des Begriffs Religion
- 3.1.2 Religion in der Biographie der Befragten
- 3.1.3 Veränderungen der Rolle von Religion im Laufe des Lebens
- 3.1.4 Schöne und schwere Phasen im Leben der Befragten
- 3.1.4.1 Schöne Phasen
- 3.1.4.2 Schwere Phasen
- 3.1.5 Glauben als Ressource
- 3.1.6 Weitere Ressourcen im Umgang mit Belastungen
- 3.1.7 Begegnungen mit Religion im beruflichen Alltag
- 3.2 Transzendenzglaube
- 3.2.1 Glaubensvorstellungen
- 3.2.2 Erfahrung und Verbundenheit mit einer höheren Macht
- 3.2.3 Zur Bedeutung von Gebeten
- 3.3 Konfessionsglaube
- 3.3.1 Bedeutung der konfessionellen Zugehörigkeit
- 3.3.2 Bedeutung des Christseins
- 3.3.3 Bedeutung von Kirchen- und Gottesdienstbesuchen
- 3.3.4 Einstellung zu anderen Religionen
- 3.3.4.1 Möglichkeiten eines friedlichen Zusammenlebens
- 3.3.5 Alternative bzw. populäre Religion
- 4. Wünsche und Erwartungen der Mitarbeitenden an das Konzept „Religionssensible Pädagogik“
- 3.1 Existenzglaube
- IV. Schlussteil
- 1. Zusammenfassung der Ergebnisse mit theoretisch-theologischer Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Stellenwert von Religiosität im Kontext eines diakonischen Kinder- und Jugendhilfeträgers. Sie analysiert die Ergebnisse einer Mitarbeiterstudie, die im Rahmen des Projekts „Religionssensible Pädagogik“ durchgeführt wurde. Die Arbeit fokussiert auf die persönliche Religiosität der Mitarbeitenden und ihre Einstellung zu religiösen und weltanschaulichen Diversität in der Arbeitswelt.
- Konfessionelle Gebundenheit und religiöse Pluralität im Kontext diakonischer Arbeit
- Religionsverständnis und -erfahrung der Mitarbeitenden
- Bedeutung von Religion in der Biografie und im Berufsalltag der Mitarbeitenden
- Wünsche und Erwartungen der Mitarbeitenden an das Konzept „Religionssensible Pädagogik“
- Theologische Reflexion der Ergebnisse im Kontext von Interreligiösem Dialog und Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und erläutert den aktuellen Forschungsstand. Sie beleuchtet die Interkulturelle Öffnung der Diakonie und die Rolle von Religiosität in Mitarbeiterstudien von Wohlfahrtsverbänden.
- Theoretisch-theologischer Rahmen: Das Kapitel analysiert verschiedene theoretische Ansätze, die sich mit der Frage der religiösen Vielfalt und des interreligiösen Dialogs befassen. Es fokussiert auf die Vision von Manuela Kalsky für ein „neues Wir“, vertieft das dialogische Beziehungsmodell von Martin Buber, sowie die Modelle der Akzeptanz von Paul Knitter und der Kontakthypothese von Richard Traunmüller.
- Mitarbeiterstudie: Dieses Kapitel stellt das Projekt „Religionssensible Pädagogik“ vor und erläutert den methodischen Rahmen der Mitarbeiterbefragung. Es präsentiert die Auswertung der empirischen Studie, die sich mit dem Religionsverständnis, den Religionserfahrungen und dem Einfluss von Religion auf das Berufsleben der Befragten auseinandersetzt. Der Fokus liegt auf den drei Ebenen des Existenz-, Transzendenz- und Konfessionsglaubens.
- Wünsche und Erwartungen der Mitarbeitenden: Das Kapitel analysiert die Wünsche und Erwartungen der Mitarbeitenden an das Konzept „Religionssensible Pädagogik“.
Schlüsselwörter
Diakonie, Religionssensible Pädagogik, Interreligiöser Dialog, Mitarbeiterstudie, Religiosität, Konfessionelle Gebundenheit, Religiöse Pluralität, Existenzglaube, Transzendenzglaube, Konfessionsglaube, Ressourcenorientierung, Interkulturelle Kompetenz.
- Quote paper
- Ulrike Caspar-Seeger (Author), 2014, Zwischen konfessioneller Gebundenheit und religiöser Pluralität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465463