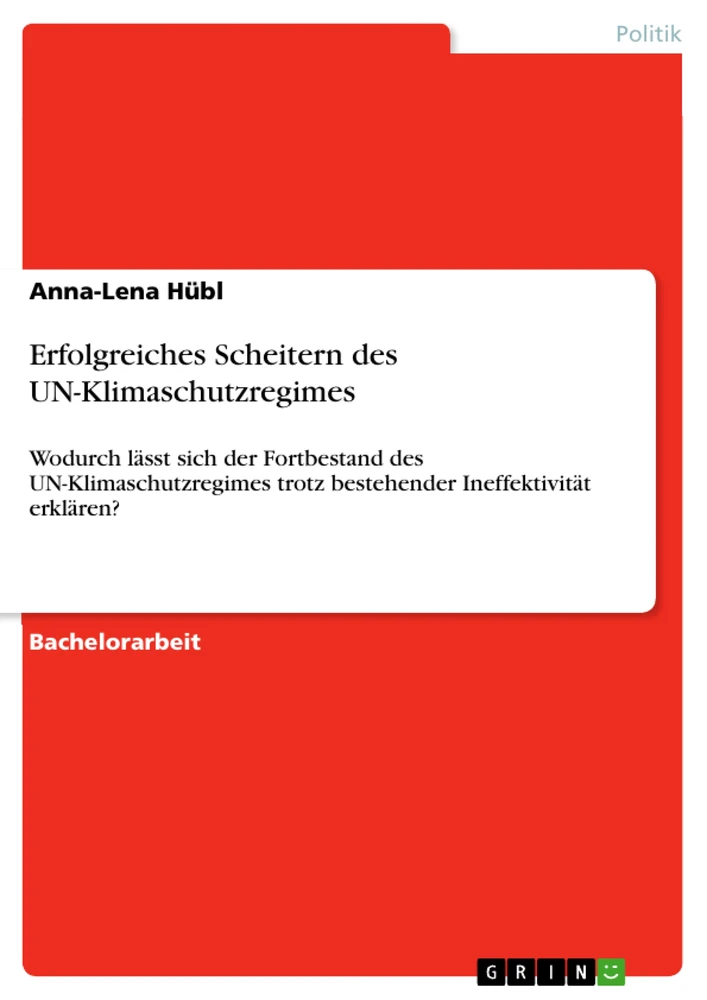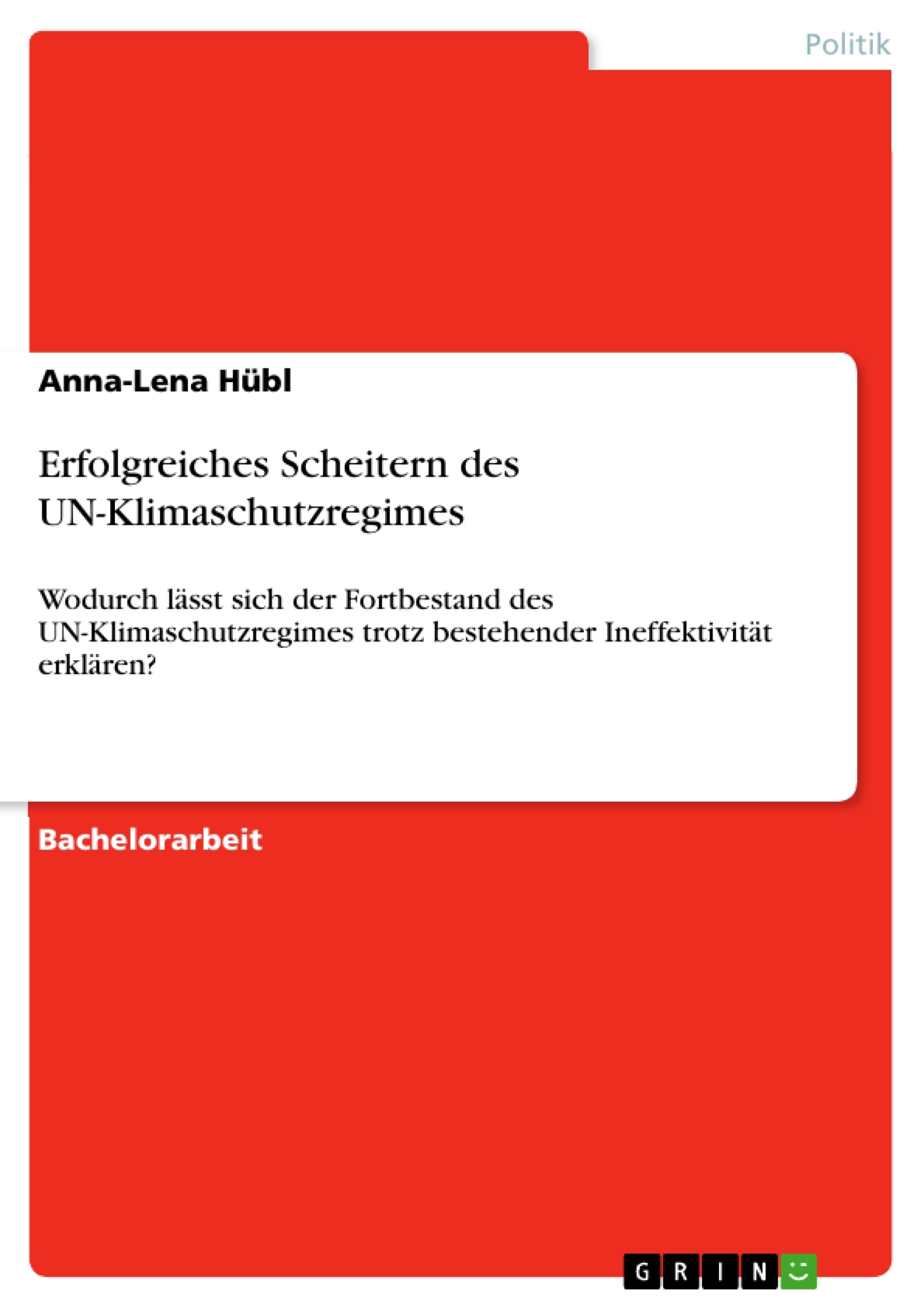Die Arbeit untersucht, warum das UN-Klimaschutzregime trotz seiner permanenten Ineffektivität weiterhin fortbesteht, ob durch die Wirkungsschwäche des Regimes Sekundärnutzen realisiert werden und weshalb auch heute noch Erwartungen auf eine Lösung der Klimaproblematik mittels internationaler Kooperation reproduziert werden.
Mit der Unterzeichnung der Klimarahmenkonvention 1992 in Rio de Janeiro entstand die normative Erwartung auf die Herbeiführung eines wirksamen Klimaregimes unter dem Dach der Vereinten Nationen mit dem Ziel der Eindämmung des globalen Klimawandels. Bis zum heutigen Zeitpunkt konnte diese Erwartung bei breiten Teilen der Bevölkerung von den internationalen und nationalen Akteuren aufrechterhalten werden, auch wenn das UN-Klimaschutzregime bislang rein faktisch hinsichtlich der Stabilisierung des atmosphärischen Treibhausgasniveaus nahezu wirkungslos geblieben ist.
Obwohl das 2015 verabschiedete Pariser Klimaschutzabkommen wieder neue Erwartungen hinsichtlich der Bereitstellung eines effektiven Klimaschutzes mithilfe von internationaler Kooperation produziert, ist es als höchst zweifelhaft anzusehen, ob das ambitionierte Ziel der Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperaturen auf deutlich unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau mithilfe der ausgearbeiteten institutionellen Grundlagen erreicht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 2.1 Problemaufriss Klimawandel
- 2.1.1 Anthropogener Klimawandel
- 2.1.2 Risiken durch den Klimawandel
- 2.1.3 Anpassungs- und Minderungsstrategien
- 2.2 Interdependenz und Regelungsbedarf im internationalen Problemfeld Klimaschutz
- 2.3 Ineffektivität des UN-Klimaschutzregimes
- 2.3.1 Effizienz und Effektivität internationaler Regime
- 2.3.2 Dimensionen der Ineffektivität des UN-Klimaschutzregimes
- 2.3.3 Erklärung des Fortbestands des UN-Klimaschutzregimes
- 2.4 Das erfolgreiche Scheitern des UN-Klimaschutzregimes: Theoretische Erklärungsansätze
- 2.4.1 Erklärungslücke der Regimetheorien
- 2.4.2 Alternative theoretische Erklärungsansätze
- 2.1 Problemaufriss Klimawandel
- III. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Frage, warum das UN-Klimaschutzregime trotz seiner anhaltenden Ineffektivität fortbesteht. Sie analysiert, ob das Regime Sekundärnutzen generiert und welche Faktoren die Reproduktion von Erwartungen auf eine Lösung der Klimaproblematik durch internationale Kooperation bewirken.
- Analyse der Ineffektivität des UN-Klimaschutzregimes im Kontext des Klimawandels
- Untersuchung der Ursachen für den Fortbestand des Regimes trotz dessen Ineffektivität
- Identifizierung von Sekundärnutzen, die durch das Regime generiert werden
- Bewertung des Einflusses des Regimes auf die Reproduktion von Erwartungen auf internationale Kooperation im Klimaschutz
- Analyse des Konzepts des "erfolgreichen Scheiterns" im Kontext internationaler Regime
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Forschungsdesign der Arbeit vor. Sie erläutert das Konzept des "erfolgreichen Scheiterns" und ordnet die Arbeit in die wissenschaftliche Debatte ein. Der Hauptteil beleuchtet zunächst den anthropogenen Klimawandel und seine Risiken sowie die notwendigen Anpassungs- und Minderungsstrategien. Anschließend wird die Bedeutung internationaler Kooperation im Klimaschutz und die Ineffektivität des UN-Klimaschutzregimes behandelt. Schließlich werden verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung des Fortbestands des Regimes trotz seiner Ineffektivität präsentiert.
Schlüsselwörter
UN-Klimaschutzregime, Ineffektivität, Internationales Regime, Klimawandel, Anthropogener Klimawandel, Internationale Kooperation, Erfolgreiches Scheitern, Sekundärnutzen, Regimetheorien, Kontrafaktische Stabilisierung
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das UN-Klimaschutzregime als „erfolgreich scheiternd“ bezeichnet?
Es scheitert faktisch an der Stabilisierung der Treibhausgase, ist aber erfolgreich darin, Erwartungen aufrechtzuerhalten und Sekundärnutzen zu generieren.
Was ist der „Sekundärnutzen“ eines ineffektiven Regimes?
Dazu gehören der politische Austausch, die Standardisierung von Messverfahren oder die Beruhigung der öffentlichen Meinung durch Symbolpolitik.
Wird das Pariser Klimaschutzabkommen 2015 kritisch bewertet?
Ja, die Arbeit hinterfragt, ob die institutionellen Grundlagen ausreichen, um das 2-Grad-Ziel tatsächlich zu erreichen.
Was bedeutet „kontrafaktische Stabilisierung“?
Es beschreibt den Prozess, bei dem normative Erwartungen (Klimaschutz) trotz gegenteiliger Fakten (steigende Emissionen) beibehalten werden.
Welche Rolle spielen Regimetheorien in der Arbeit?
Die Arbeit zeigt eine Erklärungslücke klassischer Regimetheorien auf, die den Fortbestand ineffektiver Institutionen oft nicht ausreichend begründen können.
- Citar trabajo
- Anna-Lena Hübl (Autor), 2018, Erfolgreiches Scheitern des UN-Klimaschutzregimes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464065