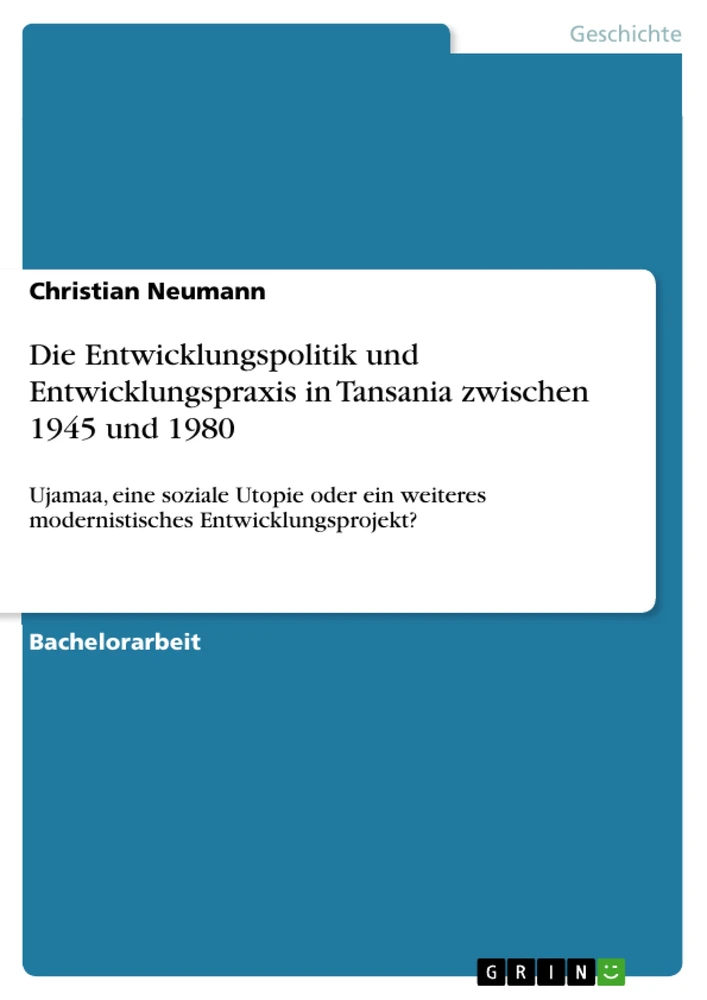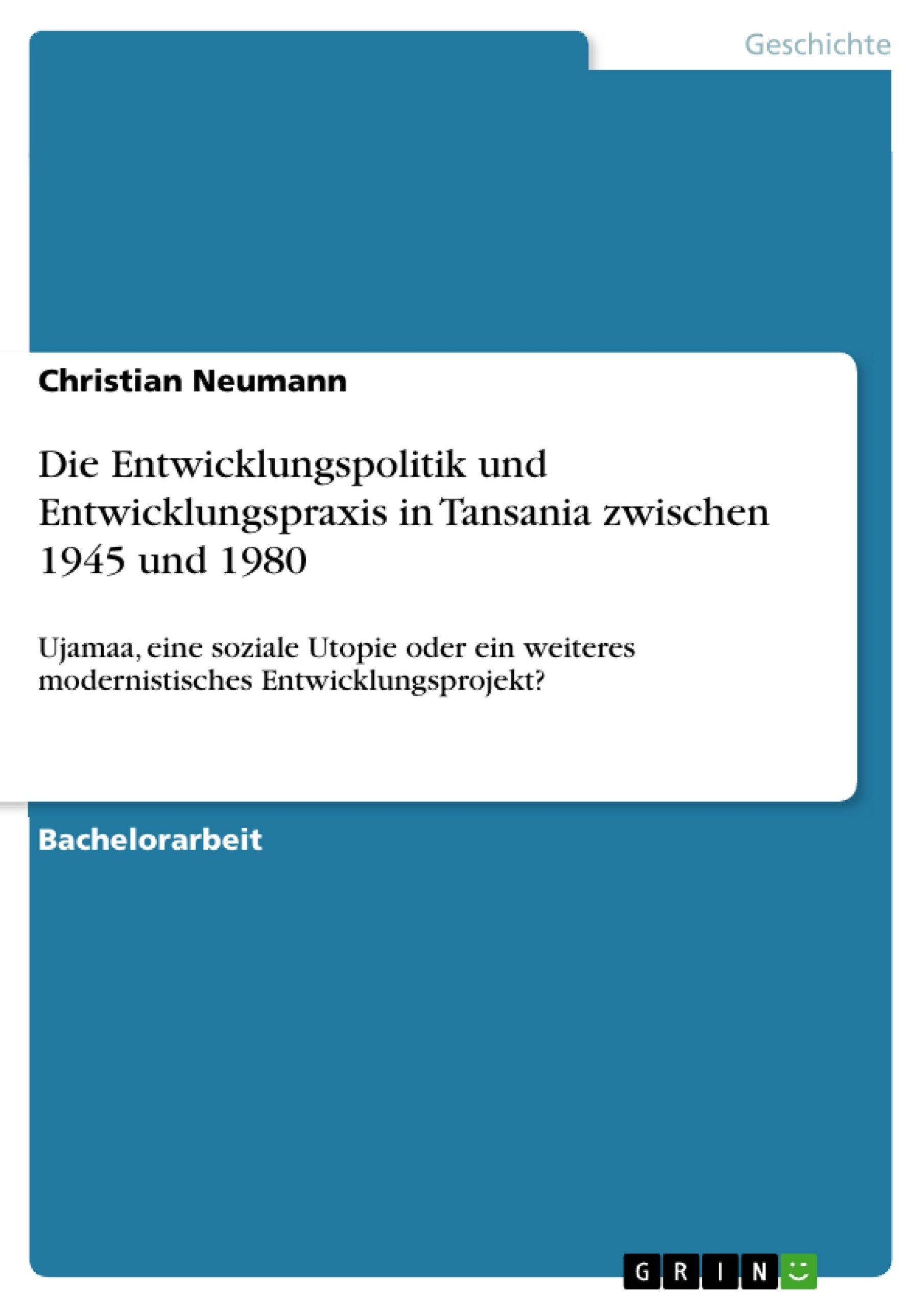Diese Arbeit möchte nicht nur die Bemühungen und Versuche der tansanischen Regierung auf diesem Weg nachzeichnen, Erfolge und Fehlschläge einordnen, sondern auch nach Gründen dafür suchen, warum gerade dieser Weg gewählt wurde, warum diese oder jene Entscheidung so oder so ausfiel. Welche Strukturen, welche Art des Denkens lagen hinter dem historischen Ablauf der Ereignisse, welche Motive hatten die Akteure?
Es war vermutlich der bisher letzte Versuch einer Regierung die Gesellschaft zum Wohl der Bevölkerung radikal umzubauen. Tanganyika, das spätere Tansania, stand mit seiner Unabhängigkeit 1961 vor dem Problem, aus einem der ärmsten Gebiete Afrikas einen Nationalstaat zu formen, der seinen Bürgern einen ausreichenden Lebensstandard bieten würde. Die Schaffung eines Nationalgefühls war eine neue Aufgabe, die Bekämpfung von Armut und Unterentwicklung eine alte. Bereits die Kolonialregierung hatte es sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung des Landes voran zu bringen. Bei der Untersuchung der Entwicklungspolitik der vor- und nachkolonialen Zeit, der 1950er bis 1970er Jahre, werden Kontinuitäten sichtbar werden, sowohl hinsichtlich der Ziele, als auch der Methoden.
Besondere Beachtung werden vermeintliche Brüche finden, Momente, in denen die programmatischen Aussagen von Präsident und Partei in einen Widerspruch zur praktischen Durchführung geraten, als z.B. ein lange gefördertes Projekt, das als Vorbild für das ganze Land diente, plötzlich zerschlagen wurde. Gründungen von Ujamaadörfern wurden seit Beginn der Unabhängigkeit propagiert, aber erst mit der Arusha Deklaration 1967 wurde der Sozialismus zum Staatsziel erklärt. Das Ende dieser Politik ist weniger eindeutig fixierbar.
Während der Höhepunkt der Dorfgründungen noch bevorstand, wurde ein zentraler Teil von Ujamaa, die gemeinschaftliche Produktion, schon 1973 fallengelassen. Als 1976 fast die gesamte ländliche Bevölkerung in Dörfern lebte, waren diese nur noch dem Namen nach Ujamaadörfer. Spätestens während der Schuldenkrise der 1980er Jahre musste Tansania auf Druck des IWF entsprechend der sogenannten Strukturanpassungsprogramme alle staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft aufgeben, was für die Dörfer das Ende eines kostenlosen Gesundheitswesens und kostenloser Grundschulen bedeutete.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unabhängig aber arm...
- Spätkoloniale Entwicklungsversuche..
- Der Weltbankbericht.
- Village Settlement Scheme, 1962-1966..
- Ujamaa in Kürze.......
- Litowa und die Ruvuma Development Association (RDA)
- Die Arusha Deklaration
- Das Ende der RDA.
- Von Ujamaa Vijijini zur Large Scale Villagization …….....
- Mit Zuckerbrot und Peitsche ins Entwicklungsdorf.......
- Vormoderne Gesellschaft und Klassenkampf .
- Sozialismus in einer Ex-Kolonie .......
- Panafrikanismus und der afrikanische Sozialismus
- Ujamaa, der tansanische Sozialismus.
- Die Wirklichkeit der afrikanischen Tradition und der Einfluss Europas
- Der Diskurs von Fortschritt und Entwicklung..
- Die Ästhetik der Moderne….......
- Fazit.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung Tansanias zwischen 1945 und 1980 und analysiert den Versuch der tansanischen Regierung, die Gesellschaft zum Wohle der Bevölkerung radikal umzubauen. Dabei werden insbesondere die Kontinuitäten und Brüche in der Entwicklungspolitik und -praxis im Zusammenhang mit dem Projekt „Ujamaa" beleuchtet.
- Die Herausforderungen bei der Gestaltung eines Nationalstaates in einem der ärmsten Gebiete Afrikas.
- Die verschiedenen Entwicklungsstrategien Tansanias von der Spätkolonialzeit bis in die 1980er Jahre.
- Die Umsetzung des Ujamaa-Programms und seine Auswirkungen auf die ländliche Gesellschaft.
- Die Rolle des Sozialismus im Kontext der afrikanischen Geschichte und der Kolonialerfahrung.
- Der Einfluss europäischer Denkmodelle auf die Entwicklungspolitik Tansanias.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Ujamaa-Projekts dar und skizziert die Ziele und Schwerpunkte der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die späten kolonialen Entwicklungsversuche in Tansania und die anhaltende Armut nach der Unabhängigkeit. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Kernideen des Ujamaa-Konzepts. Kapitel 4 behandelt die Ruvuma Development Association (RDA) und ihre Rolle bei der frühen Umsetzung von Ujamaa. Kapitel 5 widmet sich der Einführung der Large Scale Villagization, einer Politik, die die ländliche Bevölkerung in Ujamaadörfer zwangsumsiedelte. Kapitel 6 diskutiert die Wurzeln des tansanischen Sozialismus in Bezug auf Panafrikanismus und den afrikanischen Sozialismus. Kapitel 7 analysiert den Diskurs von Fortschritt und Entwicklung in Tansania und die zugrundeliegenden Denkmodelle.
Schlüsselwörter
Ujamaa, tansanischer Sozialismus, Entwicklungspolitik, Entwicklungsgeschichte, Tansania, Afrika, Kolonialismus, Moderne, Soziales Experiment, Armut, Unterentwicklung, Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Dorfgründungen, Large Scale Villagization, Panafrikanismus, afrikanischer Sozialismus, Fortschritt, Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Ujamaa-Programms in Tansania?
Ziel war der radikale Umbau der Gesellschaft zu einem afrikanischen Sozialismus, um Armut zu bekämpfen und einen Nationalstaat zu formen.
Was geschah bei der "Large Scale Villagization"?
Ab 1973 wurde die ländliche Bevölkerung oft zwangsweise in Dörfer umgesiedelt, um die gemeinschaftliche Produktion und staatliche Versorgung zu organisieren.
Welche Rolle spielte Präsident Julius Nyerere?
Nyerere war der Architekt des Ujamaa-Konzepts und der Arusha-Deklaration von 1967, die den Sozialismus als Staatsziel festlegte.
Warum scheiterte die Ujamaa-Politik letztlich?
Gründe waren unter anderem wirtschaftliche Ineffizienz, der Widerstand der Bauern gegen die Kollektivierung und die Schuldenkrise der 1980er Jahre.
Was war die Ruvuma Development Association (RDA)?
Die RDA war ein frühes Pilotprojekt für Ujamaa-Dörfer, das jedoch aufgrund politischer Widersprüche später zerschlagen wurde.
Welchen Einfluss hatte der IWF auf Tansania?
Durch Strukturanpassungsprogramme zwang der IWF Tansania zur Aufgabe staatlicher Eingriffe, was das Ende des kostenlosen Bildungs- und Gesundheitswesens bedeutete.
- Citar trabajo
- Christian Neumann (Autor), 2019, Die Entwicklungspolitik und Entwicklungspraxis in Tansania zwischen 1945 und 1980, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463775