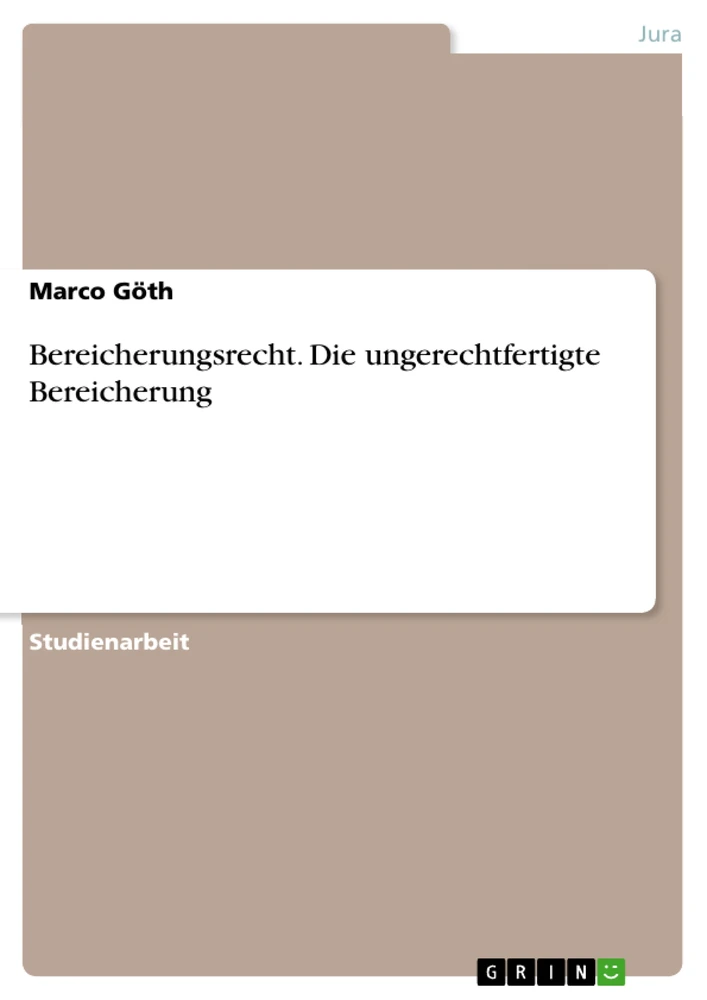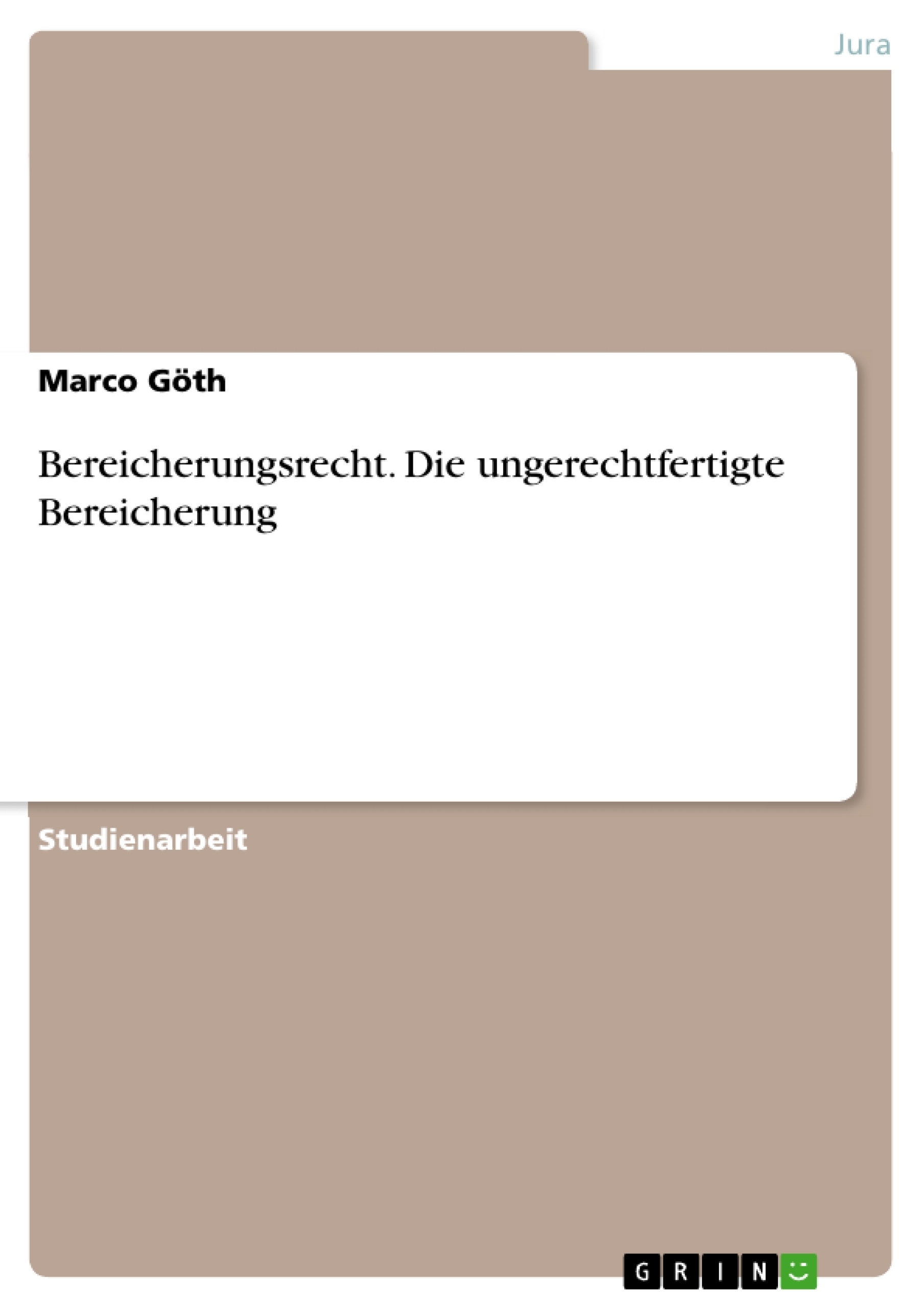Menschen erbringen eine Leistung ohne die vereinbarte Gegenleistung zu erhalten oder es wird unerlaubt in ihr Vermögen eingegriffen. Häufig treten solche Fälle ein. Vermögensverschiebungen dieser Art sind rechtsgrundlos und unberechtigt. Man spricht dabei von einer ungerechtfertigten Bereicherung. Auf den ersten Blick könnte der Begriff „ungerechtfertigte Bereicherung“ missverstanden werden, da man auch annehmen könnte, man wolle einen allgemeinen Ausgleich unterschiedlich zum Beispiel wirtschaftlich, gesellschafts- und sozialpolitisch als „ungerecht“ empfundene Besitzverhältnisse zu bewerkstelligen.
Vielmehr geht es im Bereicherungsrecht darum, ungerechtfertigte Vermögensverschiebungen rückabzuwickeln, um den Benachteiligten zu schützen. Die §§ 812-822 BGB regeln die Ansprüche, welche aus einer ungerechtfertigten Bereicherung hervorgehen. Die Literatur zum Bereicherungsrecht ist sehr umfangreich und enthält Unmengen an Kommentaren und Lehrbüchern. Im Rahmen einer Hausarbeit all diese Gedankengänge aufzugreifen und auf jedes Detail einzugehen ist unmöglich, weshalb der Fokus hier auf den Grundprinzipien des Bereicherungsrechts liegt. Auf den folgenden Seiten wird auf die Leitfrage eingegangen, wann, wieso und wie die Rückübereignung einer rechtsgrundlosen Vermögensverschiebung erreicht werden kann. Ziel der Hausarbeit ist es, dass jeder sein Recht auf die Herausgabe der von ihm geleisteten Sache im Falle einer Vermögensverschiebung erkennen, verstehen und begründen kann.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Allgemeine Definition
- I. Etwas erlangen
- II. Durch die Leistung eines anderen
- III. In sonstiger Weise auf dessen Kosten
- IV. Ohne rechtlichen Grund
- C. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft
- I. Überblick
- II. Trennungsprinzip
- III. Abstraktionsprinzip
- D. Leistung und Nichtleistung
- I. Leistung
- 1. Solvendi causa
- 2. Donandi causa
- 3. Obligandi causa
- 4. Ob rem
- II. Nichtleistung
- I. Leistung
- E. Leistungskondiktion und Nichtleistungskondiktion
- I. Leistungskondiktion
- 1. Arten der Leistungskondiktion
- a. Kondiktion wegen Fehlen des Rechtsgrunds
- b. Kondiktion wegen Wegfalls des Rechtsgrundes
- c. Kondiktion wegen Bestehens einer dauernden Einrede
- d. Kondiktion wegen Nichtseintritts des bezweckten Erfolgs
- e. Kondiktion wegen gesetzes- oder sittenwidrigem Empfangs
- 2. Ausschlussgründe
- 1. Arten der Leistungskondiktion
- II. Nichtleistungskondiktion
- 1. Eingriffskondiktion
- 2. Verwendungskondiktion
- 3. Rückgriffskondiktion
- I. Leistungskondiktion
- F. Verjährung
- G. Fazit
- H. Praxisbezug
- I. Sachverhalt
- II. Rechtslage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Grundlagen der ungerechtfertigten Bereicherung nach §§ 812-822 BGB. Ziel ist es, die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Herausgabe einer rechtsgrundlos erlangten Vermögensverschiebung zu verstehen und zu erläutern. Der Fokus liegt auf den Grundprinzipien des Bereicherungsrechts.
- Definition und Abgrenzung der ungerechtfertigten Bereicherung
- Unterscheidung zwischen Leistungskondiktion und Nichtleistungskondiktion
- Voraussetzungen für einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung
- Ausschlussgründe und Verjährung
- Praktische Anwendung der Rechtsgrundlagen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der ungerechtfertigten Bereicherung ein. Sie beschreibt den Sachverhalt von rechtsgrundlosen Vermögensverschiebungen und benennt das Ziel der Arbeit: ein Verständnis für die Herausgabe von geleisteten Sachen im Falle einer solchen Verschiebung zu ermöglichen. Die Einleitung betont die Komplexität der Materie und die Notwendigkeit, sich auf die Grundprinzipien zu konzentrieren.
B. Allgemeine Definition: Dieses Kapitel definiert den Kernbereich der §§ 812-822 BGB, nämlich die Rückabwicklung mangelhaft schuldrechtlich begründeter Leistungsaustausche. Es erklärt die Unterscheidung zwischen Leistungskondiktion und Nichtleistungskondiktion anhand von § 812 Abs. 1 S. 1 BGB, wobei die Bereicherung "durch Leistung" und "in sonstiger Weise auf dessen Kosten" gegenübergestellt werden. Zusätzliche Tatbestandsmerkmale wie "Etwas erlangen" und "Ohne rechtlichen Grund" werden vorgestellt und als prüfungsrelevant benannt.
C. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft: Dieses Kapitel behandelt das Verhältnis von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft im Kontext der ungerechtfertigten Bereicherung. Es erklärt den Überblick, das Trennungsprinzip und das Abstraktionsprinzip und deren Bedeutung für die Rückabwicklung von Vermögensverschiebungen. Die detaillierte Erläuterung dieser Prinzipien ist essentiell für das Verständnis der Rechtsfolgen bei ungerechtfertigten Bereicherungen.
D. Leistung und Nichtleistung: Hier wird der zentrale Unterschied zwischen Leistung und Nichtleistung im Bereicherungsrecht erörtert. Die verschiedenen Arten von Leistungen (Solvendi causa, Donandi causa, Obligandi causa, Ob rem) werden definiert und von Nichtleistungen abgegrenzt. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die Wahl des richtigen Kondiktionsanspruchs.
E. Leistungskondiktion und Nichtleistungskondiktion: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den beiden Hauptformen der Kondiktionen: der Leistungskondiktion und der Nichtleistungskondiktion. Es differenziert die Arten der Leistungskondiktion (wegen Fehlens, Wegfalls, dauernder Einrede, Nichtseintritts des Erfolgs, gesetzes- oder sittenwidrigem Empfang) und beleuchtet die Ausschlussgründe. Die verschiedenen Formen der Nichtleistungskondiktion (Eingriffs-, Verwendungs-, und Rückgriffskondikation) werden ebenfalls detailliert erklärt. Die Unterscheidung und die jeweiligen Voraussetzungen dieser Kondiktionen sind zentral für die praktische Anwendung des Bereicherungsrechts.
F. Verjährung: Dieses Kapitel behandelt die Verjährungsfristen im Bereicherungsrecht. Es beschreibt die Relevanz der Verjährung für die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung und stellt die relevanten Fristen dar. Die Kenntnis der Verjährungsregeln ist essentiell für die Beurteilung der Erfolgsaussichten eines Kondiktionsanspruchs.
H. Praxisbezug: Der Praxisbezug verdeutlicht die Anwendung der theoretischen Grundlagen anhand eines konkreten Sachverhalts. Die Rechtslage wird analysiert und die relevanten Vorschriften des BGB herangezogen, um den Sachverhalt zu lösen. Dies veranschaulicht die praktische Relevanz der behandelten Rechtsmaterie.
Schlüsselwörter
Ungerechtfertigte Bereicherung, §§ 812-822 BGB, Leistungskondiktion, Nichtleistungskondiktion, Rechtsgrund, Vermögensverschiebung, Herausgabepflicht, Ausschlussgründe, Verjährung, Kondiktionen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Ungerechtfertigte Bereicherung nach §§ 812-822 BGB
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Grundlagen der ungerechtfertigten Bereicherung nach §§ 812-822 BGB. Sie untersucht die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Herausgabe einer rechtsgrundlos erlangten Vermögensverschiebung und konzentriert sich auf die Grundprinzipien des Bereicherungsrechts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung der ungerechtfertigten Bereicherung, Unterscheidung zwischen Leistungskondiktion und Nichtleistungskondiktion, Voraussetzungen für einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung, Ausschlussgründe und Verjährung sowie die praktische Anwendung der Rechtsgrundlagen. Detailliert werden die verschiedenen Arten von Kondiktionen (z.B. wegen Fehlens, Wegfalls oder Sittenwidrigkeit des Rechtsgrundes) und die Prinzipien des Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäftes erläutert.
Was ist der Unterschied zwischen Leistungskondiktion und Nichtleistungskondiktion?
Die Hausarbeit erklärt den zentralen Unterschied zwischen Leistung und Nichtleistung im Bereicherungsrecht und differenziert die Arten der Leistungskondiktion (z.B. wegen Fehlens, Wegfalls, dauernder Einrede, Nichtseintritts des Erfolgs, gesetzes- oder sittenwidrigem Empfang) von den verschiedenen Formen der Nichtleistungskondiktion (Eingriffs-, Verwendungs-, und Rückgriffskondikation). Die jeweiligen Voraussetzungen und die Unterscheidung sind zentral für die praktische Anwendung.
Welche Rolle spielen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft?
Die Hausarbeit behandelt das Verhältnis von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft im Kontext der ungerechtfertigten Bereicherung, erklärt das Trennungsprinzip und das Abstraktionsprinzip und deren Bedeutung für die Rückabwicklung von Vermögensverschiebungen.
Wie wird die Verjährung behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die Verjährungsfristen im Bereicherungsrecht und deren Relevanz für die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung. Die relevanten Fristen werden dargestellt.
Enthält die Arbeit einen Praxisbezug?
Ja, die Hausarbeit enthält einen Praxisbezug, der die Anwendung der theoretischen Grundlagen anhand eines konkreten Sachverhalts verdeutlicht. Die Rechtslage wird analysiert und die relevanten Vorschriften des BGB herangezogen, um den Sachverhalt zu lösen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Ungerechtfertigte Bereicherung, §§ 812-822 BGB, Leistungskondiktion, Nichtleistungskondiktion, Rechtsgrund, Vermögensverschiebung, Herausgabepflicht, Ausschlussgründe, Verjährung, Kondiktionen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Hausarbeit bietet eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung und den allgemeinen Definitionen bis hin zum Praxisbezug. Diese Zusammenfassungen geben einen umfassenden Überblick über den Inhalt und die Argumentationslinien der Arbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der Voraussetzungen für einen Anspruch auf Herausgabe einer rechtsgrundlos erlangten Vermögensverschiebung zu vermitteln und die Grundprinzipien des Bereicherungsrechts zu erläutern.
- Arbeit zitieren
- Marco Göth (Autor:in), 2019, Bereicherungsrecht. Die ungerechtfertigte Bereicherung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461873