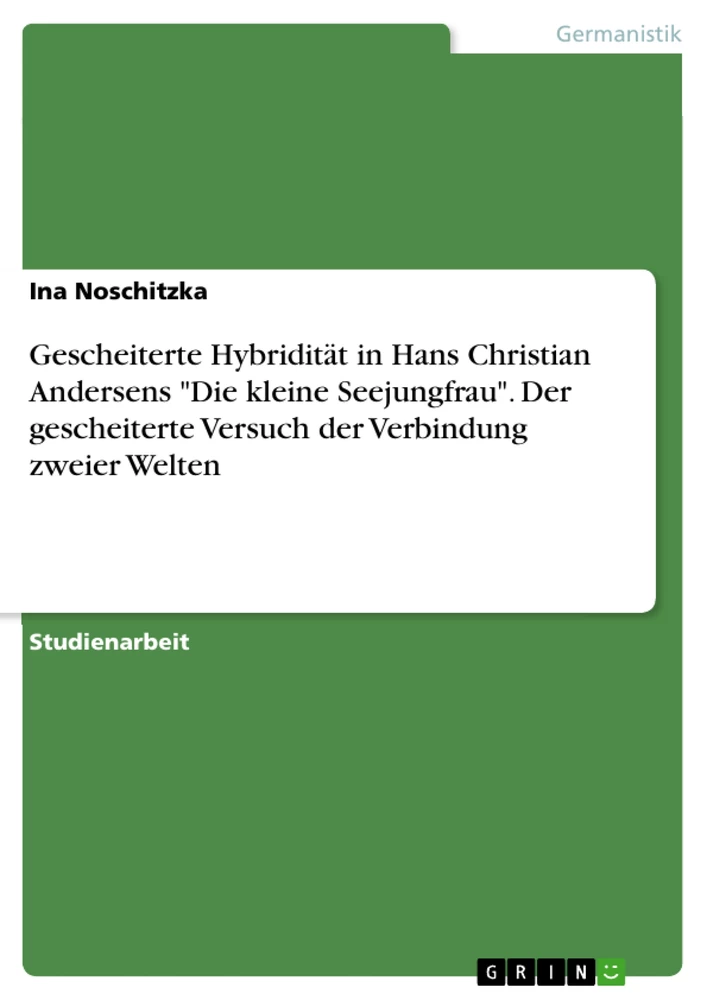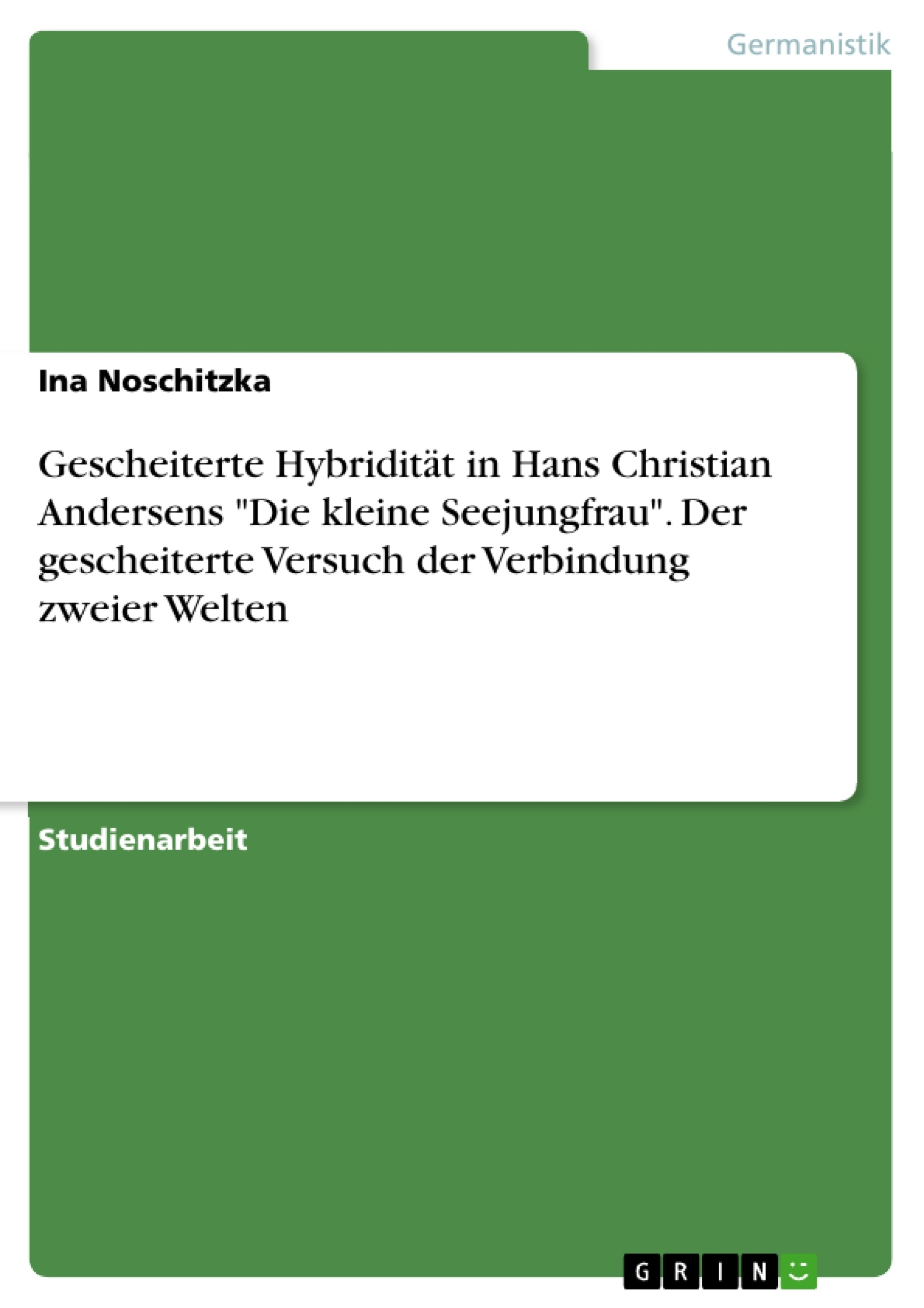Andersens „Die kleine Seejungfrau“ greift einen Mythos auf, der seit mehreren tausend Jahren in Literatur und Kunst vieler verschiedener Kulturen präsent ist. Die Figur der Wasserfrau bietet viele verschiedene Formen: Nixe, Sirene, Meerjungfrau, Undine, Melusine und Loreley. Alle diese Realisierungen spielen auf „die Assoziation von Weiblichkeit und Wasser“ (Wich 15) an. Andersen jedoch prägte vornehmlich das Bild der Meerjungfrau, das wir heute kennen und inspirierte damit viele andere Werke – das wohl berühmteste ist Disneys Arielle. In den meisten anderen Version besitzen „die Fabelwesen, zumeist die weiblichen, eine erotische Anziehungskraft, die den unweigerlichen Untergang des Betörten freiwillig erscheinen lässt.“ (27). Andersens Seejungfrau jedoch wirkt kindlicher und unschuldiger. Dies verweist auf eine andere Sichtweise dieser Wesen.
„Die Meerjungfrauen erscheinen als schutz- und erlösungsbedürftige Fabelwesen, die nur durch die Liebe eines Menschen aus dem Zustand der Seelenlosigkeit befreit werden können.“ (28). Ebendiese Sichtweise beschreibt die Essenz von Andersens Märchen. Die kleine Seejungfrau (die, zusätzlich bemerkt, keinen Namen besitzt und somit eine Beispielhaftigkeit bleibt) ist auf der Suche nach der Erlösung und dem Erlangen einer Seele. In der ersten Fassung von Andersen’s Märchen stirbt die kleine Seejungfrau und wird zu Schaum auf dem Meer, nachdem sie sich weigert, den Prinzen zu töten. Später wurde das Ende insofern umgeändert, dass sie eine zweite Chance auf eine unsterbliche Seele erhält, indem sie sich den Luftgeistern anschließt. Die kleine Seejungfrau verkörpert den tragisch gescheiterten Versuch, zwei Welten zu verbinden, die unvereinbar sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.1. Beschreibungen zweier Welten.
- 2.2. Die Unvereinbarkeit dieser Welten
- 3. Der Verbindungsversuch der Seejungfrau..
- 3.1. Alles, was sie hat geben können.
- Die personifizierte Hybridität .......
- Vorahnungen ihres Scheiterns.
- Scheitern.
- 3.2.
- 4.1.
- 4.2.
- 5. Schluss....
- 6. Bibliographie.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Hans Christian Andersens „Die kleine Seejungfrau“ im Hinblick auf den gescheiterten Versuch, zwei Welten – die Unterwasserwelt und die Welt der Menschen – miteinander zu verbinden. Die Analyse untersucht die Darstellung der beiden Welten, ihre Unvereinbarkeit und die Folgen des Versuchs, diese Gegensätze zu überwinden.
- Die Darstellung der Unterwasserwelt als Ort der Harmonie und Lebensfreude
- Die Beschreibung der Menschenwelt als Ort der Pracht und des Prunks
- Die Unvereinbarkeit der beiden Welten aufgrund der „Wesensdifferenz“ (Kraß)
- Die kleine Seejungfrau als Symbol für den tragischen Versuch, Natur und Kultur zu vereinen
- Die Folgen des gescheiterten Versuchs und die symbolische Bedeutung des Endes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Der Text stellt Andersens „Die kleine Seejungfrau“ als ein Werk vor, das die Figur der Meerjungfrau populär gemacht hat und die heutige Vorstellung von diesem Fabelwesen prägt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Essenz von Andersens Märchen: den gescheiterten Versuch der kleinen Seejungfrau, ihre Unterwasserwelt zu verlassen und in die Welt der Menschen zu gelangen.
2.1. Beschreibungen zweier Welten
Die Analyse beleuchtet die Beschreibungen der beiden Welten, in denen die kleine Seejungfrau lebt, um die Unterschiede aufzuzeigen. Die Unterwasserwelt wird mit den Worten „lebendig“, „harmonisch“ und „klar“ beschrieben, während die Menschenwelt durch „Pracht“, „Prunk“ und „Wertvolles“ geprägt ist. Andersens Sprache verdeutlicht die Gegensätze zwischen Natur und Kultur.
2.2. Die Unvereinbarkeit dieser Welten
Trotz der märchenhaften Beschreibungen betont der Text die Unvereinbarkeit der beiden Welten. Die kleine Seejungfrau und ihr Prinz, ein Vertreter der Menschenwelt, sind durch unterschiedliche Sozialisation geprägt, was eine Beziehung zwischen ihnen erschwert. Der Konflikt zwischen Natur und Kultur stellt ein zentrales Thema der Analyse dar.
Schlüsselwörter
Die Analyse befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Hybridität“, „Unvereinbarkeit“, „Natur“, „Kultur“, „Märchen“, „Andersens Die kleine Seejungfrau“, „Seejungfrau“, „Prinz“, „Liebe“, „Scheitern“, „Traum“ und „Seele“. Die Arbeit befasst sich mit der Thematik des gescheiterten Versuchs, zwei unterschiedliche Welten zu verbinden, und der daraus resultierenden Tragik. Der Fokus liegt auf der symbolischen Bedeutung der Figur der kleinen Seejungfrau und der Analyse von Andersens Werk im Kontext der jeweiligen Epoche.
- Quote paper
- Ina Noschitzka (Author), 2018, Gescheiterte Hybridität in Hans Christian Andersens "Die kleine Seejungfrau". Der gescheiterte Versuch der Verbindung zweier Welten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461680