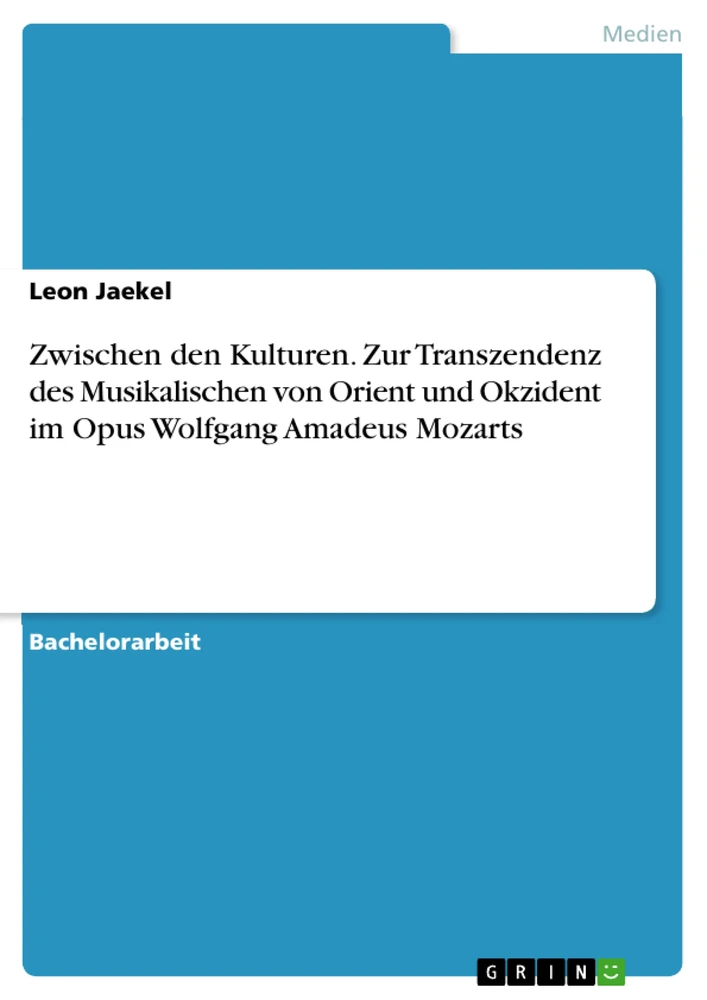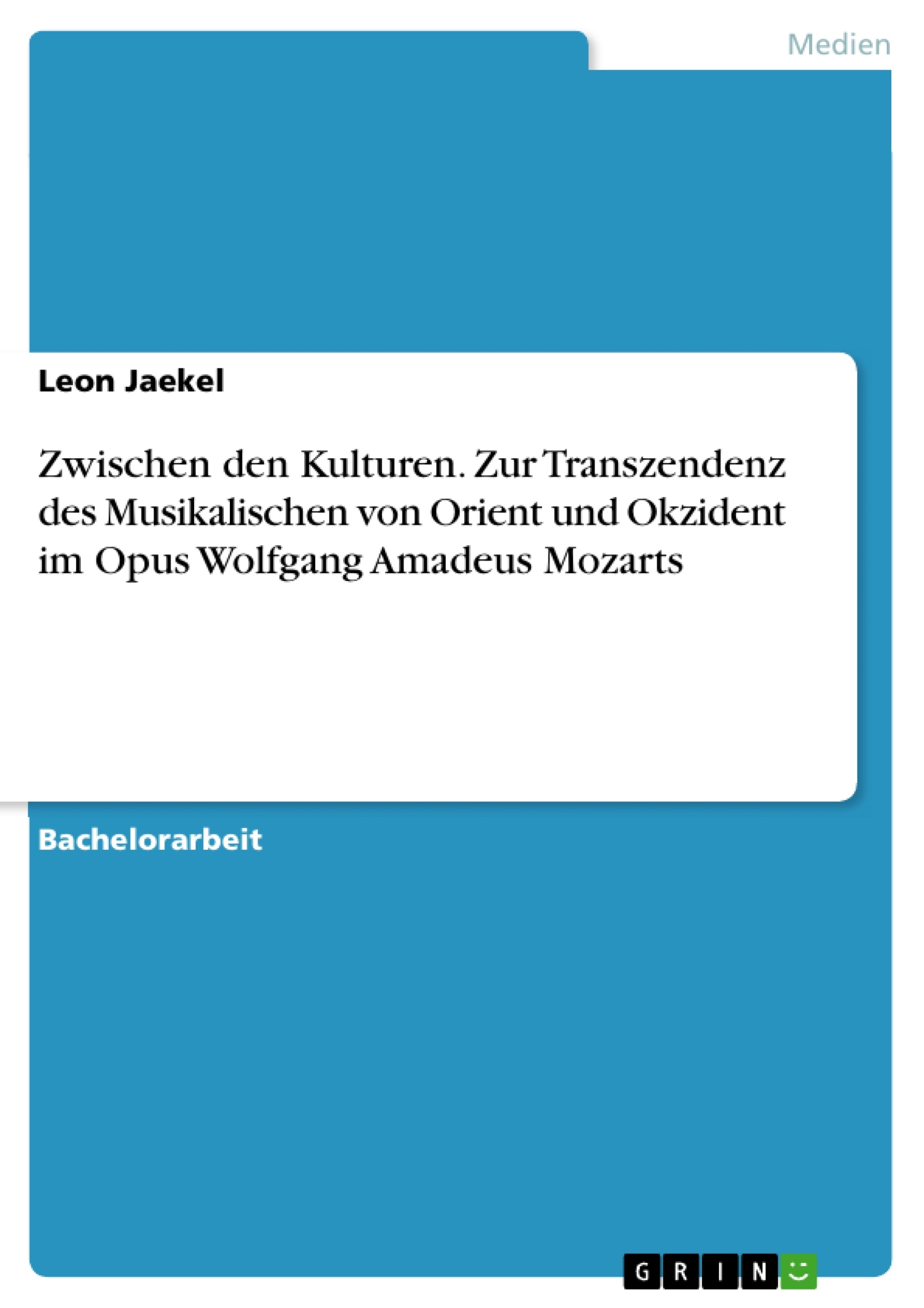Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) hat in seinem nur 35 Jahre währenden Leben ein Opus von ungeheurer Vielfalt geschaffen. Er hinterließ der Nachwelt ca. 600 vollendete Werke. Dazu sind noch weitere 160 Kompositionen fragmentarisch hinterlassen worden.
Die vorliegende Arbeit nähert sich dieser Vielfalt des Mozart´schen Opus aus zwei Betrachtungswinkeln. Zunächst wird das Gesamtwerk Mozarts nach morgenländischen Einflüssen hin untersucht. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Militärmusik des Osmanischen Reiches, der so genannten „Janitscharen-Musik“. In welcher Form und in welchem Ausmaß sich Mozart durch diese Einflüsse inspirieren ließ, soll anhand ausgewählter Beispiele aus seinem Opus dargelegt werden. Dieser Abgleich soll dann zur Klärung der Frage führen, ob Mozarts Verwendung türkischer Elemente Ausdruck eines transkulturellen Austauschs auf musikalischer Ebene darstellt. Dadurch wird die Frage nach der Authentizität des türkischen Kolorits in den Kompositionen Mozarts aufgeworfen.
Das Genie Mozarts wird unter dem Aspekt der Vielfalt besonders deutlich. Aus diesem Grund wird der Blickwinkel auf das Mozart ´sche Opus im zweiten Teil dieser Arbeit auf die vermeintlich gegensätzliche Erfahrungswelt gelegt: dem christlich geprägten Abendland, auch bekannt als Okzident. Mozarts Wirken ist ohne die musikalische Tradition des Abendlandes nicht gänzlich zu erfassen. Diese Tradition spiegelt sich vor allem in der christlichen Kirchenmusik wieder. Auch in diesem Umfeld tat sich Mozart mit herausragenden Kompositionen als „beispielloses Ausnahmetalent“ hervor. Diese Arbeit fragt in diesem Zusammenhang vor allem nach der Einordnung des Mozart ´schen Genies in den musikhistorischen Kontext. Grundlage hierfür bildet das letzte von Mozart geschriebene Werk, sein Requiem d-Moll, KV 626. Anhand dessen soll anschließend das bis in die heutige Zeit transportierte Bild Mozarts als eben jenes „beispielloses“ Ausnahmetalent kritisch hinterfragt werden.
Diese beiden auf den ersten Blick sehr verschiedenen Ansätze werden geleitet von der Frage nach der „Transzendenz des Musikalischen“. Um die vorliegenden Ergebnisse unter dem Aspekt der Transzendenz einordnen und bewerten zu können, wird zu Beginn der Transzendenzbegriff definiert und in den Kontext der Untersuchung eingebunden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Transzendenzbegriff - Definition und Wortherkunft
- 3. Die Transzendenz des Musikalischen im Opus Wolfgang Amadeus Mozarts
- 3.1. Der Orient als musikalische Inspiration in Mozarts Schaffen
- 3.1.1. Der historische Kontext - Die Türken vor Wien
- 3.1.2. Die "Turkomanie" in Österreich im ausgehenden 18. Jahrhundert - Das Türkische in Mode und Musik
- 3.1.3. Türkische Musik in Mozarts Schaffen
- 3.1.3.1. Violinkonzert Nr. 5, A-Dur, KV 219
- 3.1.3.2. Die Entführung aus dem Serail
- 3.1.3.3. Klaviersonate A-Dur, KV 331 - Alla Turca
- 3.2. Der Okzident als musikalische Inspiration in Mozarts Schaffen
- 3.2.1. Der historische Kontext - Mozarts kirchenmusikalisches Umfeld
- 3.2.2. Mozarts letztes Werk - Das Requiem d-Moll KV 626
- 3.2.2.1. Mozarts musikalische Vorbilder für die Komposition des Requiems
- 3.2.2.1.1. Johann Sebastian Bach
- 3.2.2.1.2. Georg Friedrich Händel
- 3.2.2.1.3. Michael Haydn
- 3.2.2.1. Mozarts musikalische Vorbilder für die Komposition des Requiems
- 3.2.3. Das Requiem als Höhepunkt von Mozarts Schaffen
- 3.1. Der Orient als musikalische Inspiration in Mozarts Schaffen
- 4. Fazit - Mozart zwischen den Kulturen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vielseitigkeit von Mozarts Werk aus zwei Perspektiven: dem Einfluss orientalisch-türkischer Musik und der abendländischen, christlich geprägten Tradition. Ziel ist es, Mozarts transkulturelle Tendenzen und seine Einordnung in den musikhistorischen Kontext zu beleuchten, indem der Begriff der "Transzendenz des Musikalischen" analysiert und auf Mozarts Schaffen angewendet wird. Die Authentizität der Verwendung türkischer Elemente sowie die Bedeutung des Requiems als Höhepunkt seines Schaffens stehen im Mittelpunkt.
- Transzendenz des Musikalischen in Mozarts Werk
- Einfluss orientalisch-türkischer Musik auf Mozarts Kompositionen
- Bedeutung der abendländischen Kirchenmusiktradition für Mozarts Schaffen
- Mozarts Kompositionsmethodik und Bezug auf bestehende musikalische Modelle
- Kritisches Hinterfragen des Bildes Mozarts als "beispielloses Ausnahmetalent"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt den Umfang und die Vielfalt des Mozart'schen Opus. Sie skizziert die zwei zentralen Betrachtungsweisen: den Einfluss der orientalischen, insbesondere der Janitscharenmusik, und die Einbettung in die abendländische Kirchenmusiktradition. Die Arbeit untersucht, inwiefern Mozarts Werk einen transkulturellen Austausch widerspiegelt und das Bild Mozarts als Ausnahmetalent kritisch hinterfragt.
2. Der Transzendenzbegriff - Definition und Wortherkunft: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Transzendenz und ordnet ihn in den musikwissenschaftlichen Kontext ein. Es beschreibt Transzendenz als Überschreitung der endlichen Erfahrungswelt und bezieht sich auf aristotelische Definitionen des „Seiendseins“. Dieser Begriff wird als Grundlage für die Analyse von Mozarts transkulturellen Tendenzen verwendet.
3. Die Transzendenz des Musikalischen im Opus Wolfgang Amadeus Mozarts: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert Mozarts Werk unter den beiden genannten Perspektiven. Es wird erläutert, wie Mozart durch gezieltes Studium bestehenden musikalischen Materials komponierte, oftmals in Werkpaaren. Der Abschnitt 3.1 untersucht den Einfluss der türkischen Musik, indem er den historischen Kontext beleuchtet und ausgewählte Werke analysiert. Die kontroverse Frage nach der Authentizität und dem Umfang dieses Einflusses wird diskutiert. Abschnitt 3.2 widmet sich Mozarts Einbettung in die abendländische Tradition, mit besonderem Fokus auf sein letztes Werk, das Requiem, und dessen musikhistorischen Kontext sowie seine Vorbilder.
Schlüsselwörter
Wolfgang Amadeus Mozart, Transzendenz, Orient, Okzident, Türkische Musik, Janitscharenmusik, Kirchenmusik, Requiem, Kompositionsmethodik, Transkultureller Austausch, Musikgeschichte, 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Transzendenz des Musikalischen im Opus Wolfgang Amadeus Mozarts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das musikalische Werk Wolfgang Amadeus Mozarts unter dem Aspekt der "Transzendenz des Musikalischen". Der Fokus liegt auf dem Einfluss sowohl orientalisch-türkischer Musik als auch der abendländischen, christlich geprägten Tradition auf Mozarts Kompositionen. Ziel ist es, Mozarts transkulturelle Tendenzen und seine Einordnung in den musikhistorischen Kontext zu beleuchten und das gängige Bild Mozarts als Ausnahmetalent kritisch zu hinterfragen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss orientalisch-türkischer Musik (Janitscharenmusik) auf Mozarts Schaffen, insbesondere anhand von Beispielen wie dem Violinkonzert Nr. 5, der Entführung aus dem Serail und der Klaviersonate A-Dur, KV 331 ("Alla Turca"). Gleichzeitig wird der Einfluss der abendländischen Kirchenmusiktradition beleuchtet, wobei Mozarts Requiem als zentrales Beispiel dient und die Vorbilder Bach, Händel und Michael Haydn untersucht werden. Die Arbeit beleuchtet auch Mozarts Kompositionsmethodik und seinen Bezug auf bestehende musikalische Modelle.
Wie wird der Begriff "Transzendenz" definiert und angewendet?
Der Begriff der Transzendenz wird als Überschreitung der endlichen Erfahrungswelt definiert und im musikwissenschaftlichen Kontext eingeordnet. Er dient als Grundlage für die Analyse von Mozarts transkulturellen Tendenzen in seinem Werk. Die Arbeit bezieht sich dabei auf aristotelische Definitionen des „Seiendseins“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition des Transzendenzbegriffes, ein Kernkapitel zur Analyse der Transzendenz des Musikalischen in Mozarts Werk (mit Unterkapiteln zu orientalischen und abendländischen Einflüssen) und ein abschließendes Fazit.
Welche konkreten Werke Mozarts werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem Mozarts Violinkonzert Nr. 5, A-Dur, KV 219, die Entführung aus dem Serail, die Klaviersonate A-Dur, KV 331 ("Alla Turca") und vor allem sein Requiem d-Moll KV 626. Die Analyse konzentriert sich auf die Verwendung türkischer Elemente und die Einbettung in die abendländische Kirchenmusiktradition.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert die Frage, inwiefern Mozarts Werk einen transkulturellen Austausch widerspiegelt und wie dies sein Bild als "beispielloses Ausnahmetalent" beeinflusst. Die Authentizität der Verwendung türkischer Elemente und die Bedeutung des Requiems als Höhepunkt seines Schaffens werden kritisch hinterfragt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Wolfgang Amadeus Mozart, Transzendenz, Orient, Okzident, Türkische Musik, Janitscharenmusik, Kirchenmusik, Requiem, Kompositionsmethodik, Transkultureller Austausch, Musikgeschichte, 18. Jahrhundert.
- Citar trabajo
- Leon Jaekel (Autor), 2018, Zwischen den Kulturen. Zur Transzendenz des Musikalischen von Orient und Okzident im Opus Wolfgang Amadeus Mozarts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461645