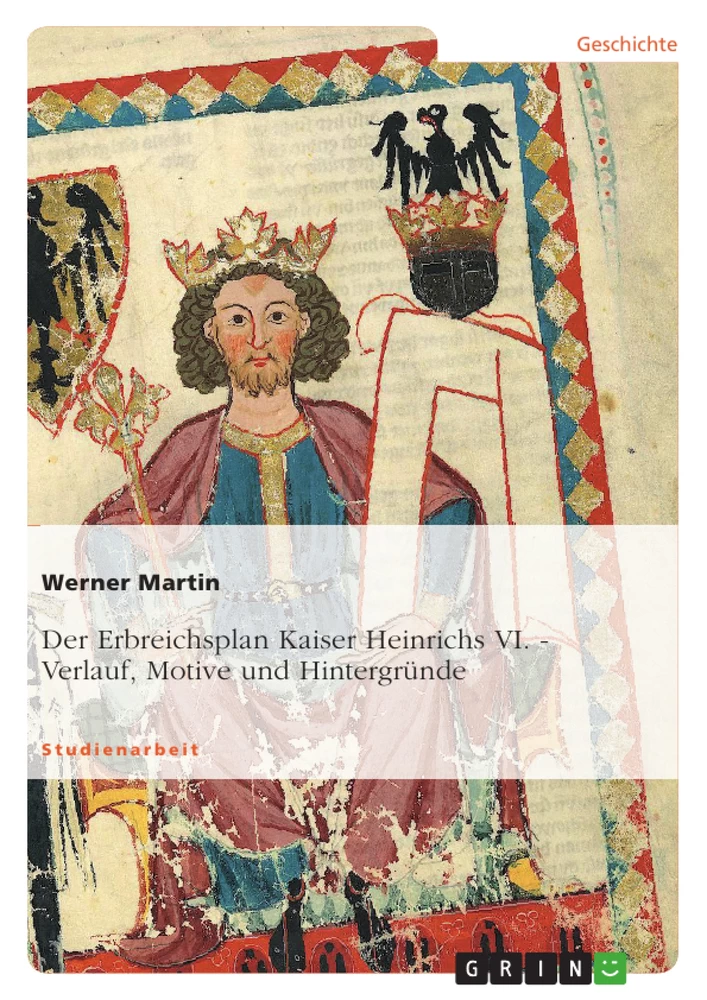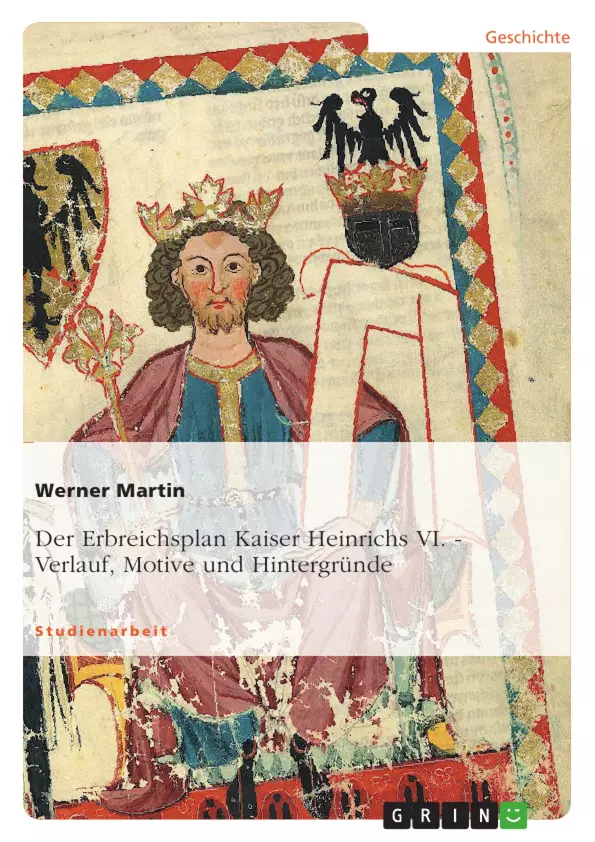„Seine Feinde hatten vor Heinrich gezittert, die Welt hat ihn betrauert, die Nachwelt vergessen. Unter den Herrscherpersönlichkeiten, die das schwäbische Adelsgeschlecht der Staufer hervorgebracht hat, steht Heinrich VI. sowohl im Schatten seines Vaters, Friedrich Barbarossas, wie auch seines Sohnes, Friedrichs II.).“ (Peter Csendes)
Unter Heinrich VI. wuchs die Größe des deutschen Reichs auf ungeahnte Ausmaße an, er bot den Engländern mit der Festsetzung ihres Königs Richard Löwenherz auf Trifels die Stirn und schwächte damit gleichzeitig die welfische Oppositionsfront im Reich. Und beinahe wäre es ihm durch eine taktische Meisterleistung gelungen, die staufische Herrschaft im Reich mit seinem Erbreichsplan langfristig zu sichern. Mit diesem Plan hat Heinrich VI. in zähen Verhandlungen mit den geistlichen und weltlichen Fürsten des Reichs und mit Papst Coelestin III. versucht, sein Reich in ein Erbreich umzuwandeln.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Entwicklung der Ereignisse um den Erbreichsplan und Heinrichs Motive für die Errichtung eines Erbreiches herauszuarbeiten. Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und Heinrichs politisches und taktisches Kalkül bei den Verhandlungen analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzvorstellung der Quellen
- Von der Vorgeschichte zur Verkündung des Erbreichplans
- Die politischen Rahmenbedingungen im Reich und in Sizilien
- Der Designations versuch von 1195
- Die Verkündung des Erbreichplans
- Der Widerstand der Fürsten und des Papstes
- Die Opposition der Fürsten
- Die Verhandlungen mit Papst Coelestin III.
- Mögliche Motive Heinrichs VI. für die Einführung eines Erbreichs
- Zusammenfassung und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Entwicklung der Ereignisse um den Erbreichsplan Kaiser Heinrichs VI. und seinen Motiven für die Errichtung eines Erbreiches. Die Arbeit analysiert das politische und taktische Kalkül des Kaisers bei den Verhandlungen mit den Fürsten und dem Papst und untersucht die wichtigsten Quellen zum Thema.
- Die Quellenlage zum Erbreichsplan
- Der Verlauf der Ereignisse, die zur Verkündung des Erbreichsplanes führten
- Die Motive Heinrichs VI. für die Einführung eines Erbreiches
- Die Analyse der wichtigsten Ergebnisse der Arbeit
- Die Beurteilung des Erfolgs des Plans und die Analyse von Heinrichs Verhandlungstaktik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Heinrich VI. in den historischen Kontext und zeigt seine Bedeutung als bedeutende Figur im Staufergeschlecht, die im Schatten seines Vaters und Sohnes steht. Im ersten Kapitel werden die wichtigsten Quellen zum Erbreichsplan vorgestellt und charakterisiert. Das zweite Kapitel rekonstruiert den genauen Verlauf der Ereignisse, die zur öffentlichen Verkündung des Erbreichsplanes in Würzburg führten und analysiert die relevanten Quellen kritisch. Im dritten Kapitel werden die wichtigsten Beweggründe des Staufers für seine Idee der Einführung der Erbfolge untersucht. Die Arbeit endet mit einem Resümee, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und die Frage nach dem Erfolg des Plans und Heinrichs Verhandlungstaktik beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf den Erbreichsplan Kaiser Heinrichs VI. und beleuchtet die relevanten Quellen, die historische Entwicklung des Plans sowie die Motive des Kaisers. Wichtige Themen sind die politischen Rahmenbedingungen im Reich und in Sizilien, die Opposition der Fürsten und des Papstes, die Verhandlungstaktik des Kaisers und die Bedeutung des Erbreiches für die staufische Herrschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Erbreichsplan Kaiser Heinrichs VI.?
Heinrich VI. versuchte, das bisherige Wahlkönigtum im Heiligen Römischen Reich in eine erbliche Monarchie umzuwandeln, um die staufische Herrschaft dauerhaft zu sichern.
Warum wollte Heinrich VI. das Erbreich einführen?
Seine Motive lagen in der langfristigen Machtsicherung seiner Dynastie und der Stabilisierung der Herrschaft über das weit verzweigte Reich, einschließlich Siziliens.
Wer leistete Widerstand gegen diesen Plan?
Sowohl die geistlichen und weltlichen Fürsten des Reiches als auch Papst Coelestin III. opponierten gegen das Vorhaben.
Welche Rolle spielte Richard Löwenherz in Heinrichs Politik?
Durch die Gefangennahme des englischen Königs Richard Löwenherz konnte Heinrich VI. seine Machtposition stärken und die welfische Opposition im Reich schwächen.
War der Erbreichsplan erfolgreich?
Trotz zäher Verhandlungen und taktischem Kalkül scheiterte der Plan letztlich am Widerstand der Fürsten und des Papstes.
- Arbeit zitieren
- Werner Martin (Autor:in), 2004, Der Erbreichsplan Kaiser Heinrichs VI., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46058