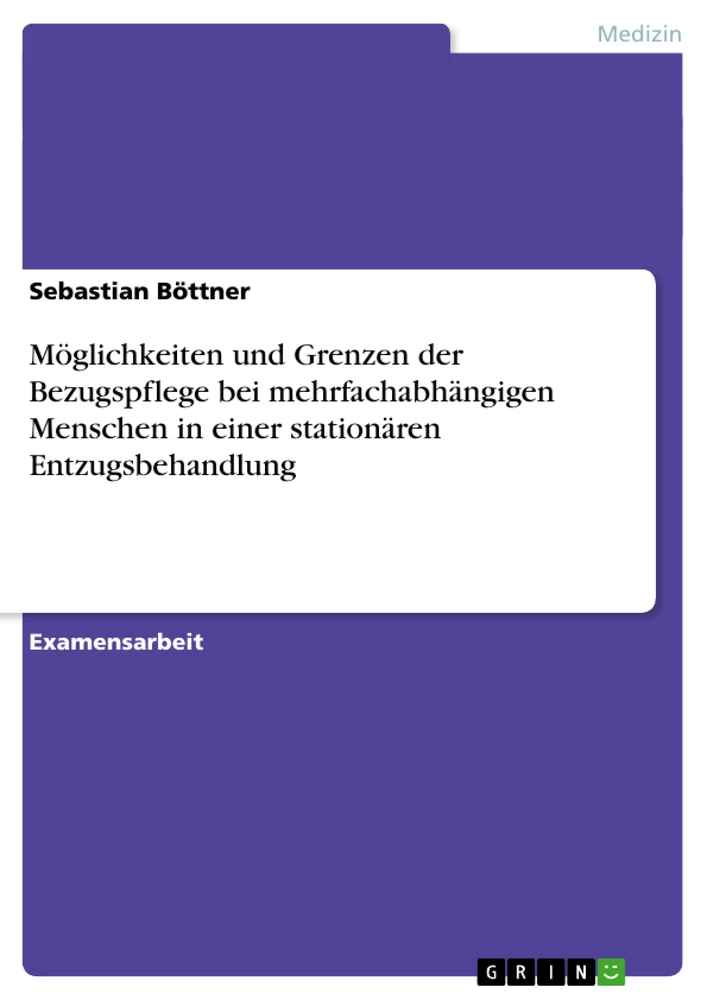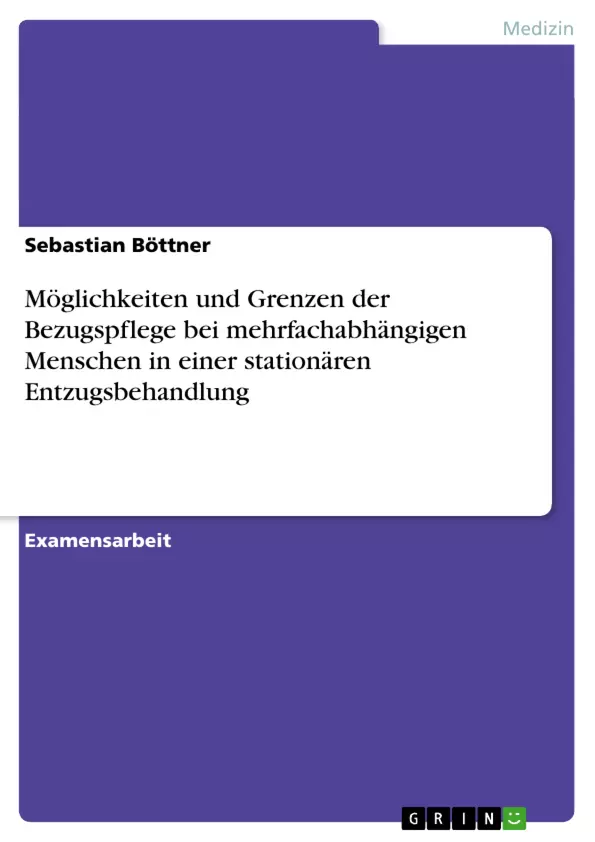Thema der vorliegenden Arbeit ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der Bezugspflege im Alltag einer Station zur qualifizierten Behandlung schwer- und mehrfachabhängiger Menschen zu beleuchten. Ich selber bin seit vier Jahren als examinierter Krankenpfleger auf einer solchen Station tätig. Ein Hauptbestandteil der Entzugsbehandlung von stofflichen Suchtmitteln ist neben der Behandlung der rein körperlichen Entzugssymptomatik, die Beziehungsgestaltung zwischen Behandelndem und Patient. Aufgrund der spezifischen Krankheit und der damit oftmals verbundenen Beziehungsstörung, aber auch aufgrund der erlebten Erfahrungen von Patienten aus dem Drogen- und Gefängnismilieus, fällt es immer wieder außerordentlich schwer, intakte und tragfähige Arbeitsbeziehungen mit dem Patienten aufzunehmen. Während meiner Tätigkeit auf der geschlossenen Aufnahmestation des Suchtbereichs gab die zu leistende Beziehungsarbeit der Pflegekräfte häufig Anlass zu regen Diskussionen. Deutlich wurden dabei die sehr anspruchsvollen und schwierigen Bedingungen der Arbeit mit abhängigkeitserkrankten Menschen. Ein Hilfsmittel zur Gestaltung einer professionellen therapeutischen Beziehung ist das Instrument der Bezugspflege. In der psychiatrischen Krankenpflege ist es während der letzten Jahre in vielen Kliniken fast vollständig gelungen, die psychiatrische Arbeit von der einst praktizierten Funktionspflege auf die Bezugspflege umzustellen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nun, das Instrument der Bezugspflege mit all seinen Möglichkeiten und Grenzen als Hauptbestandteil der Beziehungsgestaltung im Rahmen einer Station für die qualifizierte Behandlung abhängiger Menschen zu untersuchen. Hierzu werden zuerst einmal grundlegende Aspekte der Sucht und Abhängigkeitserkrankung näher beleuchtet. Erläutert werden sowohl historische und gesellschaftliche Inhalte als auch verschiedene Entstehungsmodelle der Substanzabhängigkeit. Im zweiten Teil werden wichtige Grundlagen wie die Definitionen und Inhalte von Pflege, psychiatrischer Pflege und Bezugspflege erklärt und die Pflegetheorie von Hildegard Peplau vorgestellt. Der anschließende dritte Teil stellt die Verknüpfung der ersten beiden Teile dar und beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen von Bezugspflege im Setting einer geschlossenen Station zur Behandlung substanzabhängiger Menschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stoffliche Suchtmittel (Historie, Konsumarten, Wirkungen)
- Kokain
- Hanf
- Heroin
- 1.1 Definitionen
- Missbrauch
- Sucht
- Abhängigkeit
- Opioidentzugssyndrom nach ICD-10
- 1.2 Entstehungskonzepte der Substanzabhängigkeit
- Persönlichkeitspsychologische Konzepte
- Psychiatrische Konzepte
- Psychoanalytische Konzepte
- Sozialpsychologische Konzepte
- Modell der Risikofaktoren
- Das Trias Konzept
- 1.3 Gesellschaftliche Aspekte und psychosoziale Folgen einer Abhängigkeitserkrankung
- Was ist psychiatrische Pflege
- 2.1 Was ist Bezugspflege
- 2.2 Voraussetzungen für die Bezugspflege
- 2.3 Die Psychodynamische Krankenpflege nach Hildegard Peplau als Grundstein der Bezugspflege
- Die vier Phasen der Beziehungsgestaltung
- Die sechs Rollen des Pflegenden
- Möglichkeiten der Bezugspflege im Stationsalltag auf einer Station zur qualifizierten Entzugsbehandlung abhängigkeitserkrankter Menschen
- Grenzen der Bezugspflege im Stationsalltag auf einer Station zur qualifizierten Entzugsbehandlung abhängigkeitserkrankter Menschen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Bezugspflege in einer Station für die qualifizierte Behandlung schwer- und mehrfachabhängiger Menschen. Sie beleuchtet die Bedeutung der Beziehungsgestaltung zwischen Behandelndem und Patient im Rahmen der Entzugsbehandlung von stofflichen Suchtmitteln, insbesondere angesichts der spezifischen Krankheit und der damit verbundenen Beziehungsstörungen.
- Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der Entzugsbehandlung
- Möglichkeiten und Grenzen der Bezugspflege im Kontext von Abhängigkeitserkrankungen
- Einfluss von Suchtmitteln und Abhängigkeit auf die Patient-Therapeut-Beziehung
- Analyse von Entstehungskonzepten der Substanzabhängigkeit
- Anwendung der Pflegetheorie von Hildegard Peplau in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Einblick in das Thema und die Relevanz der Bezugspflege in der Behandlung abhängigkeitserkrankter Menschen. Das erste Kapitel befasst sich mit stofflichen Suchtmitteln, deren Geschichte, Konsumarten und Wirkungen. Verschiedene Begrifflichkeiten wie Sucht, Missbrauch und Abhängigkeit werden definiert und verschiedene Entstehungskonzepte der Substanzabhängigkeit vorgestellt. Das zweite Kapitel erläutert die Grundlagen von Pflege, psychiatrischer Pflege und Bezugspflege und stellt die Pflegetheorie von Hildegard Peplau vor. Das dritte Kapitel beleuchtet die Möglichkeiten der Bezugspflege im Setting einer geschlossenen Station zur Behandlung substanzabhängiger Menschen. Das vierte Kapitel widmet sich den Grenzen der Bezugspflege in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Bezugspflege, Substanzabhängigkeit, Entzugsbehandlung, Mehrfachabhängigkeit, psychiatrische Pflege, Pflegetheorie, Hildegard Peplau, Beziehungsgestaltung, psychosoziale Folgen, Risikofaktoren, Kokain, Hanf, Heroin.
- Quote paper
- Sebastian Böttner (Author), 2005, Möglichkeiten und Grenzen der Bezugspflege bei mehrfachabhängigen Menschen in einer stationären Entzugsbehandlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46017