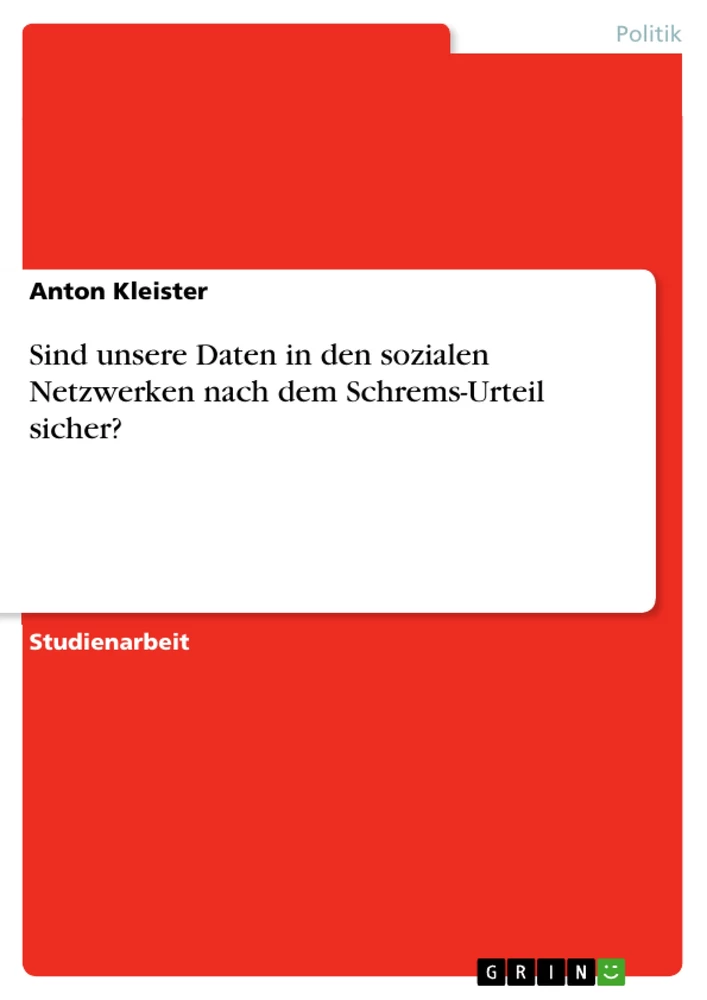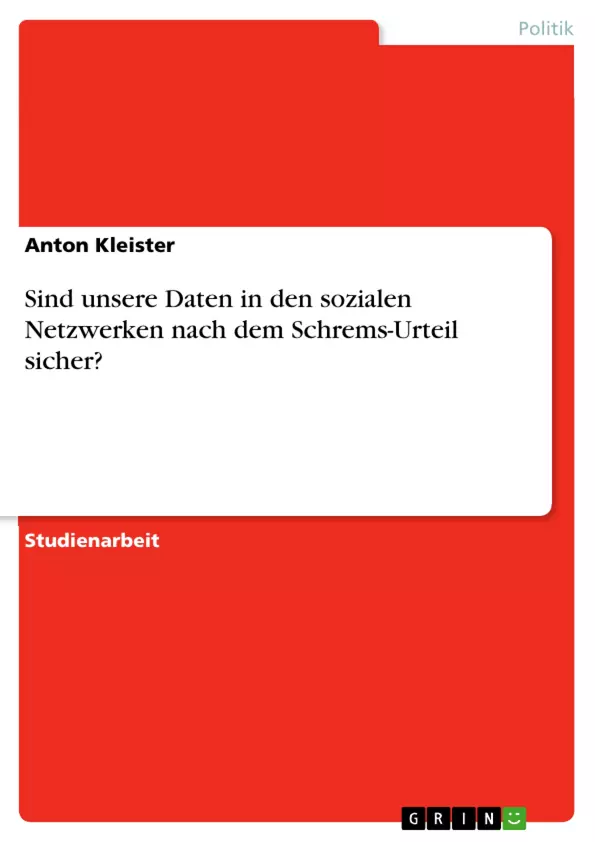Bereits 90 Prozent der 14-jährigen in Deutschland nutzen das Internet. Für mehr als die Hälfte der Internetnutzer sind soziale Netzwerke ein wesentlicher Bestandteil des Onlinegehens, das mit Abstand am meisten genutzte Netzwerk ist dabei Facebook. Der Großteil der Nutzer ist sich nicht bewusst, was dies für ihre Daten bedeutet, weshalb in dieser Arbeit die Problematik der Datensicherheit in sozialen Netzen dargelegt werden soll.
Auch wenn der Begriff Big Data bekannt ist, wissen die wenigsten Internetnutzer genau was dahinter steckt. Soziale Netzwerke sind nicht kostenlos, sie sind allenfalls geldlos. Ihre Nutzung wird in einer anderen Währung abgerechnet, nämlich in der der Daten. Das Internet hat seine eigenen Rohstoffe, die es für Internetkonzerne zu fördern gilt. Facebook lässt seine Nutzer im Dunkeln darüber, dass ihre Daten für immer gespeichert und an Dritte weitergegeben werden. Auch die Erstellung sogenannter Nutzungsprofile und damit in Verbindung stehende personalisierte Werbung und Psychografie ist Praktik. Der Prozess ist intransparent und für den Nutzer nicht nachvollziehbar.
Die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden im Jahr 2013 haben eine politische Debatte über Datenschutz ausgelöst, die mit der Datenaffäre um Facebook und dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung aktuell wieder an Relevanz gewonnen hat. In diesen Kontext ist das Schrems-Urteil, das 2015 vom Gerichtshof der Europäischen Union gesprochen wurde, einzuordnen. In dieser Arbeit werde ich den zugrundeliegenden politischen Konflikt darlegen. Dabei wird beleuchtet, welche Akteure mit welcher Argumentation welche Interessen vertreten.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Um welchen Konflikt handelt es sich?
- Der Konflikt um den Datenschutz
- Die Gruppen und ihre Interessen
- Demokratische Dimensionen
- Der Fall
- Vorgeschichte
- Wie verdichtet sich der gesamtgesellschaftliche Konflikt?
- Akteure
- Positionen & Ressourcen
- Rechtsverfahren und Urteil
- Warum wird vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt?
- In welche Rechtsnorm wird der politische Konflikt übertragen?
- Die Entscheidung und Gründe für das Urteil
- Wie verändert sich der gesellschaftliche Konflikt?
- Nach dem Urteil
- Folgen & Reaktionen
- Hat sich der Diskurs geändert?
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Schrems-Urteil von 2015, das vom Gerichtshof der Europäischen Union gesprochen wurde. Ziel ist es, den politischen Konflikt und die Debatten zu beleuchten, die hinter diesem Urteil stehen. Darüber hinaus werden die beteiligten Akteure und ihre Interessen sowie die Verdichtung des Konflikts in der rechtlichen Arena untersucht. Die Folgen und Reaktionen nach dem Urteil werden ebenfalls analysiert, um schließlich ein Fazit zu ziehen.
- Datenschutzrecht und seine Herausforderungen in der digitalen Welt
- Interessenkonflikt zwischen Datensicherheit und Datennutzung
- Die Rolle von Akteuren wie Facebook, Behörden und NGOs
- Das Schrems-Urteil als Meilenstein im Datenschutzrecht
- Folgen und Reaktionen auf das Schrems-Urteil
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung des Internets und die zunehmenden Datenmengen, die im digitalen Raum gesammelt werden. Sie stellt die Problematik der Datenverarbeitung und des Datenschutzes im Kontext sozialer Netzwerke und der Big-Data-Industrie dar.
Kapitel 2 beleuchtet den Konflikt um den Datenschutz im Allgemeinen und die verschiedenen Interessen, die im Spiel sind. Es werden auch die demokratischen Dimensionen des Datenschutzes diskutiert.
Kapitel 3 befasst sich mit dem konkreten Fall, der zum Schrems-Urteil geführt hat. Es wird die Vorgeschichte des Falls, die beteiligten Akteure und ihre Positionen sowie die Verdichtung des Konflikts in der gesellschaftlichen und rechtlichen Arena behandelt.
Kapitel 4 widmet sich dem Rechtsverfahren und dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Es wird erläutert, warum der Fall vor dem EuGH verhandelt wurde und in welche Rechtsnorm der politische Konflikt übertragen wurde. Die Entscheidung des Gerichtshofs und die Begründung für das Urteil werden ebenfalls dargelegt.
Kapitel 5 analysiert die Folgen und Reaktionen auf das Schrems-Urteil und betrachtet, ob sich der öffentliche Diskurs zum Datenschutz verändert hat.
Schlüsselwörter
Datenschutz, Schrems-Urteil, Europäischer Gerichtshof, Facebook, Big Data, Datensicherheit, Datennutzung, Interessenkonflikt, Akteure, Folgen, Reaktionen, öffentlicher Diskurs.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern des Schrems-Urteils von 2015?
Der EuGH erklärte das "Safe Harbor"-Abkommen für ungültig, da der Datenschutz in den USA nicht den EU-Standards entsprach.
Wer ist Max Schrems?
Ein österreichischer Jurist und Aktivist, der gegen Facebook klagte, weil seine Daten in den USA nicht ausreichend vor Zugriffen durch Geheimdienste geschützt waren.
Was bedeutet 'Big Data' im Kontext sozialer Netzwerke?
Soziale Netzwerke sammeln riesige Datenmengen, um Nutzungsprofile zu erstellen und personalisierte Werbung oder Psychografie zu betreiben.
Sind unsere Daten nach dem Urteil sicher?
Die Arbeit untersucht die Folgen des Urteils und zeigt auf, dass der Konflikt zwischen Datensicherheit und ökonomischen Interessen weiterhin besteht.
Welche Rolle spielten die Enthüllungen von Edward Snowden?
Snowdens Enthüllungen im Jahr 2013 waren der Auslöser für die Debatte über Massenüberwachung und führten letztlich zum Rechtsstreit von Max Schrems.
- Quote paper
- Anton Kleister (Author), 2018, Sind unsere Daten in den sozialen Netzwerken nach dem Schrems-Urteil sicher?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459786