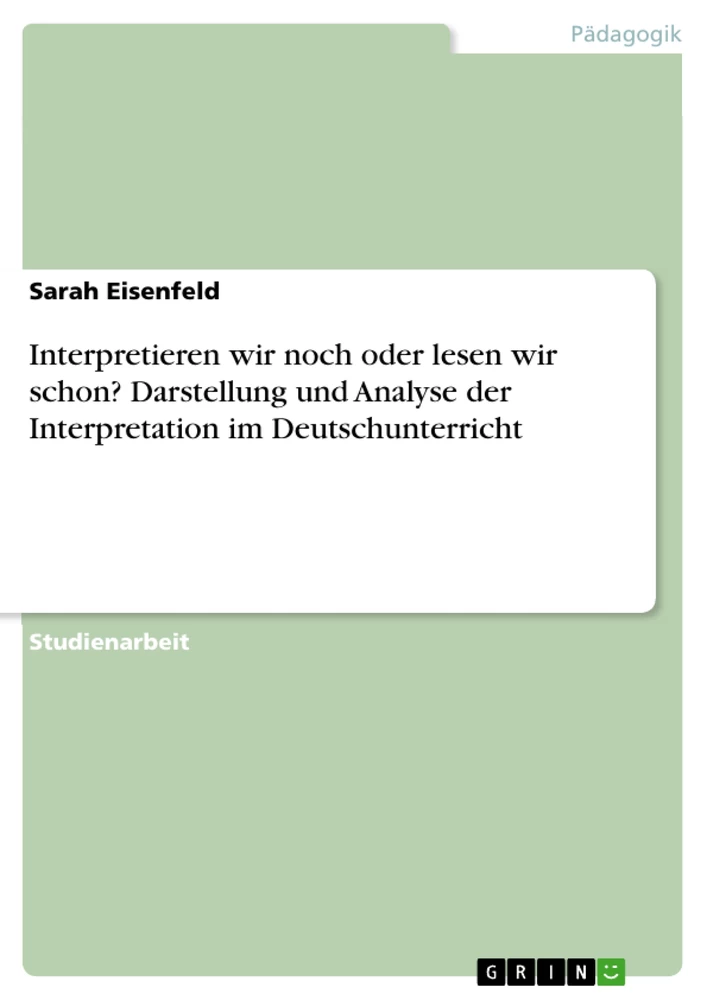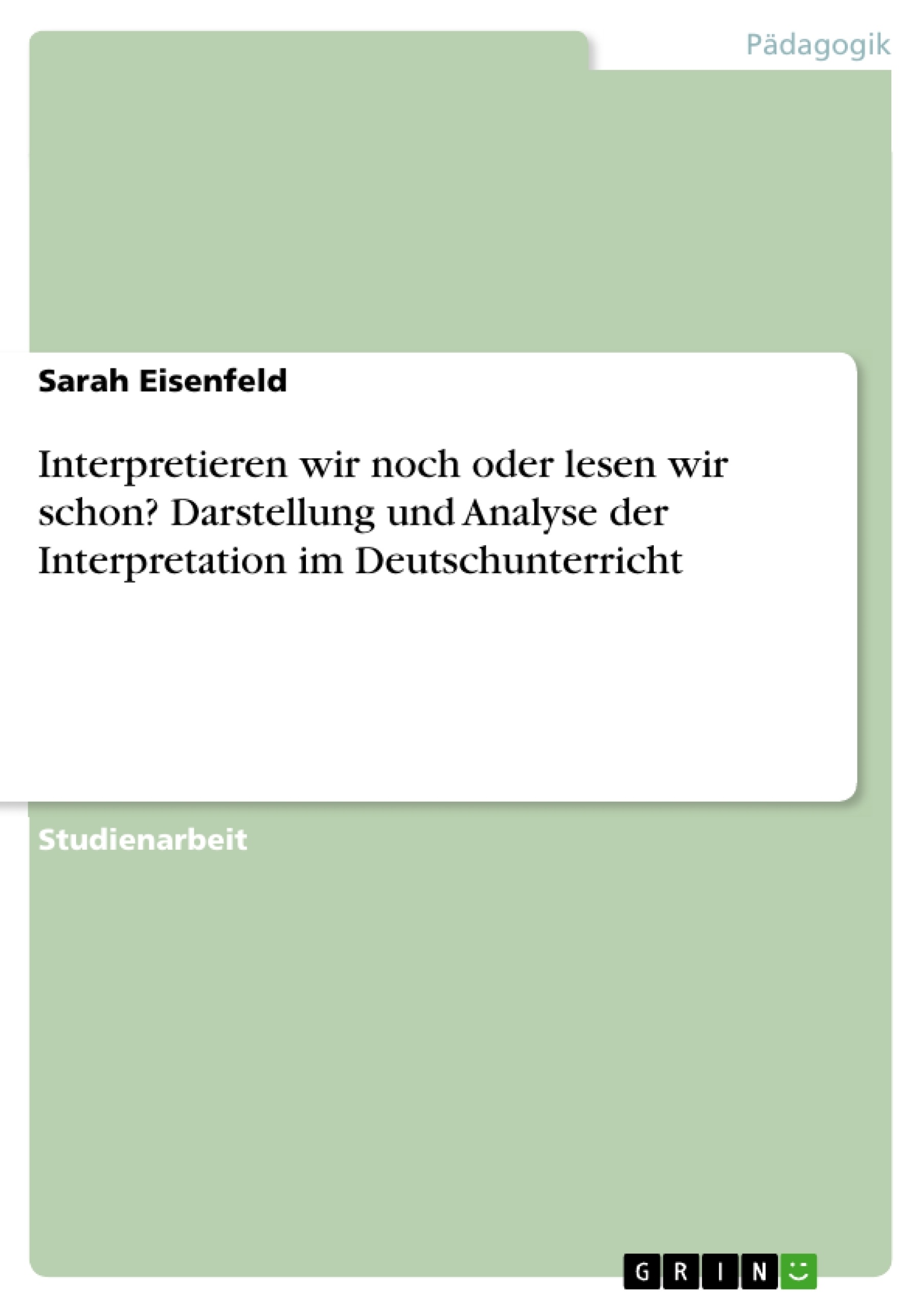Diese Arbeit befasst sich zu Beginn mit der literaturdidaktischen Entwicklung der Interpretation, mit dem Aufkommen und dem ständigen Wechsel praxisbezogener Modelle und der theoretischen Didaktik. Anschließend folgt die Darstellung zwei verschiedener Ansätze zum Umgang mit Literatur im Deutschunterricht. Der Vergleich der beiden kontrastierenden methodischen Ansätze in Hinblick auf die Frage nach dem Zweck des gegenwärtigen Literaturunterrichts ist Motivation und Fragestellung dieser Arbeit.
Überlegungen zur Beantwortung der gestellten Fragen schließen diese Arbeit ab. Die Darstellung der literaturdidaktischen Entwicklung der Interpretation ist zum Zweck der Arbeit verkürzt worden. Darüber hinaus kann auf weitere Konzepte der literaturdidaktischen Bildung im Rahmen dieser Hausarbeit nicht eingegangen werden, da dies den Rahmen des Themas sprengen würde.
Die Frage: “Was will uns der Autor damit sagen”, wird im gegenwärtigen schulischen Lektüreverfahren immer noch gestellt. Der gegenwärtige Deutschunterricht geht also davon aus, dass die Befassung mit der Autorintention ein essentieller Faktor ist. Die Frage nach der Intention des Autors soll Lehrreiches zum Vorschein bringen, es soll sich lohnen die bedeutungsschweren Aussagen zu interpretieren. Einer, der meint, dass die im Deutschunterricht behandelte Literatur entbehrlich sei für das, worauf es im wirklichen Leben ankommt, wird sich im gegenwärtigen Literaturunterricht schwer tun.
Kaspar H. Spinner bezeichnet in seinem Essay Interpretieren im Deutschunterricht von 1987 die klassische Frage nach der Autorintention als irreführend: Sie setzt voraus, dass wir Kriterien haben, um eine Autorintention nachzuweisen. Spinner schlägt vor, die Frage nach der Autorintention umzuformulieren um bei der Interpretation im Deutschunterricht die Diskrepanz zwischen nachweisbarer Autorintention und ablesbaren Textaussagen deutlich zu halten. Kritik und Zweifel an der Interpretation im Deutschunterricht ist in literaturtheoretischen Entwicklungen keinesfalls neu.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. LITERATURDIDAKTISCHE ENTWICKLUNG DER INTERPRETATION
- 2.1 LESERORIENTIERTER UMGANG MIT TEXTEN
- 3. ZWEI ARTEN VON LESEN
- 3.1 DAS INTERPRETIERENDE LESEN
- 3.2 DAS INDIVIDUELLE LESEN
- 4. ZIELE DES LITERATURUNTERRICHTS
- 4.1 TEXTKOMPETENZ
- 4.2 DIE LESEFREUDE
- 5. FAZIT
- 6. QUELLENANGABEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle der Interpretation im heutigen Deutschunterricht. Sie analysiert die Entwicklung des leserorientierten Ansatzes und betrachtet die Auswirkungen auf den Umgang mit Literatur in der Praxis. Die Arbeit stellt zwei verschiedene Ansätze zum Umgang mit Literatur im Deutschunterricht vor: das interpretierende und das individuelle Lesen. Sie untersucht die Ziele des Literaturunterrichts und beleuchtet, wie sich diese Ziele durch die unterschiedlichen Ansätze erreichen lassen.
- Die Entwicklung der literaturdidaktischen Interpretation
- Die Auswirkungen des leserorientierten Ansatzes auf den Deutschunterricht
- Der Vergleich zwischen interpretierendem und individuellem Lesen
- Die Ziele des Literaturunterrichts: Textkompetenz und Lesefreude
- Die Rolle der Autorintention im heutigen Literaturunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Rolle der Interpretation im heutigen Literaturunterricht. Sie stellt die Frage, ob die Interpretation im Deutschunterricht noch relevant ist oder ob ein freies Lesen mehr Raum einnehmen sollte.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der literaturdidaktischen Entwicklung der Interpretation und beleuchtet den Wandel von der klassischen Interpretation zur Lesererfahrung. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze zum Umgang mit Texten im Deutschunterricht vorgestellt.
Im dritten Kapitel werden zwei verschiedene Ansätze zum Umgang mit Literatur im Deutschunterricht vorgestellt: das interpretierende Lesen und das individuelle Lesen. Diese werden hinsichtlich ihrer methodischen Ansätze und ihrer Ziele miteinander verglichen.
Das vierte Kapitel behandelt die Ziele des Literaturunterrichts. Dabei geht es um die Förderung der Textkompetenz und der Lesefreude. Die Arbeit untersucht, wie sich die beiden verschiedenen Ansätze auf diese Ziele auswirken.
Schlüsselwörter
Interpretation, Deutschunterricht, Literaturdidaktik, Leserorientierung, Textkompetenz, Lesefreude, Autorintention, freies Lesen, interpretierendes Lesen, individuelles Lesen.
Häufig gestellte Fragen
Warum steht die klassische Interpretation im Deutschunterricht in der Kritik?
Kritiker wie Kaspar H. Spinner bemängeln, dass die Frage nach der "Autorintention" oft irreführend ist, da es kaum objektive Kriterien gibt, diese zweifelsfrei nachzuweisen.
Was ist der Unterschied zwischen interpretierendem und individuellem Lesen?
Interpretierendes Lesen sucht nach tieferen, oft vom Lehrer vorgegebenen Bedeutungen, während individuelles Lesen die persönliche Erfahrung und Lesefreude des Schülers in den Vordergrund stellt.
Welche Ziele verfolgt der moderne Literaturunterricht?
Zentral sind die Förderung der Textkompetenz (Fähigkeit, Texte zu verstehen und zu analysieren) und der Erhalt der Lesefreude.
Was bedeutet "leserorientierter Umgang mit Texten"?
Dieser didaktische Ansatz stellt die Reaktion und die subjektive Wahrnehmung des Lesers in den Mittelpunkt, statt nur eine "richtige" Deutung des Textes zu suchen.
Ist die Frage "Was will uns der Autor sagen" noch zeitgemäß?
Obwohl sie in der Schulpraxis noch häufig vorkommt, plädieren moderne Konzepte dafür, sie umzuformulieren, um die Diskrepanz zwischen Textaussage und vermuteter Absicht deutlicher zu machen.
- Quote paper
- Sarah Eisenfeld (Author), 2018, Interpretieren wir noch oder lesen wir schon? Darstellung und Analyse der Interpretation im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459662