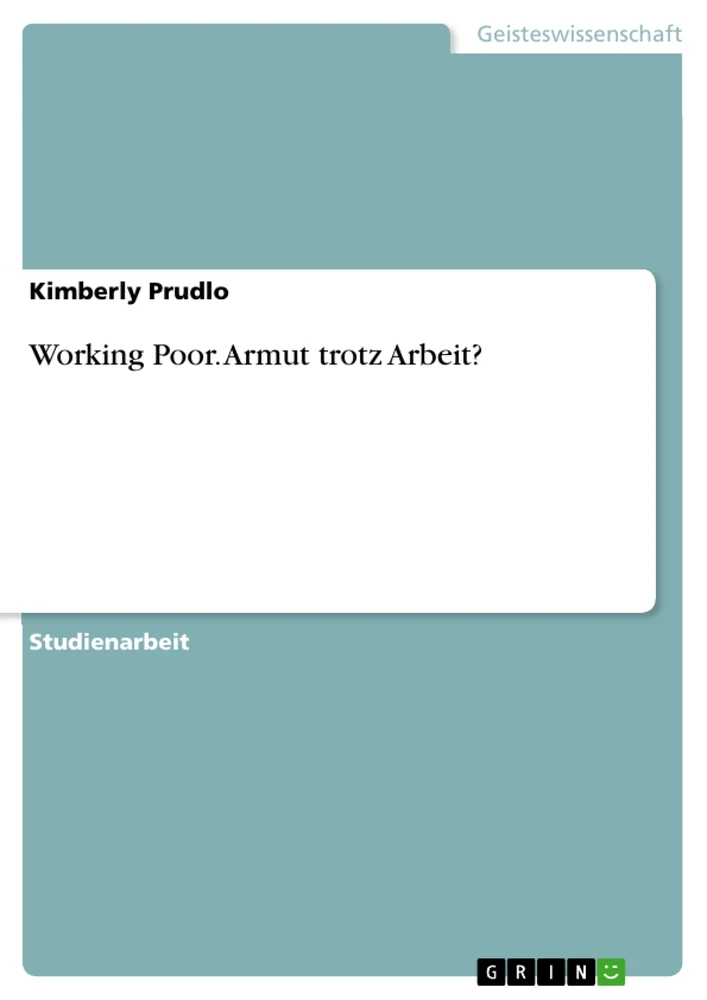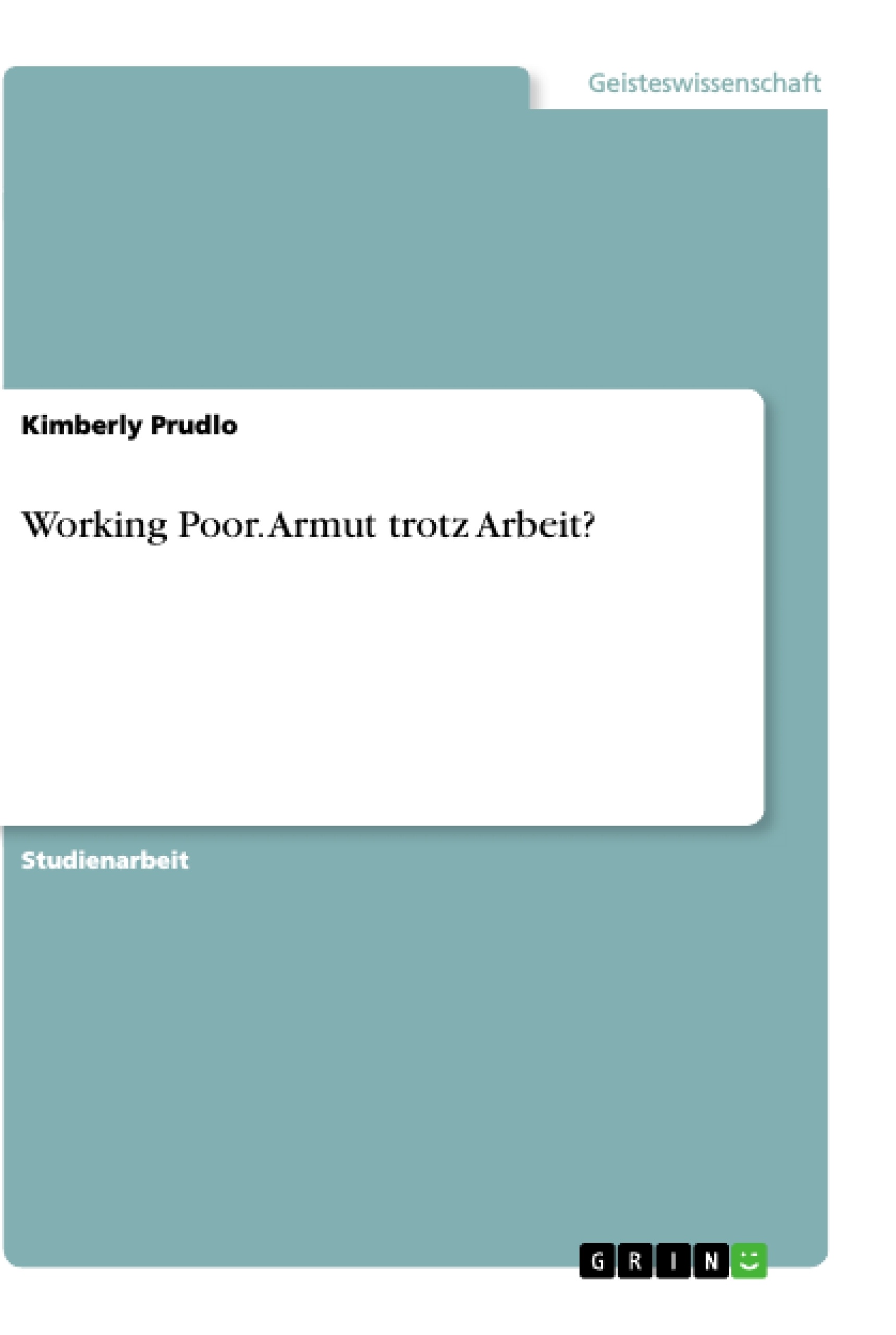Mehr Arbeit scheint keine Garantie für weniger Armut zu sein. Wie konnte es dazu kommen, dass die Arbeit nicht mehr vor Armut schützt? Wer sind die Betroffenen? Welche sozialen Konsequenzen bringt das mit sich und welche Lösungen gibt es? Ziel dieser Arbeit ist es die wichtigsten Fragen zu klären.
Seit 2014 sind die Beschäftigungszahlen in Deutschland kräftig gewachsen. Damit nimmt auch die Arbeitslosenquote immer weiter ab. Auch die Wirtschaft in Deutschland boomt seit langem. Doch trotz dieser wirtschaftlichen Spitzenwerte leben in Deutschland immer mehr Menschen an der Armutsgrenze. Die Betroffenen sind schon lange nicht mehr nur Erwerbslose. Immer mehr Erwerbstätige leben zunehmend an der Grenze der Armut oder sogar darunter, Tendenz steigend. Die Erwerbsarmut ist vor allem aus den USA bekannt, doch auch in Deutschland ist dieses Phänomen schon lange nicht mehr unbekannt.
Inhaltsverzeichnis
- Erwerbsarmut in Deutschland
- Abgrenzung des Armutsbegriffs und Erläuterung verwendeter Quellen
- Die wichtigsten Datenquellen
- Der Mikrozensus
- Das Sozio-Ökonomische Panel (SOEP)
- Der Armutsbegriff
- Begriffserklärung „Working Poor“
- Die wichtigsten Datenquellen
- Ursachen von Armut trotz Erwerbstätigkeit
- Die Betroffenen
- Maßnahmen in der Politik gegen Armut
- Helfen Mindestlohn und bedingungsloses Grundeinkommen?
- Aktivierungspolitik gegen Erwerbsarmut?
- Fazit und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Erwerbsarmut in Deutschland. Sie klärt die wichtigsten Begrifflichkeiten, analysiert die Ursachen von Armut trotz Erwerbstätigkeit, und beleuchtet politische Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Problems. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und den Auswirkungen von Erwerbsarmut in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern.
- Definition und Abgrenzung des Armutsbegriffs
- Ursachen von Erwerbsarmut in Deutschland
- Auswirkungen von Erwerbsarmut auf die Betroffenen
- Analyse bestehender politischer Maßnahmen
- Diskussion möglicher Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Erwerbsarmut in Deutschland: Das Kapitel beschreibt den Anstieg der Erwerbsarmut in Deutschland trotz des Wirtschaftswachstums und steigender Beschäftigungszahlen. Es wird der deutliche Anstieg der Erwerbsarmut in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern hervorgehoben und die Diskrepanz zwischen Wirtschaftswachstum und Armutsentwicklung beleuchtet. Es wird die zentrale Forschungsfrage formuliert: Wie kann es sein, dass Arbeit nicht mehr vor Armut schützt? Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Untersuchung der Thematik.
2. Abgrenzung des Armutsbegriffs und Erläuterung verwendeter Quellen: Dieses Kapitel definiert den verwendeten Armutsbegriff, basierend auf der Definition von Wolfgang Strengmann-Kuhn, und beschreibt die verwendeten Datenquellen: den Mikrozensus und das Sozio-Ökonomische Panel (SOEP). Es werden die Vor- und Nachteile beider Datenquellen im Detail erläutert, insbesondere hinsichtlich der Genauigkeit der Armutsberechnung und der Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Die Unterschiede in der Datengewinnung und deren Auswirkungen auf die Armutsquoten werden klar herausgestellt.
3. Ursachen von Armut trotz Erwerbstätigkeit: Dieses Kapitel geht auf die Ursachen von Erwerbsarmut ein und stellt die betroffenen Personengruppen vor (ohne konkrete Zahlen oder demographische Details). Es wird analysiert, warum trotz Beschäftigung ein Einkommensniveau unter der Armutsgrenze erreicht wird. Das Kapitel legt die Grundlage für die Diskussion von Lösungsansätzen in den folgenden Kapiteln.
4. Maßnahmen in der Politik gegen Armut: Das Kapitel beleuchtet bestehende politische Maßnahmen zur Bekämpfung der Erwerbsarmut, insbesondere die Rolle von Mindestlohn und bedingungslosem Grundeinkommen. Die Wirksamkeit der Aktivierungspolitik im Kontext von Erwerbsarmut wird kritisch hinterfragt. Es werden verschiedene Ansätze der Sozialpolitik diskutiert und deren Potenzial zur Reduktion von Erwerbsarmut bewertet.
Schlüsselwörter
Erwerbsarmut, Armut, Deutschland, Working Poor, Mikrozensus, SOEP, Mindestlohn, bedingungsloses Grundeinkommen, Aktivierungspolitik, Sozialpolitik, Armutsbegriff, Äquivalenzeinkommen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Erwerbsarmut in Deutschland"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Erwerbsarmut in Deutschland. Sie beleuchtet die Ursachen von Armut trotz Erwerbstätigkeit, analysiert die Auswirkungen auf Betroffene und bewertet politische Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Problems. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich der Situation in Deutschland mit anderen EU-Ländern.
Welche Datenquellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Daten des Mikrozensus und des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP). Die Vor- und Nachteile beider Quellen bezüglich der Genauigkeit der Armutsberechnung und der Vergleichbarkeit der Ergebnisse werden detailliert erläutert.
Wie wird der Begriff "Armut" definiert?
Die Arbeit verwendet eine spezifische Definition des Armutsbegriffs, basierend auf der Definition von Wolfgang Strengmann-Kuhn. Die genaue Definition wird im Kapitel zur Abgrenzung des Armutsbegriffs erläutert.
Welche Ursachen für Erwerbsarmut werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Ursachen, warum trotz Beschäftigung ein Einkommensniveau unter der Armutsgrenze erreicht wird. Konkrete Personengruppen, die von Erwerbsarmut betroffen sind, werden vorgestellt, jedoch ohne genaue Zahlen oder demografische Details.
Welche politischen Maßnahmen werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet politische Maßnahmen zur Bekämpfung der Erwerbsarmut, insbesondere Mindestlohn, bedingungsloses Grundeinkommen und Aktivierungspolitik. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird kritisch hinterfragt und deren Potenzial zur Reduktion von Erwerbsarmut bewertet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Erwerbsarmut in Deutschland; Abgrenzung des Armutsbegriffs und Erläuterung verwendeter Quellen; Ursachen von Armut trotz Erwerbstätigkeit; Maßnahmen in der Politik gegen Armut; und Fazit und Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erwerbsarmut, Armut, Deutschland, Working Poor, Mikrozensus, SOEP, Mindestlohn, bedingungsloses Grundeinkommen, Aktivierungspolitik, Sozialpolitik, Armutsbegriff, Äquivalenzeinkommen.
Wie wird der Vergleich zu anderen EU-Ländern vorgenommen?
Die Arbeit hebt den deutlichen Anstieg der Erwerbsarmut in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern hervor und beleuchtet die Diskrepanz zwischen Wirtschaftswachstum und Armutsentwicklung. Ein detaillierter Ländervergleich wird jedoch nicht explizit erwähnt.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie kann es sein, dass Arbeit nicht mehr vor Armut schützt?
- Quote paper
- Kimberly Prudlo (Author), 2018, Working Poor. Armut trotz Arbeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459283