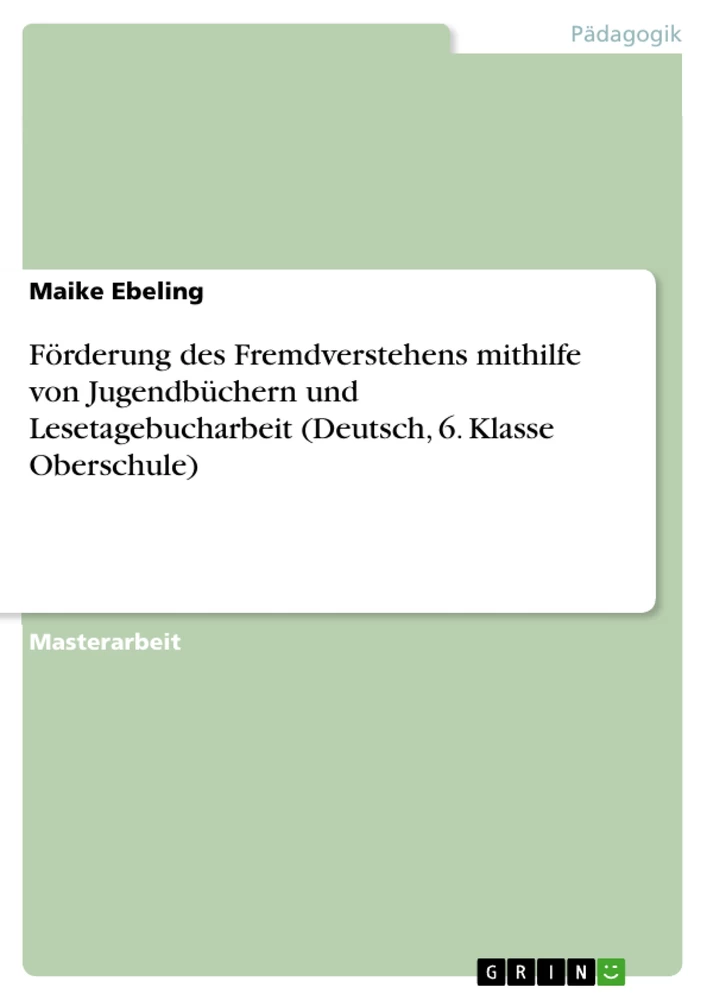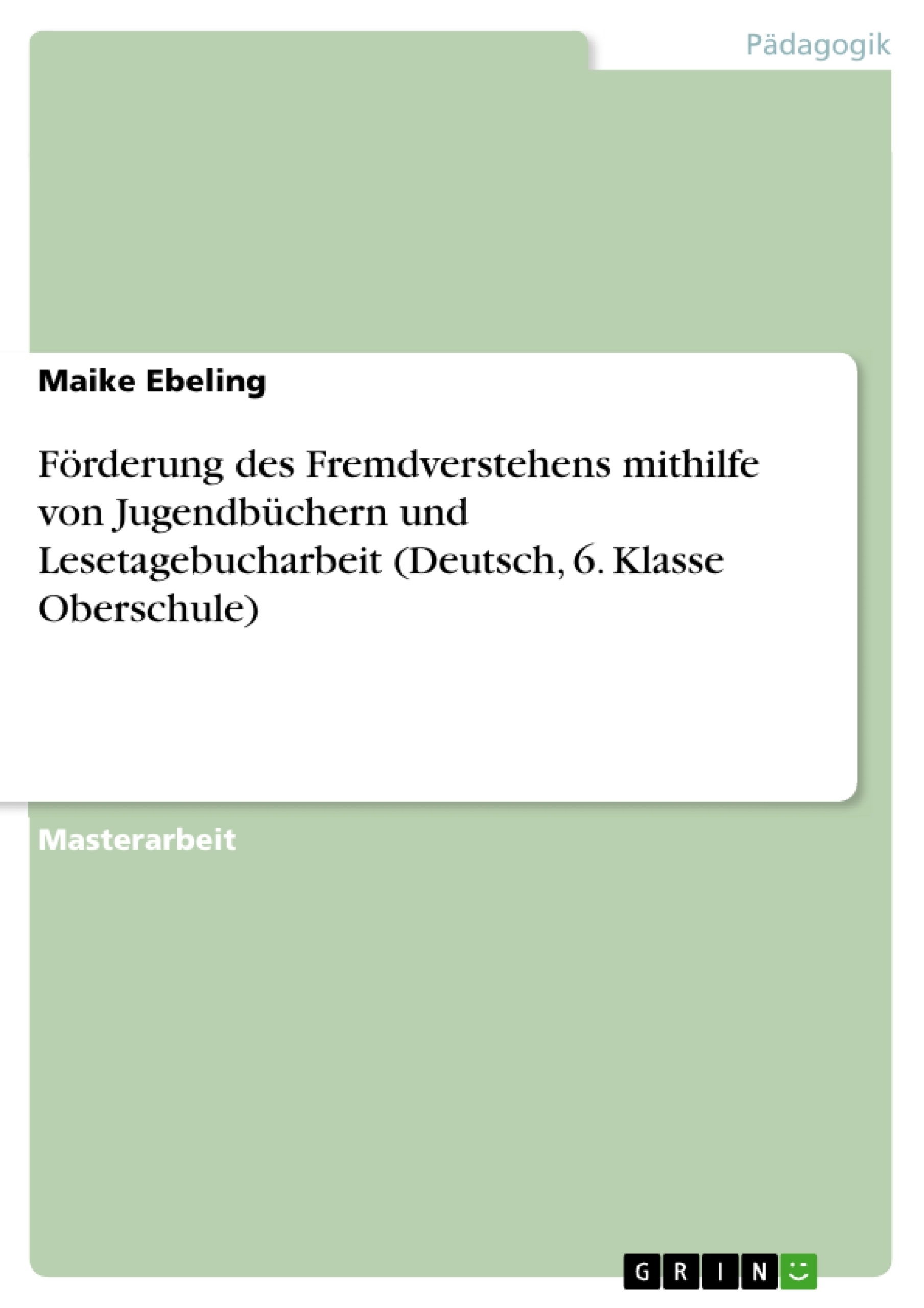Können Schüler und Schülerinnen bei dem Lesen eines Jugendbuches ebenso emotional betroffen sein wie in realen Situationen? Kann die Literatur eine Welt entstehen lassen, die die Protagonisten so authentisch werden lässt, dass der Leser gemeinsam mit den Figuren fühlt, denkt und erlebt? Ist das Medium Buch geeignet den Schülern einen Raum für die Persönlichkeitsentwicklung bieten? Können Schüler sich mithilfe eines Lesetagebuches so intensiv mit einem Buch auseinandersetzen, dass eine Entwicklung des Fremdverstehens entsteht?
Die letzte Frage ist zentral für diese Arbeit. Zunächst ergeben sich jedoch drei Schwerpunkte, die miteinander verbunden werden sollen: Fremdverstehen, Jugendbücher und Lesetagebucharbeit. Um die Fragestellung beantworten zu können, wird ein Leseprojekt, welches in einem sechsten Schuljahr durchgeführt wurde, im Mittelpunkt stehen.
Die Arbeit enthält umfangreiches Arbeitsmaterial sowie Auszüge aus den erarbeiteten Lesetagebüchern. Folgende Bücher standen den Schülern zur Auswahl: „Disteltage“ von Renate Welsh, „Das Adoptivzimmer oder: Gefangen im Reich des Namenlosen“ von Antonia Michaelis sowie „Glück mit Soße“ von Sharon Creech.
Ausgehend von der Persönlichkeitsentwicklung als Bildungsauftrag der Schule soll dargelegt werden, inwieweit das Fremdverstehen in den Richtlinien verankert ist. Anschließend wird der Fokus auf das Fremdverstehen als eine Facette der Persönlichkeitsentwicklung gelegt. Im dritten Kapitel wird eine Begriffsdefinition erfolgen, die vor allem den Zusammenhang von Fremdverstehen mit der Identität aufzeigen wird. Im vierten Kapitel soll die Entwicklung des Fremdverstehens in Verbindung mit dem literaturdidaktischen Kontext betrachtet werden.
Da im Zentrum der Überlegungen zu dieser Arbeit die Kinder- und Jugendliteratur steht, wird diese im fünften Kapitel in den Blick genommen. Zunächst wird darlegt, auf welche Weise KJL im Deutschunterricht eingesetzt werden kann und auch was für den Einsatz dieser spricht. Im Zuge dessen wird auch erläutert, inwiefern die KJL für die Förderung des Fremdverstehens geeignet ist und welche möglichen Vorteile bei einem Einsatz dieser bestehen.
Das sechste Kapitel erläutert die Methode des Lesetagebuchs, speziell des freien Lesetagebuchs und schließt den theoretischen Teil ab. In diesem Kapitel erfolgen die Projektplanung und die Beschreibung des Projektverlaufs. Im darauffolgenden achten Kapitel erfolgt die quantitative Erfassung sowie qualitative Analyse der Lesetagebücher.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Persönlichkeitsentwicklung als Bildungsauftrag der Schule
- 3. Fremdverstehen
- 4. Fremdverstehen im literaturdidaktischen Kontext
- 4.1 Lesen im Deutschunterricht
- 4.2 Emotionale Prozesse im Deutschunterricht
- 4.3 Literarische Texte und ihr persönlichkeitsförderndes Potential
- 4.4 Fremdverstehen und literarisches Lernen
- 5. Fremdverstehen mit Kinder- und Jugendliteratur
- 5.1 Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht
- 5.2 Einsatz der Kinder- und Jugendliteratur zur Förderung des Fremdverstehens
- 5.3 Didaktische Begründung der Auswahl für das Lese-Projekt
- 5.2.1 „Stille Tage“ von Renate Welsh
- 5.2.2 „Das Adoptivzimmer oder: Gefangen im Reich des Namenlosen“ von Antonia Michaelis
- 5.2.3 „Glück mit Soße“ von Sharon Creech
- 6. Das Lesetagebuch im Deutschunterricht
- 6.1 Das freie Lesetagebuch
- 6.2 Unterstützung des Fremdverstehens mit Lesetagebuch-Arbeit
- 7. Das Lese-Projekt in der 6. Klasse
- 7.1 Klassenvorstellung
- 7.2 Planung des Lese-Projektes
- 7.3 Beschreibung des Arbeitsmaterials
- 7.4 Beschreibung des Projektverlaufs
- 8. Auswertung und Analyse der Lesetagebücher
- 8.1 Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens
- 8.2 Zielbeschreibung der Auswertung
- 8.3 Quantitative Erfassung der Inhalte
- 8.4 Qualitative Analyse der Lesetagebücher
- 8.5 Analyse der Lesetagebücher
- 8.5.1 Lesetagebuch
- 8.5.2 Lesetagebuch
- 8.5.3 Lesetagebuch
- 8.5.4 Lesetagebuch
- 8.5.5 Lesetagebuch
- 8.5.6 Lesetagebuch
- 9. Auswertung der Ergebnisse
- 10. Fazit/ Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit die Förderung des Fremdverstehens bei Schülern durch den Einsatz von Jugendliteratur und Lesetagebuch-Arbeit im Deutschunterricht möglich ist. Ein konkretes Lese-Projekt in einer sechsten Klasse dient als empirische Grundlage. Die Ergebnisse werden quantitativ und qualitativ ausgewertet und im Hinblick auf die Forschungsfrage interpretiert.
- Fremdverstehen als zentrale Kompetenz
- Rollen von Jugendliteratur im Deutschunterricht
- Methodische Möglichkeiten der Lesetagebuch-Arbeit
- Analyse emotionaler Prozesse beim Lesen
- Perspektivübernahme in literarischen Texten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Entwicklung des Fremdverstehens durch den Einsatz von Jugendliteratur und Lesetagebüchern in einem sechsten Schuljahr in den Mittelpunkt. Drei Schwerpunkte werden definiert: Fremdverstehen, Jugendliteratur und Lesetagebuch-Arbeit. Ein durchgeführtes Lese-Projekt dient als empirische Grundlage.
2. Persönlichkeitsentwicklung als Aufgabe der Schule: Dieses Kapitel zeigt die Verankerung der Persönlichkeitsentwicklung im Bildungsauftrag der Schule auf, wobei der Fokus auf Fremdverstehen als Facette der Persönlichkeitsentwicklung gelegt wird. Es wird beleuchtet, wie das Fremdverstehen in den Richtlinien verankert ist und welche Bedeutung ihm in der heutigen Gesellschaft zukommt.
3. Fremdverstehen: Das Kapitel definiert den Begriff des Fremdverstehens und zeigt dessen enge Verbindung zur Identität. Es wird erläutert, dass Fremdverstehen ein relationaler Begriff ist und sich in seiner Komplexität unterscheidet. Der Prozess des Fremdverstehens nach Alfred Schütz wird beschrieben.
4. Fremdverstehen im literaturdidaktischen Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Fremdverstehens in Verbindung mit dem literaturdidaktischen Kontext. Es wird die Rolle des Lesens im Deutschunterricht und die Bedeutung emotionaler Prozesse beim Lesen untersucht. Das persönlichkeitsfördernde Potential literarischer Texte und der Beitrag des literarischen Lernens zum Fremdverstehen werden behandelt.
5. Fremdverstehen mit Kinder- und Jugendliteratur: Das Kapitel untersucht den Einsatz von Kinder- und Jugendliteratur (KJL) im Deutschunterricht. Es werden die Vorteile des Einsatzes von KJL zur Förderung des Fremdverstehens erörtert und die Auswahl der für das Lese-Projekt gewählten Bücher begründet. Der Inhalt der ausgewählten Werke wird kurz zusammengefasst.
6. Das Lesetagebuch im Deutschunterricht: Das Kapitel erläutert die Methode des Lesetagebuchs, insbesondere des freien Lesetagebuchs, und dessen Beitrag zur Unterstützung des Fremdverstehens. Es wird herausgestellt, wie die Lesetagebuch-Arbeit das Fremdverstehen unterstützen kann.
7. Das Lese-Projekt in der 6. Klasse: Dieses Kapitel beschreibt das durchgeführte Lese-Projekt, einschließlich Klassenvorstellung, Projektplanung, Beschreibung des Arbeitsmaterials und des Projektverlaufs.
8. Auswertung und Analyse der Lesetagebücher: Dieses Kapitel beschreibt die quantitative und qualitative Analyse der im Projekt entstandenen Lesetagebücher. Das methodische Vorgehen wird erläutert, die Ergebnisse werden präsentiert und im Hinblick auf die Forschungsfrage interpretiert.
Schlüsselwörter
Fremdverstehen, Kinder- und Jugendliteratur, Lesetagebuch, Deutschunterricht, Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Prozesse, Perspektivübernahme, Empathie, Imagination, Identität, Literaturdidaktik, qualitative Inhaltsanalyse, quantitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Förderung des Fremdverstehens durch Jugendliteratur und Lesetagebücher
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie effektiv Jugendliteratur und Lesetagebücher im Deutschunterricht zur Förderung des Fremdverstehens bei Schülern eingesetzt werden können. Ein konkretes Lese-Projekt in einer sechsten Klasse dient als empirische Grundlage.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet ein Lese-Projekt in einer sechsten Klasse. Die Daten werden sowohl quantitativ als auch qualitativ (durch qualitative und quantitative Inhaltsanalyse der Lesetagebücher) ausgewertet.
Welche Literatur wurde im Lese-Projekt verwendet?
Die im Lese-Projekt verwendeten Bücher sind: „Stille Tage“ von Renate Welsh, „Das Adoptivzimmer oder: Gefangen im Reich des Namenlosen“ von Antonia Michaelis und „Glück mit Soße“ von Sharon Creech.
Was ist der methodische Ansatz der Lesetagebuch-Arbeit?
Es wird hauptsächlich mit freien Lesetagebüchern gearbeitet. Die Arbeit erläutert, wie diese die Unterstützung des Fremdverstehens fördern können.
Wie wird das Fremdverstehen definiert?
Fremdverstehen wird als relationaler Begriff definiert, der eng mit Identität verbunden ist und dessen Komplexität hervorgehoben wird. Der Prozess des Fremdverstehens nach Alfred Schütz wird beschrieben.
Welche Rolle spielt die Persönlichkeitsentwicklung?
Die Arbeit verankert die Förderung des Fremdverstehens im Bildungsauftrag der Schule und betont seine Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, Persönlichkeitsentwicklung, Fremdverstehen, Fremdverstehen im literaturdidaktischen Kontext, Fremdverstehen mit Kinder- und Jugendliteratur, dem Lesetagebuch im Deutschunterricht, dem Lese-Projekt in der 6. Klasse, der Auswertung und Analyse der Lesetagebücher, der Auswertung der Ergebnisse und einem Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel wird detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fremdverstehen, Kinder- und Jugendliteratur, Lesetagebuch, Deutschunterricht, Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Prozesse, Perspektivübernahme, Empathie, Imagination, Identität, Literaturdidaktik, qualitative Inhaltsanalyse, quantitative Inhaltsanalyse.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert?
Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analyse der Lesetagebücher werden im Hinblick auf die Forschungsfrage interpretiert.
Welche konkreten Fragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht, inwieweit der Einsatz von Jugendliteratur und Lesetagebuch-Arbeit im Deutschunterricht die Entwicklung des Fremdverstehens bei Schülern fördert. Es werden die Rolle der Jugendliteratur, die methodischen Möglichkeiten der Lesetagebuch-Arbeit und die Analyse emotionaler Prozesse beim Lesen beleuchtet.
- Quote paper
- Maike Ebeling (Author), 2013, Förderung des Fremdverstehens mithilfe von Jugendbüchern und Lesetagebucharbeit (Deutsch, 6. Klasse Oberschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458166