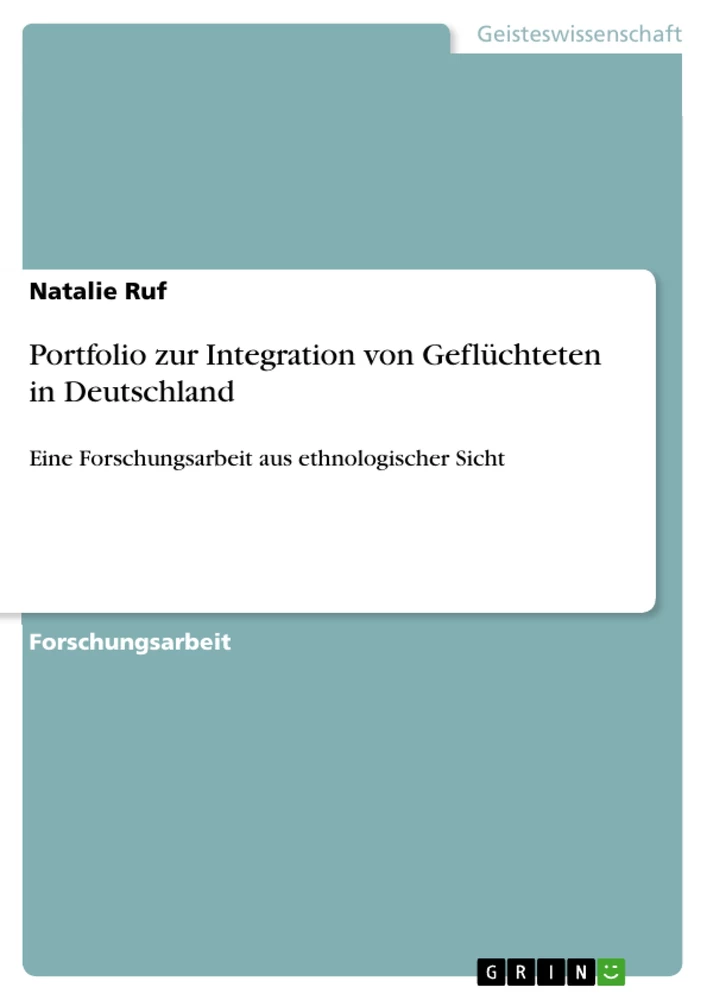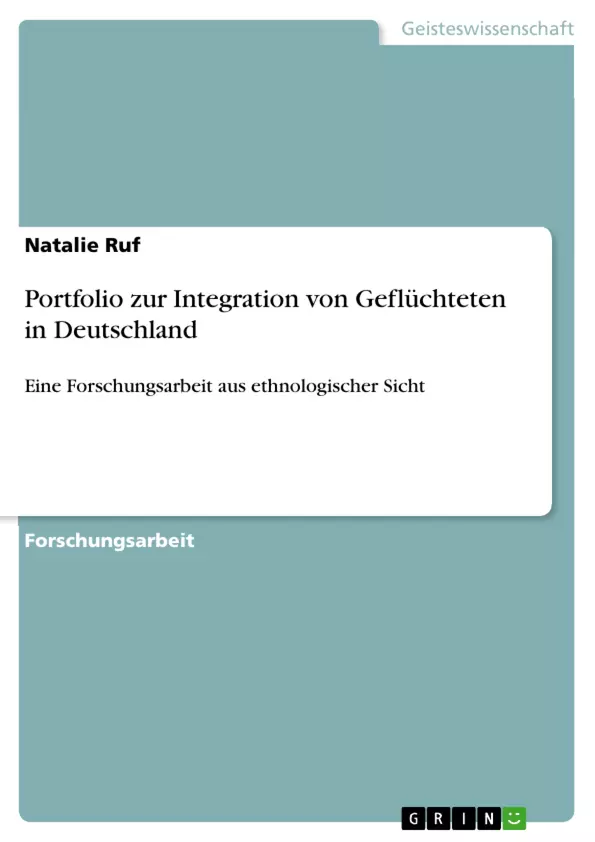In meinem Forschungsprojekt möchte ich der Frage nachgehen, ob wir bei den Geflüchteten, welche seit 2015 in Deutschland leben, von einer erfolgreichen Integration sprechen können und was unsere Gesellschaft denn eigentlich unter "Integration" versteht. Das Thema ist meines Erachtens aktuell sehr relevant, da der Flüchtlingsstrom aufgrund von Krieg und Verfolgung in deren Heimatländern weiterhin anhält und immer mehr Flüchtlinge in Deutschland ihre Chance auf eine neue Heimat sehen. Aufgrund dieses stetig steigenden Zuwachses kommt es in der Politik immer häufiger zu Debatten, ob Deutschland denn weiterhin Flüchtlinge aufnehmen sollte.
Während Auswanderungen im 19. Jahrhundert noch freiwillig erfolgten, werden Wanderungsbewegungen im 21. Jahrhundert durch politische Verwerfung innerhalb oder zwischen den Staaten ausgelöst. Eine große Rolle spielen ferner ethnische Konflikte und fundamentalistische Bewegungen, die Mehrheit flieht vor islamistischen Terroristen.
Begriffe wie Kultur, Fremde oder Flüchtling sind im Zuge der aktuellen Flüchtlingskrise in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit und auf die politische Agenda gerückt. Während die einen eine herzliche Willkommenskultur praktizieren, hetzen andere mit verbaler und physischer Gewalt gegen die Flüchtlinge. Negativschlagzeilen wie "Flüchtlinge passen nicht ins deutsche System", und "Flüchtlinge bleiben zu oft unter sich" schmücken die Titelseiten vieler Medien, wohingegen positive Nachrichten zur Einbürgerung oder besetzten Ausbildungs-, und Arbeitsstellen ausbleiben.
Inhaltsverzeichnis
- Forschungsdesign
- Teilnehmende Beobachtung
- Ethnografisches Interview
- Fragebögen
- Synthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Forschungsprojekt befasst sich mit der Frage, ob von einer erfolgreichen Integration von Migranten und Migrantinnen, welche seit 2015 in Deutschland leben, gesprochen werden kann und wie die deutsche Gesellschaft „Integration“ definiert.
- Die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Debatten in Deutschland zu „Migration“ und „Integration“
- Die Wahrnehmung von Migranten als „die Anderen“ und deren vermeintlich unvereinbare Normen und Werte
- Die Entstehung von Zugehörigkeiten und die Abhängigkeit von vorgegebenen Strukturen
- Die Rolle von „Normalitätsvorstellungen“ und die Assimilationserwartungen an Migranten
- Die Bedeutung der Anerkennung von Differenzen und die Herausforderungen der Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Forschungsdesign“ beleuchtet den aktuellen Kontext von Migration im 21. Jahrhundert und die Bedeutung der Ethnologie für die Erforschung von Fluchtursachen und Integrationsprozessen. Es wird die Relevanz des Themas Integration im Kontext des anhaltenden Flüchtlingsstroms und den damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Debatten in Deutschland hervorgehoben.
Das Kapitel „Teilnehmende Beobachtung“ beschreibt die geplante Beobachtung der Interaktion zwischen Flüchtlingen und Angestellten des Ausländeramts.
Das Kapitel „Ethnografisches Interview“ erläutert die Durchführung von Interviews mit Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft, Ehrenamtlichen und zivilen Personen, um deren Vorstellungen und Meinungen zu Flüchtlingen und ihrer Integration zu erfassen.
Das Kapitel „Fragebögen“ skizziert die Verwendung von Fragebögen in der Asylunterkunft, um die Meinungen der Mitarbeiter des AK-Asyls zur Integration von Flüchtlingen zu ermitteln.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Forschungsprojekts sind: Integration, Migration, Flüchtlinge, Zugehörigkeit, Normalitätsvorstellungen, Kultur, Differenz, Asyl, Interaktion, Ethnografie, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert die deutsche Gesellschaft den Begriff „Integration“?
Die Arbeit untersucht, ob Integration als gegenseitiger Prozess oder eher als einseitige Assimilationserwartung an Geflüchtete verstanden wird.
Kann man bei den Geflüchteten seit 2015 von erfolgreicher Integration sprechen?
Das Forschungsprojekt analysiert den aktuellen Stand anhand von Interviews und Beobachtungen, um diese komplexe Frage differenziert zu beantworten.
Welche Rolle spielen „Normalitätsvorstellungen“?
Vorgegebene gesellschaftliche Strukturen und Normen bestimmen oft, wer als „integriert“ gilt und wer als „der Andere“ wahrgenommen wird.
Was ist das Ziel der teilnehmenden Beobachtung im Ausländeramt?
Es soll untersucht werden, wie die Interaktion zwischen Geflüchteten und Behördenvertretern die Wahrnehmung von Zugehörigkeit beeinflusst.
Welche Methoden nutzt die ethnografische Studie?
Die Studie kombiniert teilnehmende Beobachtung, ethnografische Interviews mit Bewohnern und Ehrenamtlichen sowie Fragebögen für Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe.
- Quote paper
- Natalie Ruf (Author), 2019, Portfolio zur Integration von Geflüchteten in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457888