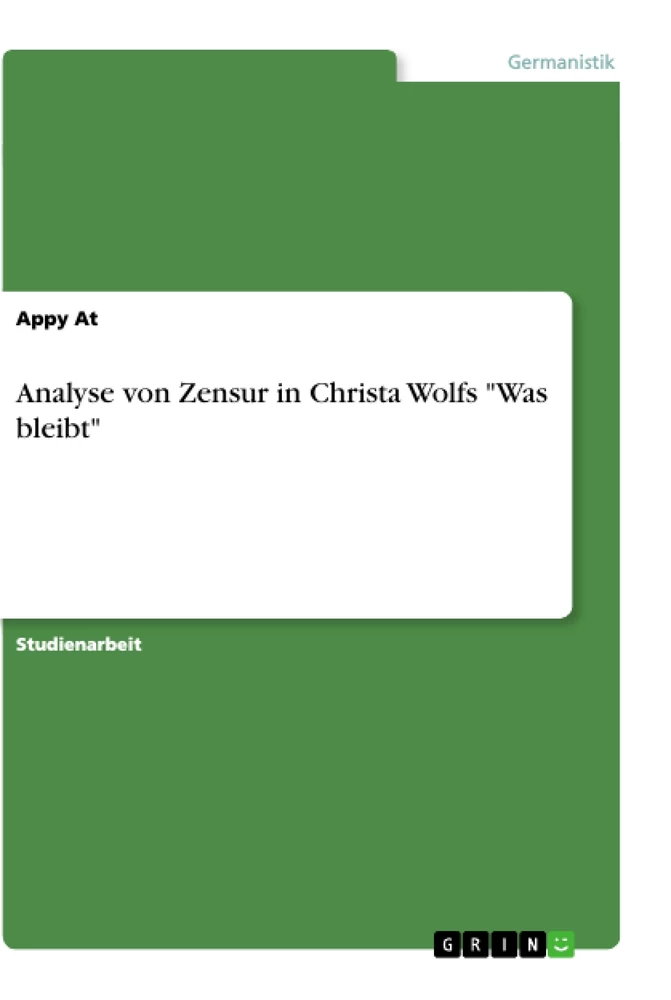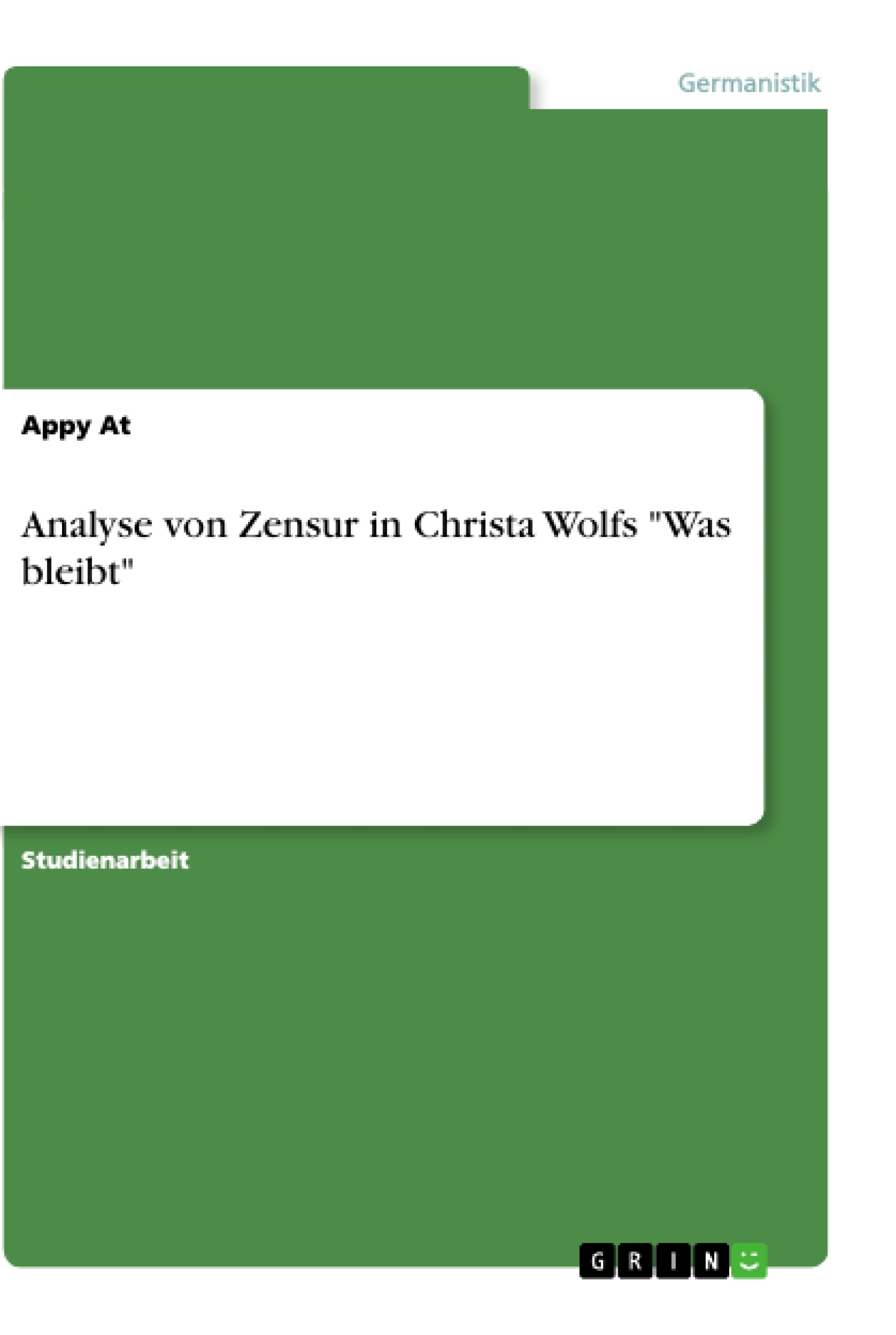In dieser Hausarbeit habe ich die Sprache, was sowohl Inhalt als auch Form betrifft, analysiert. Dabei habe ich versucht, wie bei einem hermeneutischen Zirkel, die Rolle der Zensur und deren Wirkung auf Künstler (einschließlich Schriftsteller) als Individuum im damaligen DDR-System zu beleuchten und den daraus entstandenen Folgen nachzugehen. Inbesondere was deren Wiederspiegelung in diesem literarischen Werk von Chirista Wolf, das autobiographische Zügen enthält, betrifft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Hintergrund
- Inhaltsanalyse bezüglich der Sprache
- Formanalyse
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“, um die Auswirkungen der ständigen STASI-Überwachung in der DDR auf die Sprache und den Gemütszustand der Ich-Erzählerin zu untersuchen.
- Die Rolle der Zensur in der DDR und ihre Auswirkungen auf Künstler und Schriftsteller
- Die Ambivalenz der Ich-Erzählerin zwischen dem realen Sozialismus der DDR und der utopischen Vorstellung einer sozialistischen Gesellschaft
- Die Sprachlosigkeit der Ich-Erzählerin als Ausdruck des Spannungsverhältnisses zwischen politischer Realität und moralischem System
- Die Folgen der Überwachung für die psychische und emotionale Verfassung der Ich-Erzählerin
- Die Darstellung der Zensur als ein geheimes, aber wichtiges Thema in der DDR-Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt „Was bleibt“ von Christa Wolf vor und beleuchtet die Besonderheiten der Erzählung. Sie bezieht sich auf die beiden Daten am Ende des Werks (Juni/Juli 1979 und November 1989) und erläutert die Brisanz der Veröffentlichung im Jahr 1990 im Kontext des Mauerfalls. Der Text ordnet das Werk der DDR-Literatur und teilweise der Wendeliteratur zu und zeigt, wie der innere Zwiespalt der Ich-Erzählerin ihre Sprache und ihr Schreiben beeinflusst. Die Hausarbeit beschreibt den Analyseansatz und das Ziel, die Rolle der Zensur und deren Wirkung auf Künstler in der DDR zu untersuchen.
Geschichtlicher Hintergrund
Dieses Kapitel erläutert den sozio-politischen Kontext der DDR in den letzten 15 Jahren vor dem Mauerfall (1975-1989). Es beschreibt die zunehmenden Eingriffe in die Autorschaft und die Repressionsformen, die von Zensur bis zur Stasi-Überwachung reichten. Der Abschnitt behandelt die Instrumentalisierung der Literatur in der DDR und die Folgen für Künstler, die sich nicht frei ausdrücken konnten. Die Überwachung durch die Stasi führte zu physischen, emotionalen und geistigen Schäden. Das Kapitel verweist auf Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“ als Beispiel für die Erfahrungen von Autoren in der DDR.
Inhaltsanalyse bezüglich der Sprache
Die Sprache ist ein zentrales Motiv in „Was bleibt“. Der Text beginnt mit einer Beschreibung der Zensur-Stimmung in der DDR und beleuchtet die Suche der Ich-Erzählerin nach einer neuen Sprache, die die Unterdrückung widerspiegelt. Die Sprache wird als Ausdruck des Spannungsverhältnisses zwischen dem realen Sozialismus und der utopischen Vorstellung einer sozialistischen Gesellschaft dargestellt. Die Sprachlosigkeit der Ich-Erzählerin verweist auf den Konflikt zwischen dem politischen und dem moralischen System.
- Quote paper
- Appy At (Author), 2017, Analyse von Zensur in Christa Wolfs "Was bleibt", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456848