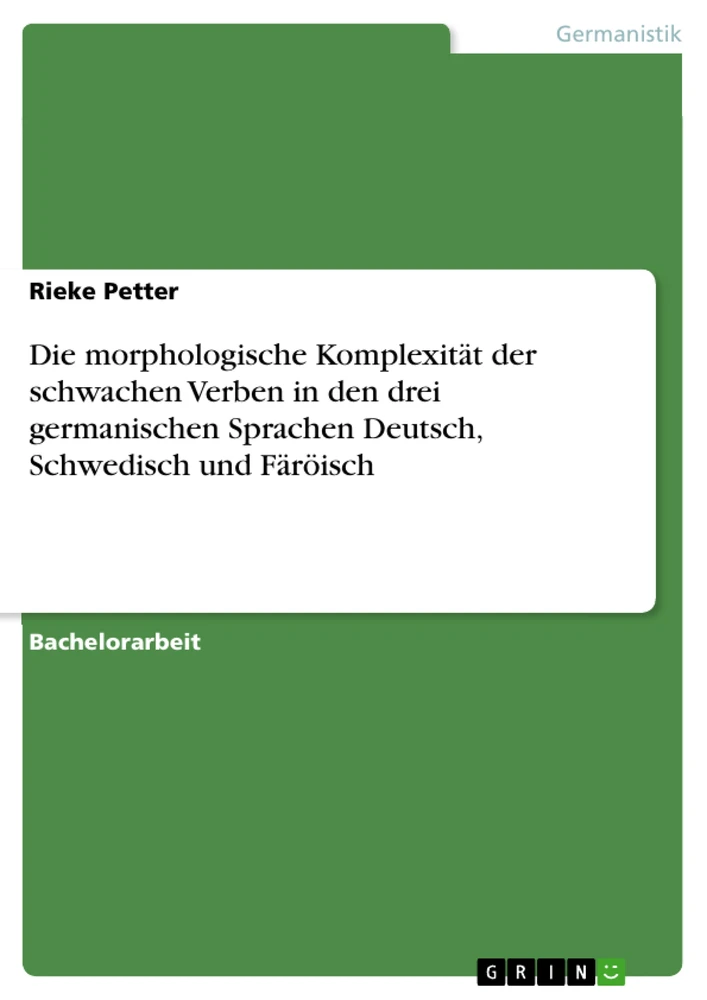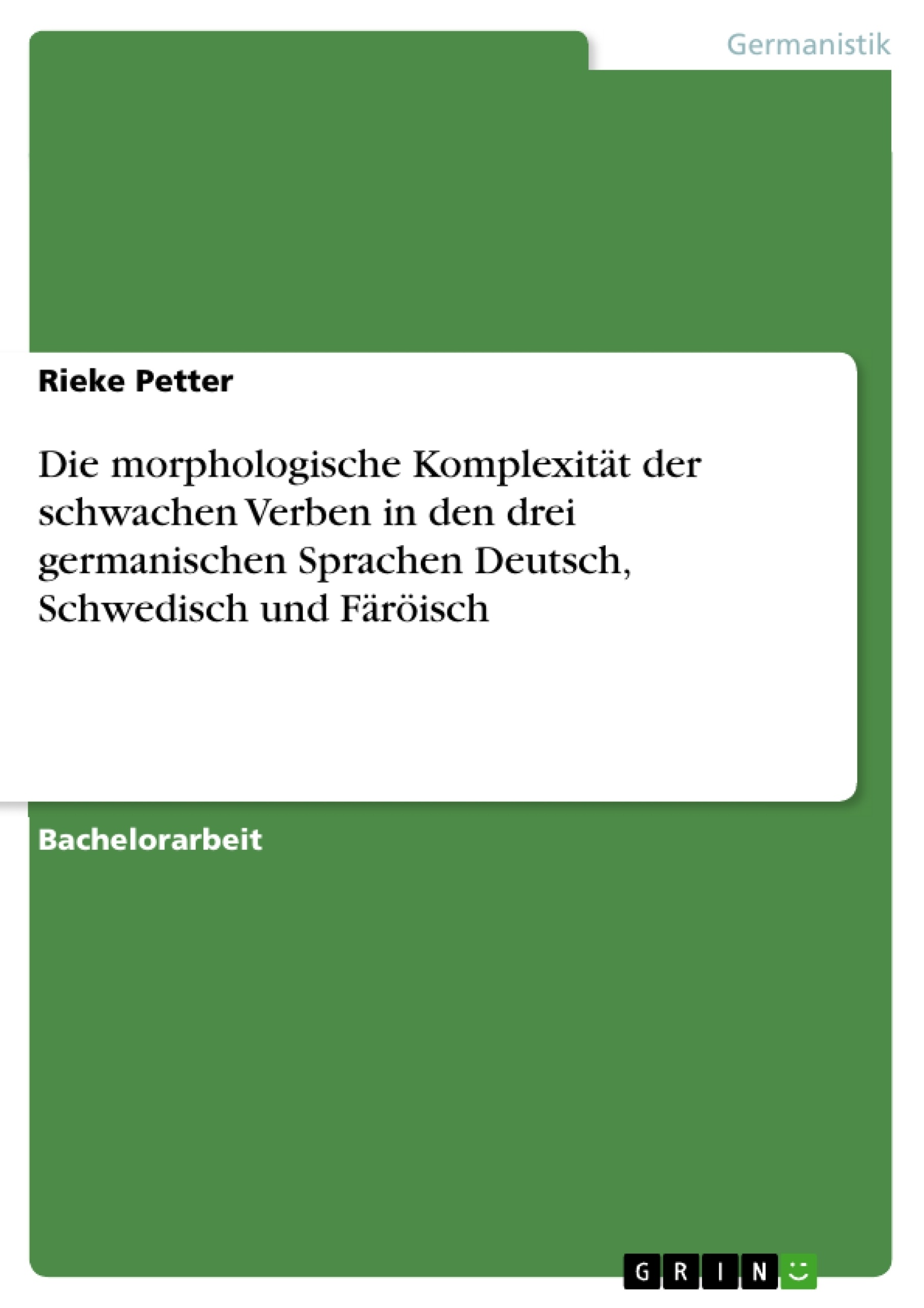Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit solch einer Messmethode: Dammel/Kürschner (2008) haben einen Ansatz zur Untersuchung der Komplexität der Pluralmorphologie in den germanischen Sprachen entworfen. Meine Arbeit verfolgt das Ziel, diesen Ansatz auf den Bereich der Verbalmorphologie zu übertragen und damit seine generelle Übertragbarkeit auf andere morphologische Teilbereiche zu überprüfen. Darüber hinaus soll eine Komplexitätshierarchie der drei untersuchten Sprachen Deutsch, Schwedisch und Färöisch im Hinblick auf ihre Flexion der schwachen Verben aufgestellt werden.
Ist es möglich, natürliche Sprachen hinsichtlich ihrer strukturellen Komplexität zu unterscheiden? Stellt man einem Nichtlinguisten diese Frage, wird die Antwort in den allermeisten Fällen ein klares »Ja« sein: Es ist eine verbreitete Auffassung, dass Sprachen wie Englisch aufgrund ihrer geringen Komplexität leicht erlernbar sind, während beispielsweise Chinesisch, Finnisch oder Arabisch als komplexe und nur schwierig zu meisternde Sprachsysteme gelten.
Interessanterweise steht diese Auffassung in einem deutlichen Gegensatz zur sprachwissenschaftlichen Diskussion, in der lange Zeit entschieden die These vertreten wurde, dass alle natürlichen Sprachen grundsätzlich die gleiche Komplexität aufweisen: War eine Sprache morphologisch simpel strukturiert, war es selbstverständlich, dass diese relative Einfachheit durch Komplexität in einer anderen Domäne, beispielsweise der Syntax, ausgeglichen wurde.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Überzeugung hat in den letzten Jahren ein stetig wachsendes Interesse entfacht und zu der Entwicklung von unterschiedlichen Methoden zur linguistischen Komplexitätsmessung geführt, deren Ergebnisse das Argument von der Invarianz sprachlicher Komplexität teilweise entkräften konnten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Grundlagen
- a. Die Komplexitätsfrage in der Linguistik
- b. Der Ansatz von Dammel und Kürschner
- i. Konzept und Vorgehensweise
- ii. Die Theorie der morphologischen Natürlichkeit als Basis für die Bestimmung qualitativer Komplexität
- iii. Kritische Vorüberlegungen zur Übertragung des Ansatzes auf die Verbalmorphologie
- 2. Untersuchung der Verbalmorphologie im Deutschen, Schwedischen und Färöischen
- a. Quantitative Komplexität: Die Anzahl der Allomorphe
- b. Qualitative Komplexität: Die Komplexität der formalen Techniken
- i. Stamminvolvierung
- ii. Redundanz
- iii. Nicht-Ikonizität
- iv. Allomorphie
- v. Fusion
- c. Komplexität der Zuordnungsprinzipien
- 3. Ergebnisse und Diskussion
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die morphologische Komplexität schwacher Verben im Deutschen, Schwedischen und Färöischen. Ziel ist die Übertragung eines bestehenden Ansatzes zur Pluralmorphologie auf die Verbalmorphologie und die Erstellung einer Komplexitätshierarchie der drei Sprachen. Die Arbeit prüft die generelle Übertragbarkeit des Ansatzes und hinterfragt kritisch die Annahme der Invarianz sprachlicher Komplexität.
- Überprüfung der Übertragbarkeit eines Komplexitätsmessansatzes auf die Verbalmorphologie.
- Erstellung einer Komplexitätshierarchie des Deutschen, Schwedischen und Färöischen bezüglich schwacher Verben.
- Kritische Auseinandersetzung mit der These von der Invarianz sprachlicher Komplexität.
- Analyse quantitativer und qualitativer Aspekte morphologischer Komplexität.
- Diskussion der Ergebnisse und des angewendeten Ansatzes.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sprachlichen Komplexität ein und stellt die These der Invarianz sprachlicher Komplexität in Frage. Sie präsentiert den Ansatz der Arbeit: die Übertragung einer Methode zur Messung der Komplexität der Pluralmorphologie auf die Verbalmorphologie, um eine Komplexitätshierarchie des Deutschen, Schwedischen und Färöischen im Hinblick auf die Flexion schwacher Verben zu erstellen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen.
II. Hauptteil, 1. Grundlagen, a. Die Komplexitätsfrage in der Linguistik: Dieser Abschnitt beleuchtet die lange vorherrschende Annahme der Gleichheit sprachlicher Komplexität, die sogenannte trade-off-Hypothese. Er diskutiert die mangelnde empirische Fundierung dieser These und deren ideologischen Hintergrund, der in der Gleichstellung aller Kulturen begründet liegt. Der Abschnitt beschreibt die zunehmende kritische Auseinandersetzung mit dieser These in jüngerer Zeit und betont die Bedeutung der Klärung dieser Frage.
II. Hauptteil, 1. Grundlagen, b. Der Ansatz von Dammel und Kürschner: Dieser Abschnitt beschreibt den von Dammel und Kürschner entwickelten Ansatz zur Untersuchung der Komplexität der Pluralmorphologie und die zugrundeliegende Theorie der morphologischen Natürlichkeit. Es werden die Konzepte und Vorgehensweisen des Ansatzes detailliert erläutert und kritisch auf die Übertragbarkeit auf die Verbalmorphologie hin überprüft. Die Darstellung umfasst die theoretischen Grundlagen, die für die spätere Anwendung auf die drei untersuchten Sprachen essenziell sind.
II. Hauptteil, 2. Untersuchung der Verbalmorphologie im Deutschen, Schwedischen und Färöischen: Dieser Abschnitt präsentiert die Anwendung des adaptierten Ansatzes von Dammel und Kürschner auf die Verbalmorphologie der drei Sprachen. Es werden quantitative Aspekte (Anzahl der Allomorphe) und qualitative Aspekte (Komplexität der formalen Techniken wie Stamminvolvierung, Redundanz, Nicht-Ikonizität, Allomorphie und Fusion) sowie die Komplexität der Zuordnungsprinzipien untersucht und verglichen. Dieser Teil bildet den Kern der empirischen Arbeit.
Schlüsselwörter
Morphologische Komplexität, schwache Verben, Deutsch, Schwedisch, Färöisch, Verbalmorphologie, Komplexitätsmessung, Dammel/Kürschner, morphologische Natürlichkeit, Allomorphie, Redundanz, Invarianz sprachlicher Komplexität.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Morphologische Komplexität schwacher Verben im Deutschen, Schwedischen und Färöischen
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die morphologische Komplexität schwacher Verben im Deutschen, Schwedischen und Färöischen. Sie überprüft die Übertragbarkeit eines bestehenden Ansatzes zur Pluralmorphologie auf die Verbalmorphologie und erstellt eine Komplexitätshierarchie der drei Sprachen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden zentralen Fragen: Ist der Ansatz zur Messung der Komplexität der Pluralmorphologie auf die Verbalmorphologie übertragbar? Wie lässt sich eine Komplexitätshierarchie des Deutschen, Schwedischen und Färöischen bezüglich schwacher Verben erstellen? Stimmt die These von der Invarianz sprachlicher Komplexität? Welche quantitativen und qualitativen Aspekte morphologischer Komplexität sind relevant?
Welcher Ansatz wird verwendet?
Die Arbeit adaptiert den Ansatz von Dammel und Kürschner zur Untersuchung der Komplexität der Pluralmorphologie. Dieser Ansatz basiert auf der Theorie der morphologischen Natürlichkeit und berücksichtigt quantitative (Anzahl der Allomorphe) und qualitative Aspekte (Komplexität der formalen Techniken wie Stamminvolvierung, Redundanz, Nicht-Ikonizität, Allomorphie und Fusion) sowie die Komplexität der Zuordnungsprinzipien.
Welche Sprachen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die morphologische Komplexität schwacher Verben im Deutschen, Schwedischen und Färöischen.
Welche Aspekte der morphologischen Komplexität werden untersucht?
Die Untersuchung umfasst quantitative Aspekte (Anzahl der Allomorphe) und qualitative Aspekte (Komplexität der formalen Techniken: Stamminvolvierung, Redundanz, Nicht-Ikonizität, Allomorphie und Fusion) sowie die Komplexität der Zuordnungsprinzipien.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit erwartet eine Komplexitätshierarchie der drei untersuchten Sprachen bezüglich der Flexion schwacher Verben und eine kritische Auseinandersetzung mit der These von der Invarianz sprachlicher Komplexität.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit Grundlagen (Komplexitätsfrage in der Linguistik und der Ansatz von Dammel und Kürschner), die Untersuchung der Verbalmorphologie in den drei Sprachen, Ergebnisse und Diskussion und einen Schluss.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Morphologische Komplexität, schwache Verben, Deutsch, Schwedisch, Färöisch, Verbalmorphologie, Komplexitätsmessung, Dammel/Kürschner, morphologische Natürlichkeit, Allomorphie, Redundanz, Invarianz sprachlicher Komplexität.
Was ist die These der Invarianz sprachlicher Komplexität?
Die These der Invarianz sprachlicher Komplexität, auch trade-off-Hypothese genannt, besagt, dass alle Sprachen gleich komplex sind. Die Arbeit hinterfragt diese These kritisch und diskutiert deren empirische Fundierung und ideologischen Hintergrund.
- Citation du texte
- Rieke Petter (Auteur), 2011, Die morphologische Komplexität der schwachen Verben in den drei germanischen Sprachen Deutsch, Schwedisch und Färöisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455103