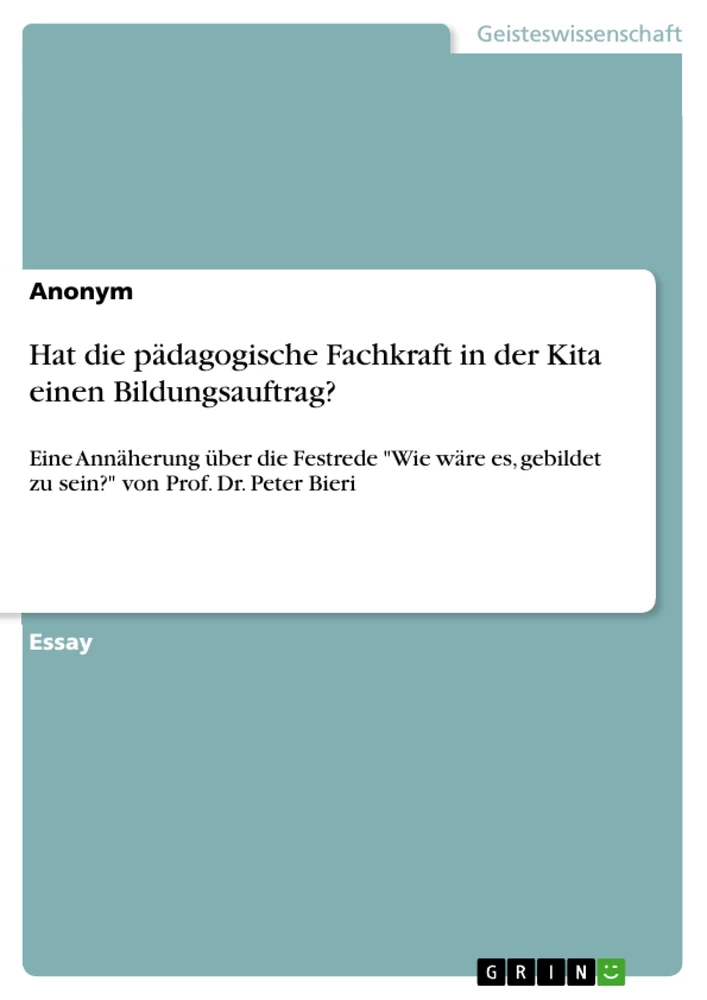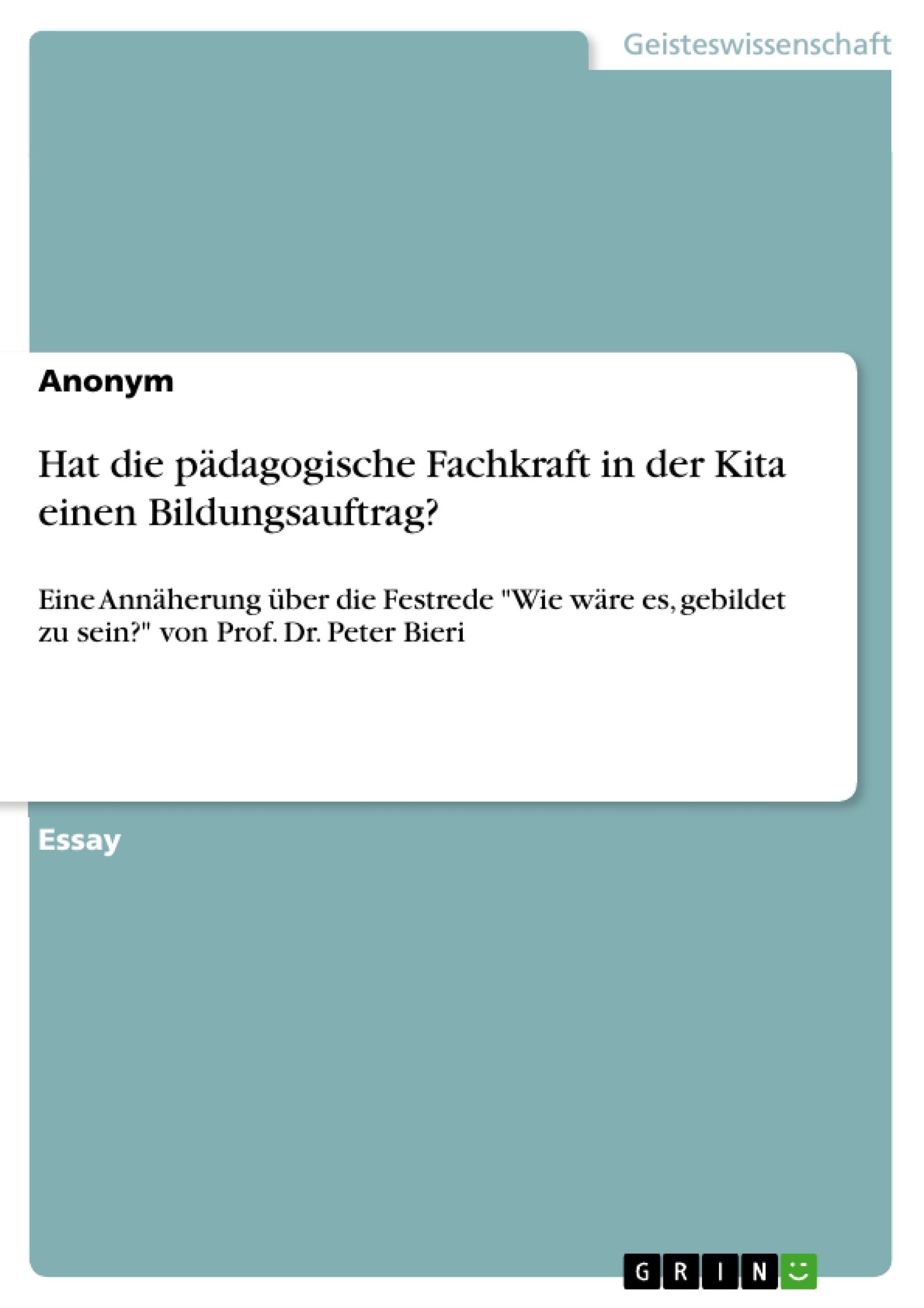Bildung ist laut Bieri ein Prozess, für den der Mensch, im Gegensatz zur Ausbildung, niemanden außer sich selbst braucht. Bilden tut sich der Mensch ausschließlich alleine, während er, um ausgebildet zu werden, eine/n Ausbilder/in braucht, der/die ihm das „Knowhow“ vermittelt.
Dementsprechend wird in der Fragestellung kein Bildungs-, sondern ein Ausbildungsverhältnis formuliert: Ich, als pädagogische Fachkraft beziehungsweise Ausbilderin, frage mich, ob ich den Kindern als Auszubildenden etwas beibringen kann.
An dieser Stelle kann somit bereits ausgeschlossen werden, die Fragestellung mit einem „Ja“ zu beantworten. – Eine pädagogische Fachkraft kann kein Kind bilden. Lediglich das Kind selbst ist in der Lage, sich zu bilden.
Trotz alledem soll im Verlauf dieses Textes anhand eines Fallbeispieles in Bezug auf die Festrede von Bieri beleuchtet werden, ob weitere Argumente, die gegen eine positive Beantwortung der Fragstellung sprechen, zu finden sind, sowie, ob sich Platz zwischen dieser „Schwarz-Weiß-Beantwortungssystematik“ für Grauzonen finden lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1) Einleitung
- 2a) Darstellung des Bezugstextes
- 2b) Diskussion und Übertragung
- 3) Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten Kinder im Sinne von „Bildung“ (im Gegensatz zu „Ausbildung“) fördern können. Die Autorin reflektiert ihre eigene Praxis anhand eines selbst durchgeführten Projekts und bezieht die Festrede „Wie wäre es, gebildet zu sein?“ von Peter Bieri ein.
- Abgrenzung von Bildung und Ausbildung
- Die Rolle der intrinsischen Motivation in der Bildung
- Reflexion der eigenen pädagogischen Praxis
- Die Bedeutung von Partizipation und Selbstbestimmung in der Bildung
- Schaffung von Räumen für Bildung in der Kita
Zusammenfassung der Kapitel
1) Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit: Die Autorin absolviert ein duales Studium und reflektiert ihre Praxis in einer Kita in Schleswig-Holstein. Ein von ihr durchgeführtes „Raupen-Schmetterlingsprojekt“ wirft die Frage auf, ob sie die Kinder im Sinne von Bildung oder Ausbildung fördert. Die Arbeit untersucht diese Frage anhand des Bildungsbegriffes von Peter Bieri.
2a) Darstellung des Bezugstextes: Dieser Abschnitt fasst die Kernaussagen von Peter Bieris Festvortrag „Wie wäre es, gebildet zu sein?“ zusammen. Bieri unterscheidet klar zwischen Ausbildung (Können und Wissen aneignen) und Bildung (ein selbstbestimmter Prozess des Werdens). Bildung ist intrinsisch motiviert und beginnt mit Neugierde. Der Mensch bildet sich selbst, im Gegensatz zur Ausbildung, die auf Wissenstransfer durch eine Lehrkraft angewiesen ist.
2b) Diskussion und Übertragung: Dieser Abschnitt diskutiert die in der Einleitung aufgeworfene Frage im Lichte von Bieris Ausführungen. Die Autorin argumentiert, dass ihr Projekt eher ein Ausbildungsverhältnis darstellt, da sie die Themen und Inhalte vorgab und die Kinder in einem vorgegebenen Rahmen arbeiteten. Sie reflektiert die fehlende Partizipation der Kinder und die damit verbundene Frage nach intrinsischer Motivation. Sie vergleicht dies mit ihren eigenen negativen Schulerfahrungen. Abschließend wird jedoch betont, dass trotz der vorgegebenen Struktur des Projektes Räume für selbstbestimmtes Lernen und somit Bildung geschaffen wurden, indem den Kindern die Möglichkeit gegeben wurde, ihre Beobachtungen selbstständig zu protokollieren. Hier wird der Fokus auf die Schaffung von Freiräumen für die Kinder gelegt.
Schlüsselwörter
Bildung, Ausbildung, Peter Bieri, Kita, pädagogische Fachkraft, Kinder, Projekt, Partizipation, Selbstbestimmung, intrinsische Motivation, Neugierde, Persönlichkeitsentwicklung, Bildungsauftrag.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Reflexion pädagogischer Praxis im Kontext von Bildung und Ausbildung
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten Kinder im Sinne von „Bildung“ (im Gegensatz zu „Ausbildung“) fördern können. Die Autorin reflektiert ihre eigene Praxis anhand eines selbst durchgeführten Projekts („Raupen-Schmetterlingsprojekt“) und bezieht den Festvortrag „Wie wäre es, gebildet zu sein?“ von Peter Bieri ein.
Welche konkreten Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Abgrenzung von Bildung und Ausbildung, der Rolle der intrinsischen Motivation in der Bildung, der Reflexion der eigenen pädagogischen Praxis, der Bedeutung von Partizipation und Selbstbestimmung in der Bildung und der Schaffung von Räumen für Bildung in der Kita.
Welche Methode wird angewendet?
Die Autorin reflektiert ihre eigene Praxis in einer Kita in Schleswig-Holstein anhand eines selbst durchgeführten Projektes. Sie bezieht dabei den theoretischen Ansatz von Peter Bieri zum Thema Bildung heran.
Welche Rolle spielt Peter Bieri in der Arbeit?
Peter Bieris Festvortrag „Wie wäre es, gebildet zu sein?“ dient als theoretischer Bezugsrahmen. Seine Unterscheidung zwischen Ausbildung (Können und Wissen aneignen) und Bildung (selbstbestimmter Prozess des Werdens) ist zentral für die Argumentation der Autorin.
Wie wird das „Raupen-Schmetterlingsprojekt“ in der Arbeit bewertet?
Das Projekt wird von der Autorin kritisch reflektiert. Sie argumentiert, dass es eher ein Ausbildungsverhältnis darstellte, da sie die Themen und Inhalte vorgab und die Kinder in einem vorgegebenen Rahmen arbeiteten. Es fehlte an Partizipation und intrinsischer Motivation. Gleichzeitig erkennt sie aber auch die Schaffung von Freiräumen für selbstbestimmtes Lernen und somit Bildung durch die Möglichkeit der selbstständigen Protokollierung der Beobachtungen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Autorin?
Die Autorin betont die Bedeutung von Partizipation und Selbstbestimmung für Bildungsprozesse in der Kita. Sie zeigt, dass selbst in einem scheinbar strukturbestimmten Projekt Räume für Bildung geschaffen werden können, indem Freiräume für selbstgesteuertes Lernen ermöglicht werden. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit, Bildungsprozesse in Kitas stärker auf die Bedürfnisse und die intrinsische Motivation der Kinder auszurichten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bildung, Ausbildung, Peter Bieri, Kita, pädagogische Fachkraft, Kinder, Projekt, Partizipation, Selbstbestimmung, intrinsische Motivation, Neugierde, Persönlichkeitsentwicklung, Bildungsauftrag.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Darstellung des Bezugstextes (Bieris Vortrag), eine Diskussion und Übertragung auf die eigene Praxis und einen Schluss.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Hat die pädagogische Fachkraft in der Kita einen Bildungsauftrag?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/454665