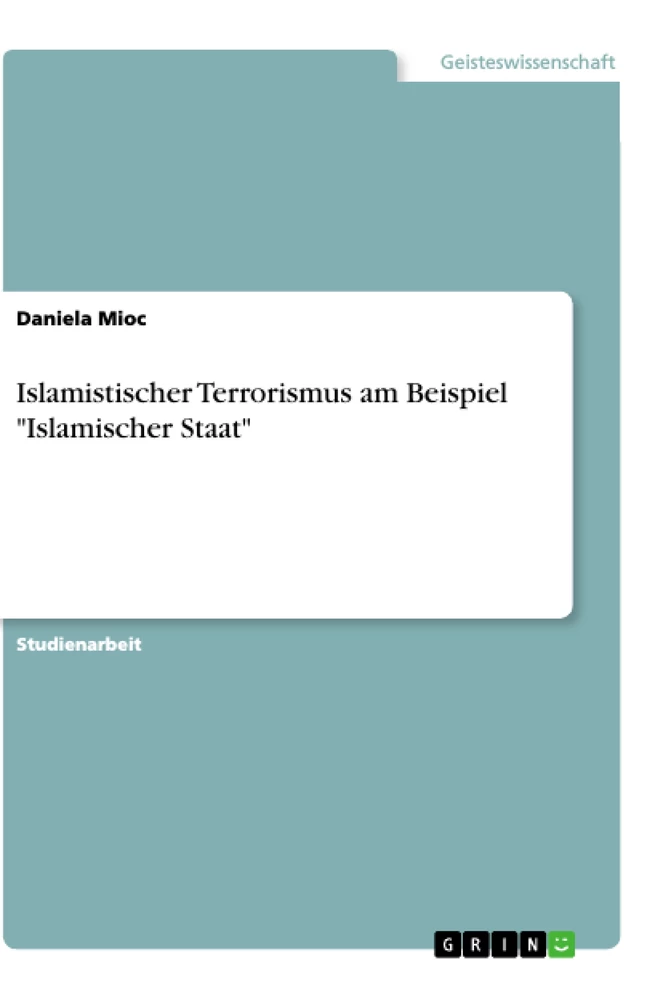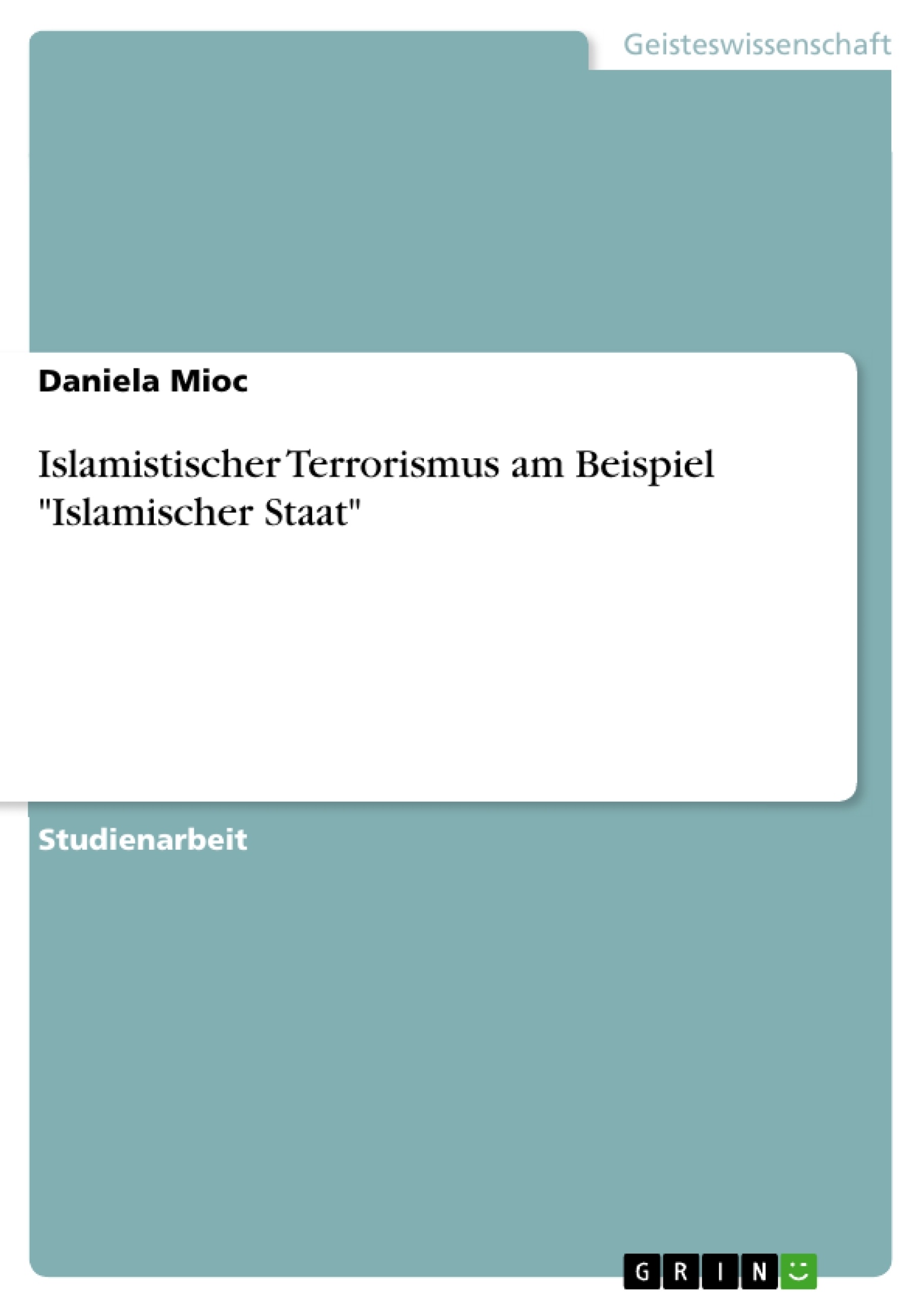In den Weltreligionen haben Grundhaltungen wie Frieden und Liebe, neben anderen Moralitäten, einen sehr hohen Stellenwert und werden Gläubigen schon seit jeher von religiösen Gelehrten, die die Glaubensinhalte der jeweiligen Heiligen Schrift vermitteln, für ein tugendhaftes und harmonisches Zusammenleben gepredigt. Die sog. „Goldene Regel“ stellt eine Gemeinsamkeit dieser Religionen dar und bedeutet für alle einheitlich kurz gefasst „Tue nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun.“
Dennoch kam es bereits im Jahre 1979 zum Auftreten religiöser (bzw. islamistischer) Gewalt, als bei der iranischen Revolution skrupellos das Ziel verfolgt wurde, den Iran in einen Islamischen Staat zu verwandeln. Seitdem vermehrte sich die Anzahl an Terrorübergriffen, Tyrannei und sonstigen Unruhen – jedoch lagen die Quellen und der Nährboden dafür meist in islamischen Ländern. So wurde im modernen Zeitalter alle Aufmerksamkeit auf den Islam gelenkt, da dieser zunehmend mit dem Terrorismus verbunden wurde und heute in dieser Hinsicht die umstrittenste Religion der Welt zu sein scheint. Dabei ist der weltbekannte Anschlag vom 11. September 2001, bei dem der (bereits verstorbene) islamische Fundamentalist Osama Bin Laden und seine damalige Terrororganisation „al-Qaida“ mit zwei Flugzeugen das berühmte World Trade Center in New York zu Sturz brachten, nur ein Beispiel für die enorme Machtfülle des religiösen Terrorismus.
Nach dem Zusammenbruch von al-Qaida ist jedoch der sog. „Islamische Staat“ entstanden. Er gilt als die bisher mächtigste und reichste salafistische Terrormiliz der Welt und gibt dem Schrecken und der Gewalt auf unserer Erde eine neue Dimension. Im Nahen Osten kontrollierte die Gruppe bereits weite Gebiete, jedoch sind auch andere Staaten auf ihrer Zielscheibe. Aber wie begründen die selbsternannten „Gotteskrieger“ ihre grausamen Handlungen und in welchem Ausmaß wird der Krieg tatsächlich geführt? Der Islamische Staat soll als Beispiel religiöser bzw. spezifisch islamistischer Gewalt durch die vorliegende Arbeit ausführlich demonstriert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition des Terminus „Islamistischer Terrorismus“
- 3. Was ist der Islamische Staat?
- 3.1. Sein Ursprung und der Weg zur Entstehung eines Imperiums
- 4. Die Lehre des Dschihad als Missbrauch zur Legitimation von Terror
- 4.1. Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten
- 5. Hybride Kriegsführung beim Islamischen Staat
- 5.1. Kurze Definition des Terminus „Hybride Kriegsführung“
- 5.2. Hybride Kriegsformen: Erfolgreiche Strategien des IS
- 6. Gewaltpotential in Europa: Christen hängen sich dem IS an
- 7. Konfliktbewältigung mit dem IS - auch gewaltfrei möglich?
- 8. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Islamischen Staat (IS) als Beispiel für islamistischen Terrorismus. Die Zielsetzung besteht darin, die Entstehung, Ideologie und Kriegsführung des IS zu beleuchten und das Gewaltpotential für Europa zu analysieren. Die Arbeit erörtert auch Möglichkeiten der gewaltfreien Konfliktbewältigung.
- Definition und Kontextualisierung von islamistischem Terrorismus
- Entstehung und Ideologie des Islamischen Staates
- Dschihad und innerislamische Konflikte als Grundlage der IS-Ideologie
- Analyse der hybriden Kriegsführung des IS
- Bewertung des Gewaltpotentials des IS in Europa
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Gegensatz zwischen den friedlichen Grundhaltungen der Weltreligionen und dem Auftreten islamistischer Gewalt heraus. Sie führt den Islamischen Staat als Beispiel für eine besonders mächtige und brutale terroristische Organisation ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von einer Definition des islamistischen Terrorismus über die Entstehungsgeschichte des IS bis hin zu Möglichkeiten der Konfliktbewältigung reicht. Der 11. September 2001 wird als Beispiel für die verheerende Wirkung religiösen Terrorismus erwähnt, und der Fokus wird auf den IS als Nachfolger von Al-Qaida gelegt.
2. Definition des Terminus „Islamistischer Terrorismus“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Islamistischer Terrorismus“. Es wird zunächst der Begriff Terrorismus an sich erläutert, der als die systematische Verbreitung von Angst und Schrecken durch Gewaltaktionen, insbesondere zur Erreichung politischer Ziele, definiert wird. Der Unterschied zwischen staatlichem Terror („von oben“) und nichtstaatlichem Terrorismus („von unten“) wird herausgestellt. Im Anschluss wird der Islamismus als zugrundeliegende Ideologie des islamistischen Terrorismus beschrieben, der die „Neuordnung“ der Welt durch die Ablösung westlicher Werte durch islamische Werte und die Errichtung eines Kalifats anstrebt. Der Terrorismus wird als Machtinstrument zur Erreichung dieses Ziels dargestellt.
3. Was ist der Islamische Staat?: Dieses Kapitel beschreibt den Islamischen Staat (IS) als eine salafistische Terrororganisation mit zehntausenden Anhängern, die eine radikale Auslegung des Korans und der Sunna vertritt. Die Ziele des IS, wie die weltweite Errichtung eines Kalifats durch Zerstörung des kulturellen Erbes und Tötung von „Ungläubigen“, werden erläutert. Die räumliche Ausdehnung des IS-Einflusses im Nahen Osten und seine globale Vernetzung werden thematisiert, ebenso wie die Tatsache, dass der IS trotz einiger Niederlagen weiterhin einen transnationalen Dschihad führt.
4. Die Lehre des Dschihad als Missbrauch zur Legitimation von Terror: Dieses Kapitel analysiert die Lehre des Dschihad und ihren Missbrauch zur Legitimation von Terror durch den IS. Es werden die inneren Konflikte innerhalb des Islams, insbesondere der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, als ein wichtiger Faktor für die Entstehung und Verbreitung islamistischer Gewalt dargestellt. Der Fokus liegt darauf, wie die IS-Ideologie den Dschihad interpretiert und instrumentalisiert um seine Ziele zu rechtfertigen.
5. Hybride Kriegsführung beim Islamischen Staat: Das Kapitel befasst sich mit den hybriden Kriegsführungsmethoden des IS. Zunächst wird der Begriff „Hybride Kriegsführung“ kurz definiert. Anschließend werden die erfolgreichen Strategien des IS im hybriden Krieg analysiert, einschließlich der Kombination von konventionellen und nicht-konventionellen Kriegsführungsmethoden, Propaganda und Terror. Die Kapitel zeigt die Vielschichtigkeit des Vorgehens des IS.
6. Gewaltpotential in Europa: Christen hängen sich dem IS an: Dieses Kapitel untersucht das Gewaltpotential des IS in Europa und beleuchtet, wie sich europäische Christen dem IS anschließen. Es analysiert die Rekrutierungsmethoden, die Radikalisierungsprozesse und die Gründe, die dazu führen, dass europäische Bürger dem IS beitreten. Das Kapitel verdeutlicht die Gefahr, die vom IS für Europa ausgeht, und wie sich diese Bedrohung manifestiert.
7. Konfliktbewältigung mit dem IS - auch gewaltfrei möglich?: Dieses Kapitel untersucht Möglichkeiten der Konfliktbewältigung mit dem IS, wobei auch gewaltfreie Strategien berücksichtigt werden. Es analysiert die Herausforderungen und Chancen gewaltfreier Ansätze und diskutiert alternative Lösungsansätze zur Bekämpfung des Terrorismus. Es bewertet verschiedene Strategien und versucht, Wege zu einer Lösung des Problems aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Islamistischer Terrorismus, Islamischer Staat (IS), Dschihad, Hybride Kriegsführung, Radikalisierung, Konfliktbewältigung, Gewaltprävention, Salafismus, Sunniten, Schiiten, Europa, Kalifat.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Islamistischer Terrorismus und der Islamische Staat
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Islamischen Staat (IS) als Beispiel für islamistischen Terrorismus. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Text untersucht die Entstehung, Ideologie und Kriegsführung des IS, analysiert das Gewaltpotenzial für Europa und erörtert Möglichkeiten der Konfliktbewältigung, auch gewaltfreie.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Hauptthemen: Definition und Kontextualisierung von islamistischem Terrorismus, Entstehung und Ideologie des Islamischen Staates, der Dschihad und innerislamische Konflikte als Grundlage der IS-Ideologie, Analyse der hybriden Kriegsführung des IS, Bewertung des Gewaltpotenzials des IS in Europa und Möglichkeiten der Konfliktbewältigung (auch gewaltfrei).
Wie wird der Begriff „Islamistischer Terrorismus“ definiert?
Der Text definiert Terrorismus als die systematische Verbreitung von Angst und Schrecken durch Gewaltaktionen, insbesondere zur Erreichung politischer Ziele. Islamistischer Terrorismus wird als Terrorismus verstanden, dessen Ideologie im Islamismus wurzelt, der eine „Neuordnung“ der Welt durch die Ablösung westlicher Werte durch islamische Werte und die Errichtung eines Kalifats anstrebt. Terrorismus dient hierbei als Machtinstrument.
Was ist der Islamische Staat (IS)?
Das Dokument beschreibt den IS als eine salafistische Terrororganisation mit zehntausenden Anhängern, die eine radikale Auslegung des Korans und der Sunna vertritt. Seine Ziele sind die weltweite Errichtung eines Kalifats durch Zerstörung des kulturellen Erbes und Tötung von „Ungläubigen“. Der IS zeichnet sich durch seine räumliche Ausdehnung im Nahen Osten, globale Vernetzung und die Fortführung eines transnationalen Dschihads aus.
Welche Rolle spielt der Dschihad in der IS-Ideologie?
Das Dokument analysiert den Missbrauch der Dschihad-Lehre zur Legitimation von Terror durch den IS. Es zeigt auf, wie innerislamische Konflikte, insbesondere der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, die Entstehung und Verbreitung islamistischer Gewalt beeinflussen. Der IS instrumentalisiert die Dschihad-Interpretation zur Rechtfertigung seiner Ziele.
Welche Kriegsführungsmethoden verwendet der IS?
Der IS nutzt hybride Kriegsführungsmethoden, die eine Kombination aus konventionellen und nicht-konventionellen Kriegsführungsmethoden, Propaganda und Terror darstellen. Die Vielschichtigkeit dieser Strategien wird im Dokument analysiert.
Wie groß ist das Gewaltpotenzial des IS in Europa?
Das Dokument untersucht das Gewaltpotenzial des IS in Europa und beleuchtet den Anschluss europäischer Christen an den IS. Es analysiert Rekrutierungsmethoden, Radikalisierungsprozesse und die Gründe für den Beitritt europäischer Bürger zum IS, um die daraus resultierende Bedrohung für Europa zu verdeutlichen.
Gibt es gewaltfreie Konfliktbewältigungsansätze?
Das Dokument erörtert Möglichkeiten der Konfliktbewältigung mit dem IS, inklusive gewaltfreier Strategien. Es analysiert Herausforderungen und Chancen solcher Ansätze und diskutiert alternative Lösungsansätze zur Terrorismusbekämpfung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Islamistischer Terrorismus, Islamischer Staat (IS), Dschihad, Hybride Kriegsführung, Radikalisierung, Konfliktbewältigung, Gewaltprävention, Salafismus, Sunniten, Schiiten, Europa, Kalifat.
- Quote paper
- Daniela Mioc (Author), 2018, Islamistischer Terrorismus am Beispiel "Islamischer Staat", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452533