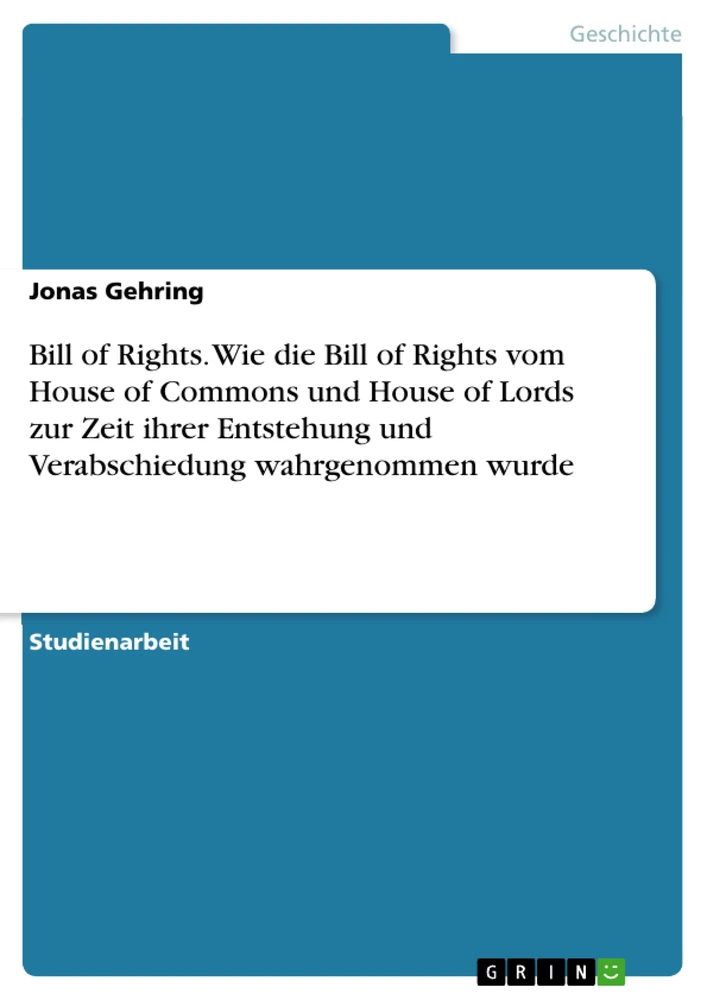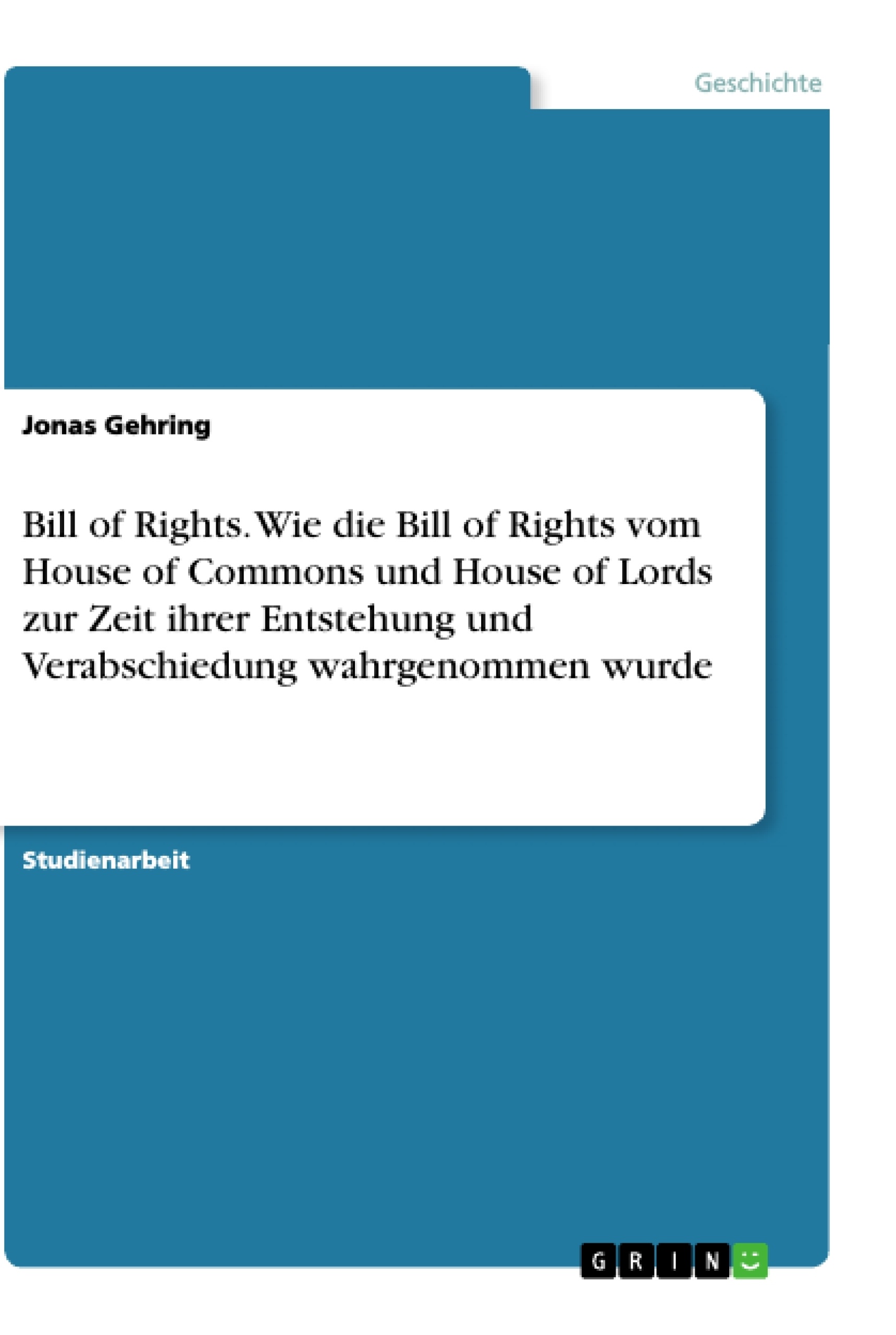Dieser Arbeit liegt die Fragestellung zugrunde, wie die Bill of Rights vom House of Commons und House of Lords zur Zeit ihrer Entstehung und Verabschiedung wahrgenommen wurde. Auch die Frage, wie die Bill of Rights von ihnen bewertet und letztlich auch, ob sie als Teil einer Verfassung gesehen wurde, soll dabei berücksichtigt werden.
Als Quellen sollen hierzu zwei Parlamentsdebatten aus dem House of Lords vom 25. und 28. Januar 1689 und eine aus dem House of Commons vom 28. Januar 1689 herangezogen werden, die beide von den Houses of Parliament der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind und einigermaßen präzise die Diskussionen protokollieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Bill of Rights
- 2.1 Die Bill of Rights - Vorgeschichte
- 2.2 Die Bill of Rights - Wilhelm III. von Oranien
- 2.3 Die Bill of Rights - House of Lords
- 2.4 Die Bill of Rights – House of Commons
- 3 Folgen der Bill of Rights
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zeitgenössische Wahrnehmung der Bill of Rights im englischen Parlament. Sie analysiert Parlamentsdebatten von 1689 aus dem House of Lords und dem House of Commons, um die Bewertung und Bedeutung der Bill of Rights durch die Abgeordneten zu beleuchten. Die zentrale Frage ist, ob die Bill of Rights als Teil einer Verfassung angesehen wurde.
- Die Entstehung und der Kontext der Bill of Rights
- Die unterschiedlichen Perspektiven des House of Lords und des House of Commons auf die Bill of Rights
- Die Rolle der Bill of Rights im Hinblick auf die Glorious Revolution
- Die Bewertung der Bill of Rights durch zeitgenössische Akteure
- Die Bedeutung der Bill of Rights für das englische politische System
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage der Arbeit, die sich mit der zeitgenössischen Wahrnehmung der Bill of Rights durch das englische Parlament beschäftigt. Sie skizziert die Methodik, die auf der Analyse von Parlamentsdebatten und Sekundärliteratur beruht, und betont die Herausforderungen, die sich aus der unvollständigen Dokumentation der Debatten ergeben. Die Einleitung begründet die Auswahl der verwendeten Quellen und deren Qualität.
2 Die Bill of Rights: Dieses Kapitel analysiert den Entstehungskontext der Bill of Rights, die Haltung Wilhelms III. von Oranien und die Sichtweisen des House of Lords und des House of Commons. Es untersucht die Vorgeschichte, beginnend mit den Konflikten zwischen Jakob II. und der anglikanischen Kirche, die zur Einladung Wilhelms III. führten. Es werden die Debatten im Parlament analysiert, um die unterschiedlichen Positionen und Auffassungen der Abgeordneten zur Bill of Rights und ihrer Bedeutung für das politische System Englands zu verstehen.
Schlüsselwörter
Bill of Rights, Glorious Revolution, House of Commons, House of Lords, Wilhelm III. von Oranien, Jakob II., englische Verfassung, Parlamentsdebatten, zeitgenössische Wahrnehmung, konstitutionelle Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Bill of Rights im englischen Parlament von 1689"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die zeitgenössische Wahrnehmung der Bill of Rights im englischen Parlament von 1689. Sie analysiert die Parlamentsdebatten im House of Lords und House of Commons, um die Bewertung und Bedeutung der Bill of Rights durch die Abgeordneten zu beleuchten und zu klären, ob sie als Teil einer Verfassung angesehen wurde.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse von Parlamentsdebatten aus dem House of Lords und dem House of Commons von 1689 sowie auf Sekundärliteratur. Die Einleitung thematisiert die Herausforderungen, die sich aus der unvollständigen Dokumentation der Debatten ergeben, und begründet die Auswahl und Qualität der verwendeten Quellen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und den Kontext der Bill of Rights, die unterschiedlichen Perspektiven des House of Lords und des House of Commons, die Rolle der Bill of Rights in Bezug auf die Glorious Revolution, die Bewertung durch zeitgenössische Akteure und ihre Bedeutung für das englische politische System.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Bill of Rights (mit Unterkapiteln zur Vorgeschichte, Wilhelm III., House of Lords und House of Commons), ein Kapitel über die Folgen der Bill of Rights und ein Fazit.
Was wird im Kapitel "Die Bill of Rights" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den Entstehungskontext der Bill of Rights, die Haltung Wilhelms III. von Oranien und die Sichtweisen des House of Lords und des House of Commons. Es untersucht die Vorgeschichte, beginnend mit den Konflikten zwischen Jakob II. und der anglikanischen Kirche, die zur Einladung Wilhelms III. führten, und analysiert die Parlamentsdebatten, um die unterschiedlichen Positionen und Auffassungen der Abgeordneten zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Bill of Rights, Glorious Revolution, House of Commons, House of Lords, Wilhelm III. von Oranien, Jakob II., englische Verfassung, Parlamentsdebatten, zeitgenössische Wahrnehmung, konstitutionelle Entwicklung.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Methodik basiert auf der Analyse von Parlamentsdebatten und Sekundärliteratur. Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen, die sich aus der unvollständigen Dokumentation der Debatten ergeben.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet, ob die Bill of Rights von den zeitgenössischen Abgeordneten als Teil einer Verfassung angesehen wurde.
- Quote paper
- Jonas Gehring (Author), 2017, Bill of Rights. Wie die Bill of Rights vom House of Commons und House of Lords zur Zeit ihrer Entstehung und Verabschiedung wahrgenommen wurde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452491