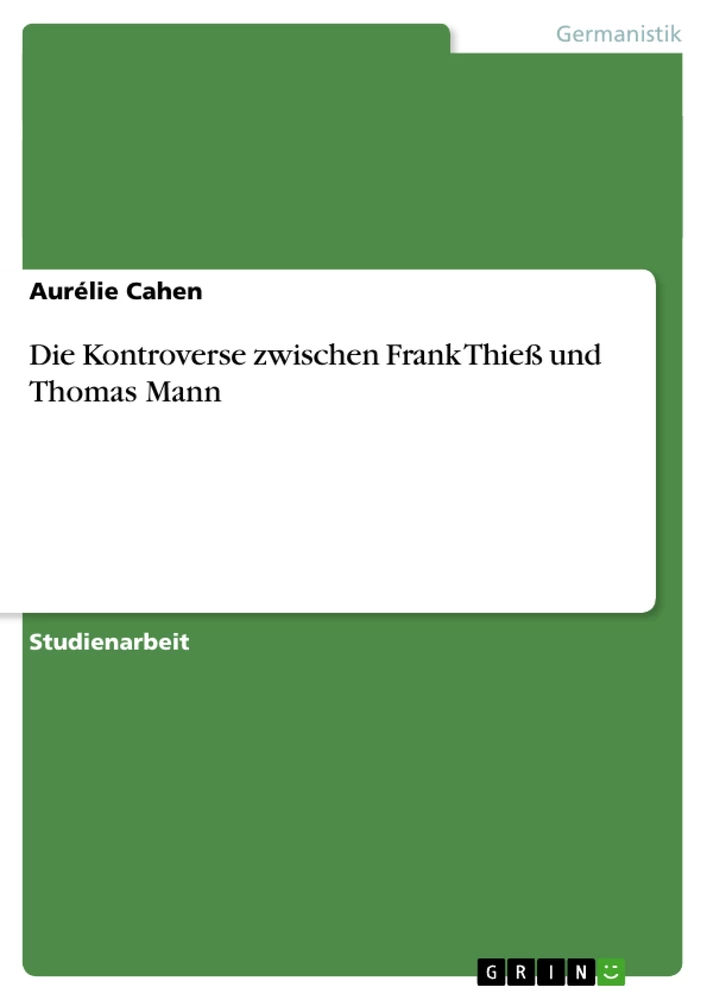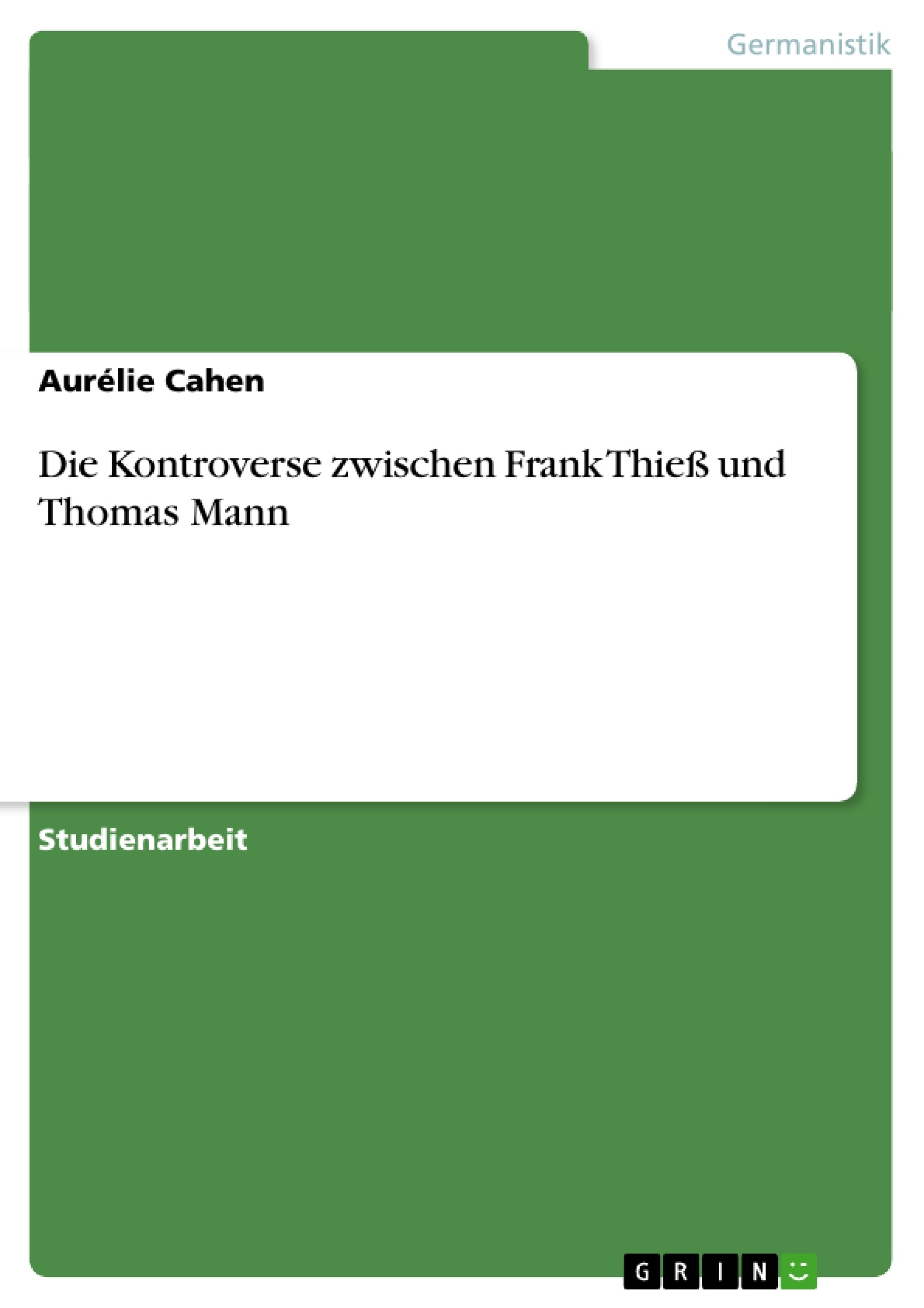Nach dem Selbstmord Hitlers am 30. April 1945 erfolgte die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai in Reims und Berlin-Karlshorst.
Der Krieg ließ Verwüstung und Leere zurück; die Niederlage war genauso total wie der von den Nationalsozialisten entfachte Krieg.
Weit über 2000 literarisch wirkende Männer und Frauen hatten Deutschland verlassen, unter ihnen fast alle international bekannten Autoren. Zusammen mit den geflüchteten Musikern, bildenden Künstlern und den Angehörigen der wissenschaftlichen und politischen Intelligenz, machten sie die größte kulturelle Emigration der bisherigen Geschichte aus. Während des Krieges hatte die Hoffnung auf eine Rückkehr nach Deutschland das Denken der meisten dieser Vertriebenen und Geflüchteten bestimmt. Der Zusammenbruch des Dritten Reiches stürzte sie in eine Existenzkrise, denn mit dem Regime in Deutschland wurden auch die Gründe des Exils beseitigt; jeder einzelne fand sich plötzlich vor die Frage gestellt, ob er nun tatsächlich nach Deutschland zurückkehren wolle oder nicht. Die Rückkehr verlangte den Mut, alles noch einmal hinter sich zu lassen, um wieder von vorn zu beginnen. Praktisch gesehen waren außerdem die Rückreisemöglichkeiten der Emigranten beschränkt. Die amerikanischen Gesetze z.B. verhinderten die Ausreise ohne Genehmigung der Regierung; außer den Emigranten in den USA waren auch alle aus Südamerika davon betroffen, da die einzigen Verbindungen nach Europa über New York führten und Transitvisa von den amerikanischen Behörden zumeist verweigert wurden: insgesamt bereitete die Rückkehr etwa dieselben Schwierigkeiten wie der Weg in die Emigration. Doch während die meisten politischen Emigranten gleich nach der Kapitulation darauf drängten, nach Deutschland reisen zu können, verhielten sich viele Schriftsteller abwartend. Die Hoffnung, das deutsche Volk würde sich selbst befreien, war enttäuscht worden; trotz der offensichtlichen Niederlage ging der Krieg bis zur Eroberung Berlins weiter. Das wahre Ausmaß der Verbrechen des Dritten Reiches wurde langsam bekannt, immer mehr Deutsche erwiesen sich als beteiligt, und immer deutlicher wurde die Wirkung der Propaganda in zwölf Jahren NS-Herrschaft. Und war es sicher, daß die Rückkehr auch eine Heimkehr sein würde?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Bitte kommen Sie zurück!
- III. Warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre
- IV. Die Aufnahme Thomas Manns Antwort in Deutschland
- V. Thomas Mann und das Exil
- VI. Die „innere Emigration“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Kontroverse zwischen Frank Thieß und Thomas Mann in der deutschen Nachkriegszeit. Der Text analysiert den offenen Brief Walter von Molos an Thomas Mann, der diesen zur Rückkehr nach Deutschland aufforderte, und die darauf folgende Debatte über die Rolle der Emigranten und die Frage der "inneren Emigration".
- Die Rückkehr der Emigranten nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Kontroverse um die Rolle der Emigranten und der "inneren Emigration"
- Die Debatte über die "Kollektivschuld" der Deutschen
- Die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf die Rückkehr der Emigranten
- Die Bedeutung von Thomas Manns Antwort auf Walter von Molos Brief für die deutsche Nachkriegsliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Dieses Kapitel setzt den historischen Kontext der Hausarbeit und beschreibt die Situation in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Frage der Rückkehr der Emigranten.
- II. Bitte kommen Sie zurück!: Dieses Kapitel analysiert den offenen Brief Walter von Molos an Thomas Mann, der die Rückkehr des Autors nach Deutschland fordert. Der Brief wird in Bezug auf seine politische und literarische Bedeutung untersucht.
- III. Warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Gründen, warum Thomas Mann sich gegen eine Rückkehr nach Deutschland entschied, wie sie in seinem Brief an Walter von Molo zum Ausdruck kommen.
- IV. Die Aufnahme Thomas Manns Antwort in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf Thomas Manns Antwort und die Diskussionen, die in der Folge entstanden.
- V. Thomas Mann und das Exil: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle des Exils für Thomas Manns Werk und dessen Bedeutung für die deutsche Literatur.
- VI. Die „innere Emigration“: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der „inneren Emigration“ und die Debatte um die Frage, ob es eine wirkliche Opposition in Deutschland während des Dritten Reiches gab.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen "Emigration", "innere Emigration", "Kollektivschuld", "Nachkriegsliteratur", "Kontroverse", "Thomas Mann", "Walter von Molo", "Deutschland", "Exil". Die Arbeit analysiert die politischen und literarischen Debatten, die durch die Rückkehr der Emigranten nach Deutschland in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst wurden.
- Quote paper
- Aurélie Cahen (Author), 1998, Die Kontroverse zwischen Frank Thieß und Thomas Mann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4512