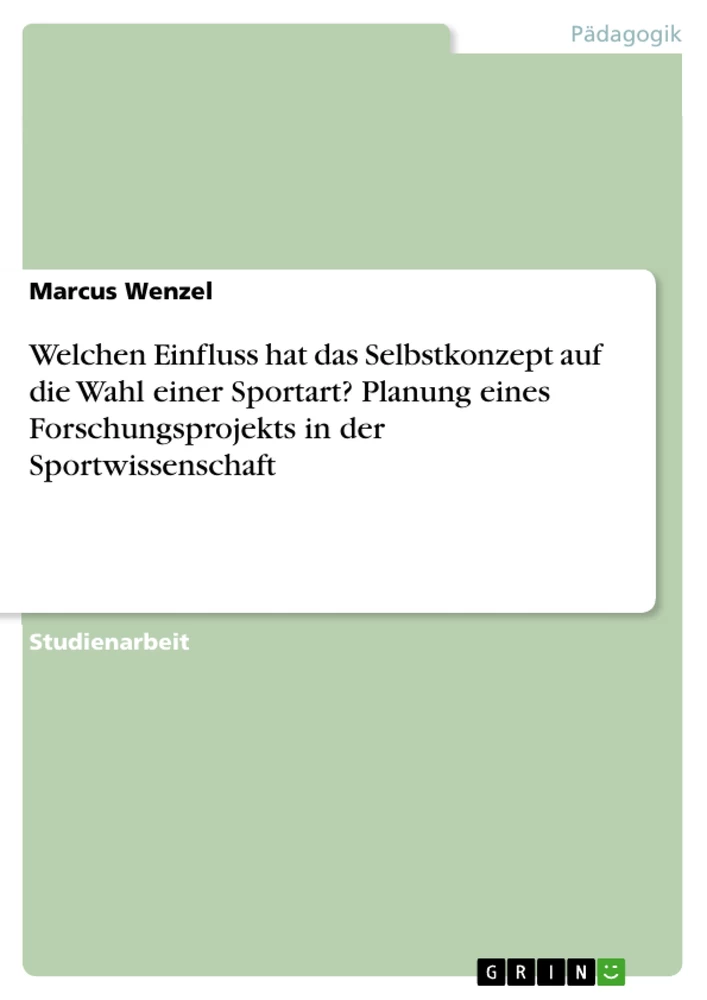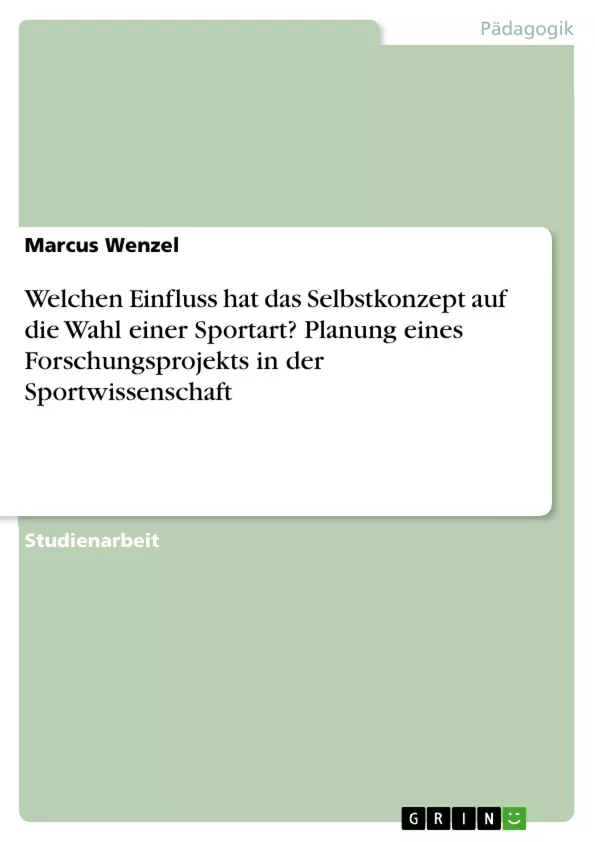Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, inwieweit ein hauptsächlich die Physis betreffendes Selbstkonzept die Wahl des Individuums für eine bestimmte Sportart beeinflusst. Hierbei wird der Versuch unternommen, Indizien zu finden, ob sich dabei erkennbare Unterschiede zwischen Mannschaftssportlern und Individualsportlern abzeichnen.
Dafür wird erst ein Einblick in die Vielzahl theoretischer Zugänge zur Persönlichkeitsentwicklung gegeben. Schließlich wird erläutert, welche Persönlichkeitskonstrukte in Betracht gezogen werden können, um die Verbindung zwischen Sport und Persönlichkeit empirisch zu belegen, und es wird diskutiert, welche Kausalrichtung der Interpretation zu wählen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodik
- 2.1 Hypothesenherleitung
- 2.2 Datenerhebung
- 2.3 PSDQ-Physical Self Description Questionnaire
- 2.4 Stichprobeneingrenzung
- 2.5 Erläuterung des Onlinefragebogens
- 2.6 Potenzielle Störquellen
- 3. Ergebnis
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss des physischen Selbstkonzepts auf die Wahl zwischen Mannschafts- und Individualsportarten. Sie zielt darauf ab, empirische Indizien für einen Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept und der Präferenz für eine bestimmte Sportart zu finden. Die Arbeit basiert auf bestehenden Theorien der Persönlichkeitsentwicklung im Sport, insbesondere dem Selbstkonzeptmodell.
- Einfluss des physischen Selbstkonzepts auf die Sportartenwahl
- Unterschiede zwischen Mannschafts- und Individualsportlern bezüglich des Selbstkonzepts
- Anwendung des Selbstkonzeptmodells in der Sportwissenschaft
- Überprüfung der Selektionshypothese im Kontext von Sportartenwahl
- Methodische Vorgehensweise bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Persönlichkeit und Sport
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Seminararbeit im Rahmen des Moduls „Sportwissenschaftliches Arbeiten/Forschen aus pädagogischer Perspektive“ an der Universität Würzburg. Sie führt in die Thematik der Persönlichkeitsentwicklung im Sport ein und thematisiert die Herausforderungen, die sich aus der Vielfältigkeit von Definitionen des Begriffs „Persönlichkeit“ ergeben. Die Arbeit konzentriert sich auf den Ansatz des Selbstkonzepts, insbesondere das physische Selbstkonzept, und beantwortet die Frage, ob ein bereits bestehendes physisches Selbstkonzept die Wahl der Sportart beeinflusst. Es wird auf die Relevanz der Berner Interventionsstudie Schulsport (BISS) hingewiesen, welche den Einfluss von Schulsport auf die Selbstkonzeptentwicklung untersucht. Diese Arbeit untersucht jedoch die umgekehrte Richtung: den Einfluss des Selbstkonzepts auf die Sportartenwahl.
2. Methodik: Dieses Kapitel erläutert die methodische Vorgehensweise der Seminararbeit. Es beschreibt die Forschungsfrage, die daraus abgeleitete Hypothese und das gewählte Untersuchungsdesign, einschliesslich der Erläuterung des verwendeten Fragebogens (PSDQ). Es wird detailliert auf die Hypothesenherleitung eingegangen, wobei der Fokus auf dem Einfluss der unabhängigen Variable (Persönlichkeit) auf die abhängige Variable (Sportartenwahl) liegt. Die Arbeit prüft implizit die Selektionshypothese, indem sie nach Unterschieden im Selbstkonzept zwischen Mannschafts- und Individualsportlern sucht.
Schlüsselwörter
Physisches Selbstkonzept, Sportartenwahl, Mannschaftsport, Individualsport, Persönlichkeitsentwicklung, Selektionshypothese, Selbstkonzeptmodell, empirische Forschung, Sportpsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Einfluss des physischen Selbstkonzepts auf die Sportartenwahl
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss des physischen Selbstkonzepts auf die Wahl zwischen Mannschafts- und Individualsportarten. Sie sucht nach empirischen Belegen für einen Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept und der Präferenz für eine bestimmte Sportart. Die Arbeit stützt sich auf Theorien der Persönlichkeitsentwicklung im Sport, insbesondere das Selbstkonzeptmodell.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Beeinflusst ein bereits bestehendes physisches Selbstkonzept die Wahl der Sportart? Die Arbeit untersucht den Einfluss des physischen Selbstkonzepts auf die Sportartenwahl und sucht nach Unterschieden im Selbstkonzept zwischen Mannschafts- und Individualsportlern. Implizit wird die Selektionshypothese geprüft.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit beschreibt die methodische Vorgehensweise, einschließlich der Forschungsfrage, der daraus abgeleiteten Hypothese und des Untersuchungsdesigns. Es wird der verwendete Fragebogen (PSDQ – Physical Self Description Questionnaire) erläutert. Die Hypothesenherleitung wird detailliert dargestellt, wobei der Fokus auf dem Einfluss der unabhängigen Variable (Persönlichkeit) auf die abhängige Variable (Sportartenwahl) liegt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Methodik, ein Kapitel zu den Ergebnissen und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit und führt in die Thematik ein. Das Methodenkapitel erläutert die Vorgehensweise detailliert. Die Ergebnisse werden im entsprechenden Kapitel präsentiert, und das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert deren Implikationen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Einfluss des physischen Selbstkonzepts auf die Sportartenwahl, Unterschiede zwischen Mannschafts- und Individualsportlern bezüglich des Selbstkonzepts, Anwendung des Selbstkonzeptmodells in der Sportwissenschaft, Überprüfung der Selektionshypothese im Kontext von Sportartenwahl und die methodische Vorgehensweise bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Persönlichkeit und Sport.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Physisches Selbstkonzept, Sportartenwahl, Mannschaftsport, Individualsport, Persönlichkeitsentwicklung, Selektionshypothese, Selbstkonzeptmodell, empirische Forschung, Sportpsychologie.
Wo wurde die Arbeit erstellt?
Die Arbeit wurde im Rahmen des Moduls „Sportwissenschaftliches Arbeiten/Forschen aus pädagogischer Perspektive“ an der Universität Würzburg erstellt.
Welche Rolle spielt die Berner Interventionsstudie Schulsport (BISS)?
Die Arbeit verweist auf die Relevanz der BISS, welche den Einfluss von Schulsport auf die Selbstkonzeptentwicklung untersucht. Im Gegensatz dazu untersucht diese Arbeit den umgekehrten Einfluss: den Einfluss des Selbstkonzepts auf die Sportartenwahl.
- Citar trabajo
- Marcus Wenzel (Autor), 2012, Welchen Einfluss hat das Selbstkonzept auf die Wahl einer Sportart? Planung eines Forschungsprojekts in der Sportwissenschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450716