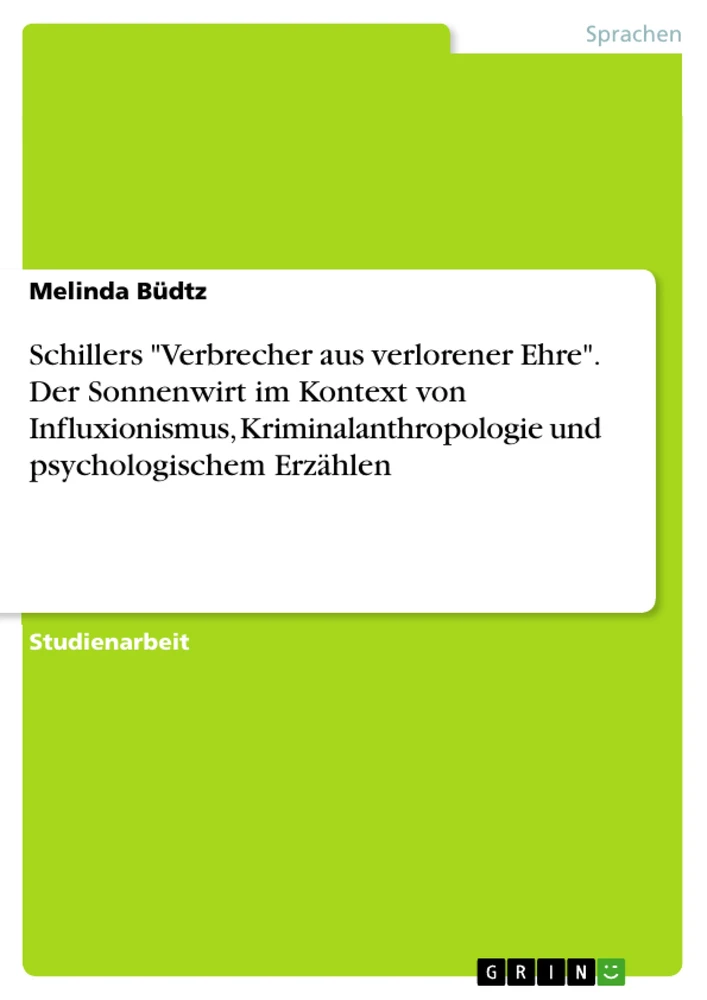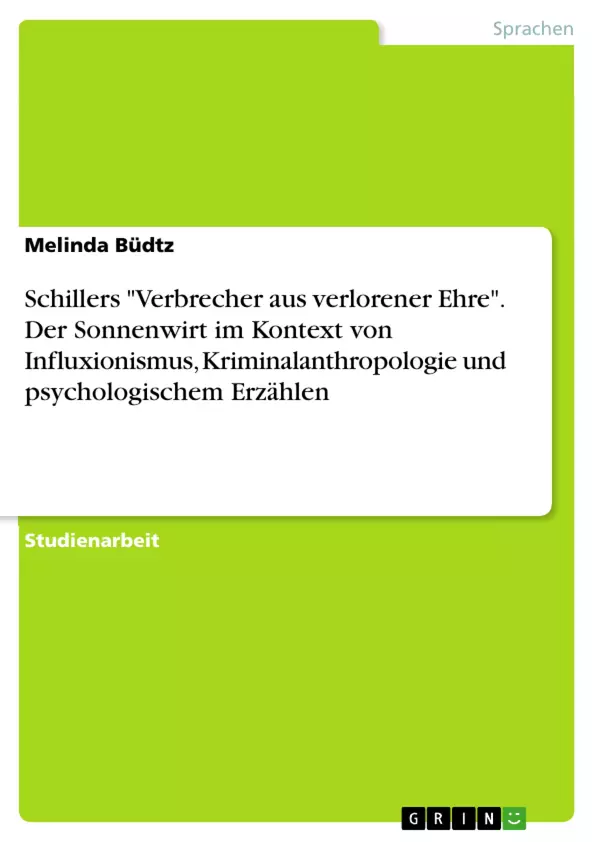Der Verbrecher – das ist und war vor allem im 18. Jahrhundert die Schnittstelle, an der sich zwei anthropologisch relevante Fragestellungen getroffen haben, und zwar die Frage „Wie ein Mensch überhaupt hatte so werden können?“ (Der Begriff „werden“ war zu dieser Zeit noch nicht einmal relevant) und zweitens „Was uns davon abhält, uns mit so einem ‘Geschöpf fremder Gattung […], dessen Blut anders umläuft‘ zu identifizieren?“.
Diese Fragen erhielten vor allem im Zuge der Erneuerung bzw. Humanisierung des Strafrechts im 18. Jh. neue Relevanz. Es galt ein geeignetes und v.a. menschenwürdiges Strafmaß zu finden, die psycho-sozialen Beweggründe eines Verbrechers nachzuvollziehen und ob dazu nur ein Blick in die Gesetzesbücher oder doch „in die Gemüthsfassung des Beklagten“ reichte, das veranlasste einen jungen Mediziner namens Schiller dazu, ein philosophisches Programm auszurufen.
Ihm ging es als Arzt darum, den ganzen Menschen zu begreifen; sein Augenmerk verlagerte sich von der Wirkung auf die Ursache. Er wollte den Verbrecher – die „thierischste“ Ausformung des Menschen – nicht als von der Gesellschaft separiert, sondern als aus ihr hervorgehend und in ihr wirkend wissen. Aus diesem Grund wählte er einen Stoff mit realhistorischem Hintergrund - den historischen Fall des Verbrechers Friedrich Schwan, den er für seine literarischen Zwecke verarbeitete.
„Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ ist bis heute eines der prägendsten Werke Schillers und unter seinen Erzählungen wohl die bekannteste. In ihr reichen sich anthropologische, kriminalliterarische und sozialgeschichtliche Aspekte die Hand. An dem für das 18. Jh. charakteristischen Zusammenhang von Leib und Seele, dem Commercium, wie auch dessen Zusammenspiel, dem Influxionismus, wird sich diese Hausarbeit am Beispiel des literarischen "Sonnenwirts" Christian Wolf versuchen. Mit den beiden Unterkategorien influxus corporis und influxus animae wie auch Schillers "engagierter" Erzählstrategie werden kriminalanthropologische Aspekte der Erzählung aufzeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rahmung des Werks in einen literarischen, sozialgeschichtlichen und anthropologischen Kontext
- 2.1 Der Verbrecher im 18. Jh. in Strafjustiz und Literatur
- 2.2 Schillers Anthropologie – Der Ganze Mensch
- 3 Influxionismus und Commercium am Beispiel des Sonnenwirtes Christian Wolf
- 3.1 Influxus corporis bei Christian Wolf – Wie und wann spricht der Körper?
- 3.1.1 Christian Wolfs Aussehen - Schiller und Lavaters Physiognomie
- 3.1.2 Christian Wolfs sinnliches Handeln - Die Rache der Natur
- 3.2 Influxus animae bei Christian Wolf - Wie und wann spricht die Seele?
- 3.3 Influxionismus und Commercium - Christian Wolf als „ganzer Mensch“
- 4 Kriminalanthropologische Aspekte des „Verbrechers“
- 4.1 Schillers Aufwertung des Leib-Sinnlichen
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Schillers Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ im Kontext von Influxionismus, Kriminalanthropologie und psychologischem Erzählen. Ziel ist es, Schillers anthropologische Position und deren Einfluss auf die Darstellung des Verbrechers zu analysieren. Besonders wird die Verbindung von Körper und Seele im Kontext des Influxionismus anhand der Figur des Sonnenwirts Christian Wolf untersucht.
- Schillers Anthropologie und der „Ganze Mensch“
- Das Verbrecherbild im 18. Jahrhundert in Justiz und Literatur
- Influxionismus und das Wechselspiel von Körper und Seele
- Kriminalanthropologische Aspekte in Schillers Erzählung
- Die literarische Verarbeitung des realhistorischen Hintergrunds
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor: Wie konnte ein Mensch zum Verbrecher werden, und was verhindert unsere Identifikation mit ihm? Sie verortet die Arbeit im Kontext der Strafrechtsreform des 18. Jahrhunderts und Schillers anthropologischem Ansatz, der den „ganzen Menschen“ betont, im Gegensatz zum aufklärerischen Rationalismus. Schillers „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ wird als prägnantes Beispiel gewählt, um die Verschränkung anthropologischer, kriminalliterarischer und sozialgeschichtlicher Aspekte zu untersuchen. Der Fokus liegt auf dem Influxionismus und dem Verhältnis von Körper und Seele (Commercium), das durch die Kategorien influxus corporis und influxus animae analysiert werden soll.
2 Rahmung des Werks in einen literarischen, sozialgeschichtlichen und anthropologischen Kontext: Dieses Kapitel erläutert den sozialgeschichtlichen und literarischen Kontext von Schillers Erzählung. Es untersucht das damalige Verbrecherbild in Strafjustiz und Literatur und beleuchtet Schillers ganzheitliches Menschenbild, das ihn dazu brachte, die „Leichenöffnung“ menschlichen Lasters als Möglichkeit zu sehen, das volle Potenzial des menschlichen Seins aufzuzeigen. Die Arbeit von Rybska, Köpf und Kawa wird hier herangezogen, um die Zweidimensionalität der Erzählung aufzuzeigen: die psychologische Ebene und die Gesellschaftskritik.
3 Influxionismus und Commercium am Beispiel des Sonnenwirtes Christian Wolf: Dieses Kapitel analysiert Schillers Darstellung des Sonnenwirts Christian Wolf unter den Gesichtspunkten des Influxionismus. Es untersucht, wie Schiller die Kategorien influxus corporis (körperlicher Einfluss) und influxus animae (seelischer Einfluss) verwendet, um die Einheit von Körper und Seele darzustellen. Die Analyse betrachtet Christian Wolfs Aussehen im Licht der Physiognomie und sein sinnliches Handeln als Ausdruck der "Rache der Natur". Es wird untersucht, inwiefern Schillers Darstellung den nachfolgenden Diskurs von Kriminalliteratur und -anthropologie beeinflusst hat.
4 Kriminalanthropologische Aspekte des „Verbrechers“: Dieses Kapitel befasst sich mit den kriminalliterarischen Aspekten des Werks und Schillers Aufwertung des Leib-Sinnlichen, im Kontrast zu den Tendenzen der damaligen Justiz und Gesellschaft. Es wird detailliert untersucht, wie Schiller die “thierische” Seite des Verbrechers darstellt und wie er damit die Menschlichkeit in der Justiz kritisiert, die mehr auf göttliche Vergeltung und Abschreckung als auf Vorbeugung und Prävention setzt.
Schlüsselwörter
Schiller, Verbrecher aus verlorener Ehre, Influxionismus, Kriminalanthropologie, psychologisches Erzählen, Leib-Seele-Problem, Commercium, influxus corporis, influxus animae, ganzheitliches Menschenbild, 18. Jahrhundert, Strafjustiz, Literatur, Gesellschaftskritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Schillers „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Schillers Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ unter Berücksichtigung von Influxionismus, Kriminalanthropologie und psychologischer Erzählweise. Der Fokus liegt auf Schillers anthropologischer Position und deren Einfluss auf die Darstellung des Verbrechers, insbesondere auf die Verbindung von Körper und Seele (Commercium) anhand der Figur des Sonnenwirts Christian Wolf.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Schillers Anthropologie und der „Ganze Mensch“, das Verbrecherbild im 18. Jahrhundert in Justiz und Literatur, Influxionismus und das Wechselspiel von Körper und Seele, kriminalanthropologische Aspekte in Schillers Erzählung und die literarische Verarbeitung des realhistorischen Hintergrunds. Die Kategorien influxus corporis und influxus animae spielen eine zentrale Rolle bei der Analyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die Forschungsfragen und den Kontext vor. Kapitel 2 beleuchtet den literarischen, sozialgeschichtlichen und anthropologischen Kontext der Erzählung. Kapitel 3 analysiert den Sonnenwirt Christian Wolf im Hinblick auf Influxionismus (influxus corporis und influxus animae). Kapitel 4 behandelt die kriminalanthropologischen Aspekte und Schillers Aufwertung des Leib-Sinnlichen. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird der Influxionismus in der Analyse verwendet?
Der Influxionismus, mit seinen Aspekten influxus corporis (körperlicher Einfluss) und influxus animae (seelischer Einfluss), dient als zentrales analytisches Werkzeug, um die Einheit von Körper und Seele bei Schiller darzustellen und die Darstellung des Verbrechers zu verstehen. Christian Wolfs Aussehen und Handeln werden unter diesem Gesichtspunkt untersucht.
Welche Rolle spielt die Figur des Sonnenwirts Christian Wolf?
Christian Wolf, der Sonnenwirt, ist die zentrale Figur der Analyse. Anhand seiner Darstellung wird untersucht, wie Schiller das Wechselspiel von Körper und Seele (Commercium) gestaltet und wie er den „ganzen Menschen“ im Kontext des Influxionismus darstellt. Seine körperlichen und seelischen Eigenschaften werden im Hinblick auf die Kategorien influxus corporis und influxus animae analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Schiller, Verbrecher aus verlorener Ehre, Influxionismus, Kriminalanthropologie, psychologisches Erzählen, Leib-Seele-Problem, Commercium, influxus corporis, influxus animae, ganzheitliches Menschenbild, 18. Jahrhundert, Strafjustiz, Literatur, Gesellschaftskritik.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, Schillers anthropologische Position und deren Einfluss auf die Darstellung des Verbrechers zu analysieren. Es geht darum zu verstehen, wie Schiller das Verbrecherbild im Kontext des 18. Jahrhunderts und seiner ganzheitlichen Anthropologie darstellt.
Welche weiteren Autoren/Werke werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Werke von Rybska, Köpf und Kawa, um die Zweidimensionalität (psychologische Ebene und Gesellschaftskritik) von Schillers Erzählung aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Melinda Büdtz (Autor), 2016, Schillers "Verbrecher aus verlorener Ehre". Der Sonnenwirt im Kontext von Influxionismus, Kriminalanthropologie und psychologischem Erzählen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449701