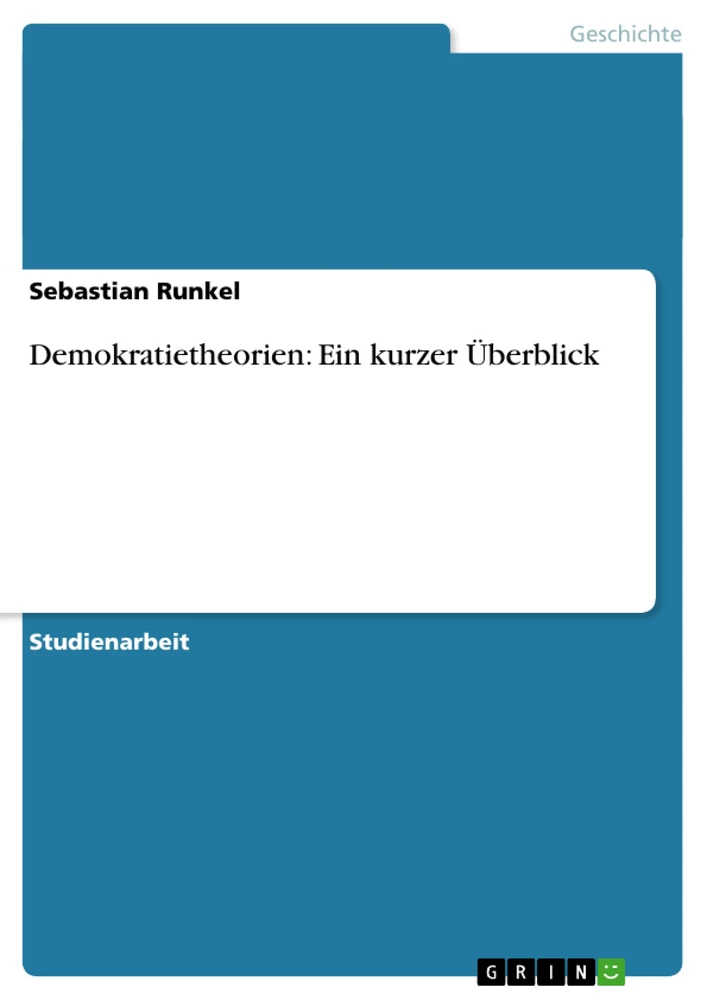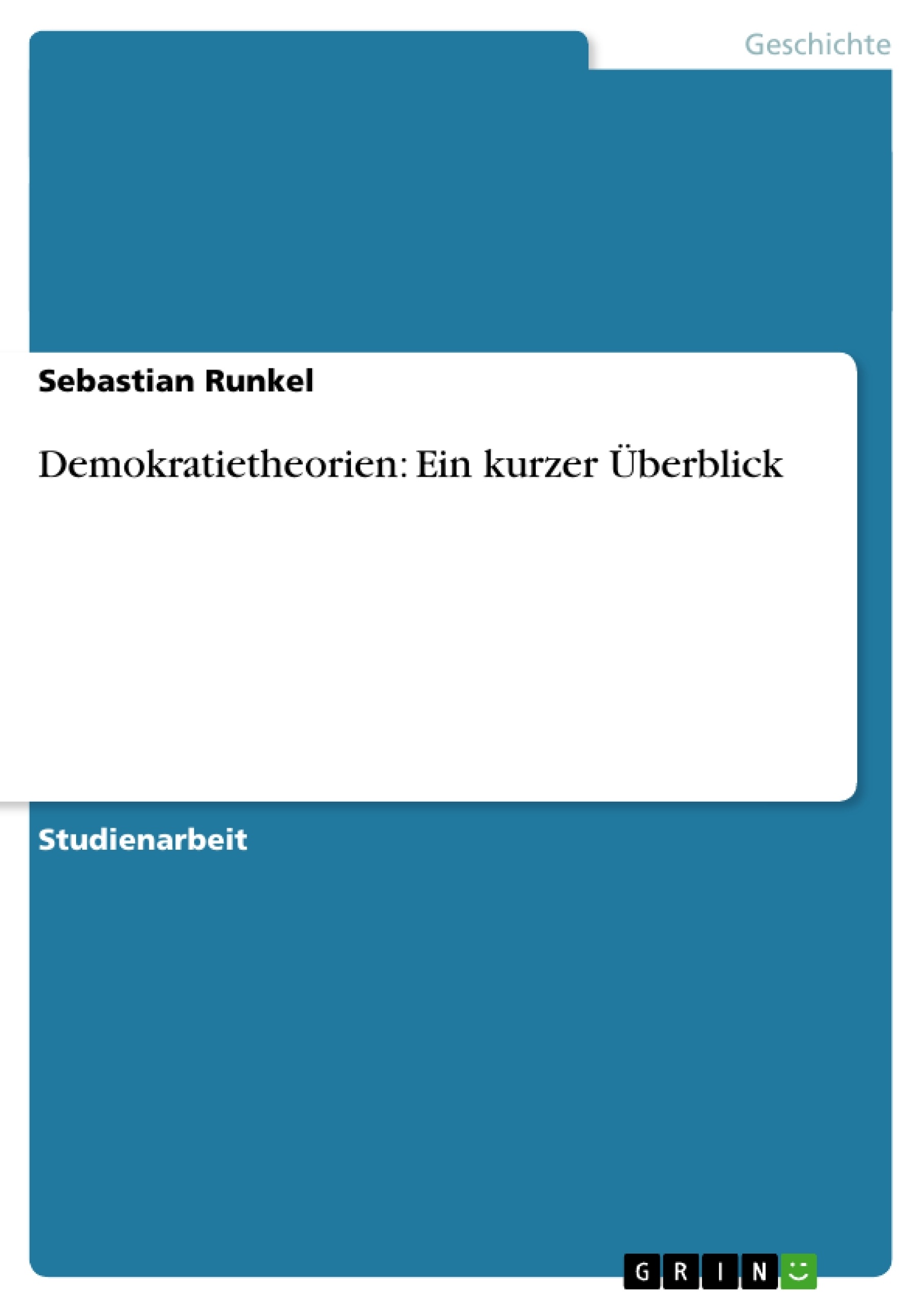In dieser Arbeit soll es besonders um die Frage gehen, ob einzelne spezifische Formen von Demokratien aufgrund ihrer Struktur anfälliger als andere für eine militarisierte Außenpolitik sein können. Im Einzelnen sollen gegenübergestellt werden die Parlamentarische und die Präsidentielle Demokratie, wobei die Bundesrepublik Deutschland und die USA als Beispiele dienen, ferner die Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie und schließlich noch die Direktdemokratie.
Dass gefestigte Demokratien untereinander keine Kriege führen, kann aus der Erfahrung bislang bestätigt werden. Jedoch gibt es seit einiger Zeit eine heftige Kontroverse darüber, ob man wegen dieser Erfahrung hier von einem empirischen Gesetz sprechen könne oder ob die Tatsache, dass Demokratien bisher keinen Krieg untereinander führten, Zufall sei und andere Ursachen habe. Aus der Annahme, Demokratien führen untereinander keinen Krieg, die schon Immanuel Kant in seiner Schrift ‚Zum Ewigen Frieden’ formulierte, folgt automatisch eine Theorie, nämlich die des ‚Democratic Peace’. Sie beinhaltet, dass es keinen Krieg mehr gebe, wenn alle Staaten dieser Welt demokratische Verfassungen besäßen. Hier stellt sich die Frage, wie dieser Demokratisierungsvorgang vor sich gehen soll. Warnungen, dass eine Außenpolitik im Namen von demokratischen Frieden abzulehnen sei, da sie leicht zu ideologischen Kreuzzügen, zu militärischen Abenteuern und zur Überdehnung der eigenen Macht führen könne , sind nicht von der Hand zu weisen. Und dass Demokratien gegenüber Diktaturen zu kriegerischer Gewalt durchaus bereit sind, zeigt die Geschichte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Parlamentarische vs. Präsidentielle Demokratie
- Konkurrenz- vs. Konkordanzdemokratie
- Direktdemokratie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Buch "Demokratietheorien" von Manfred G. Schmidt und untersucht, ob bestimmte Formen von Demokratien aufgrund ihrer Struktur anfälliger für eine militarisierte Außenpolitik sind. Der Fokus liegt dabei auf aktuellen, empirisch-analytischen Demokratietheorien.
- Vergleich der parlamentarischen und präsidentiellen Demokratie
- Untersuchung der Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie
- Analyse der Direktdemokratie
- Bewertung der Anfälligkeit der verschiedenen Demokratieformen für eine militarisierte Außenpolitik
- Beurteilung des "Democratic Peace"-Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, ob bestimmte Demokratieformen aufgrund ihrer Struktur anfälliger für eine militarisierte Außenpolitik sind. Die Untersuchung konzentriert sich auf ausgewählte aktuelle Demokratietheorien und vergleicht dabei verschiedene Demokratieformen, wie die parlamentarische und die präsidentielle Demokratie, sowie die Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie und die Direktdemokratie.
Parlamentarische vs. Präsidentielle Demokratie
In diesem Kapitel werden die Unterschiede zwischen parlamentarischen und präsidentiellen Demokratien hinsichtlich ihres Verhältnisses von Regierung und Parlament beleuchtet. Die Arbeit stellt heraus, dass die Abhängigkeit der Regierung vom Vertrauen der Parlamentsmehrheit im parlamentarischen System zu einem "Parteienstaat" mit starken und geschlossenen Parteien führt. Im präsidentiellen System hingegen sind Regierung und Parlament unabhängiger voneinander, was zu einem schwächeren Parteienwettbewerb führt. Die Arbeit stellt die Frage, ob diese Unterschiede einen Einfluss auf die Außenpolitik haben und ob präsidentielle Systeme anfälliger für eine militarisierte Außenpolitik sind.
Schlüsselwörter
Demokratietheorien, parlamentarische Demokratie, präsidentielle Demokratie, Konkurrenzdemokratie, Konkordanzdemokratie, Direktdemokratie, militarisierte Außenpolitik, "Democratic Peace", Parteienstaat, Parteienwettbewerb.
- Citar trabajo
- Sebastian Runkel (Autor), 2005, Demokratietheorien: Ein kurzer Überblick, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44946