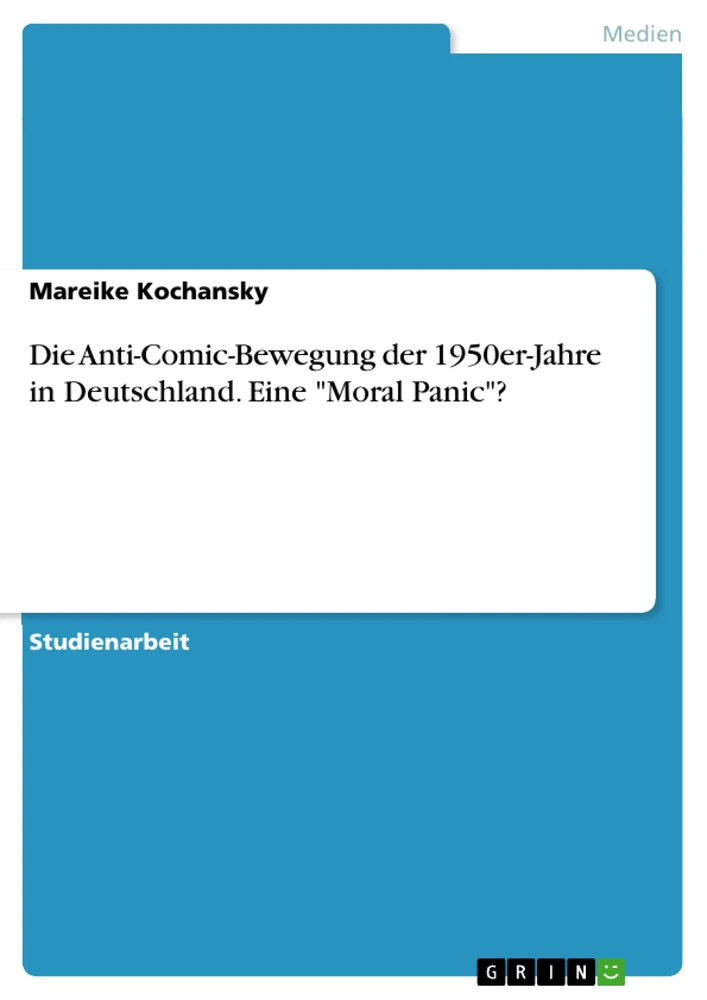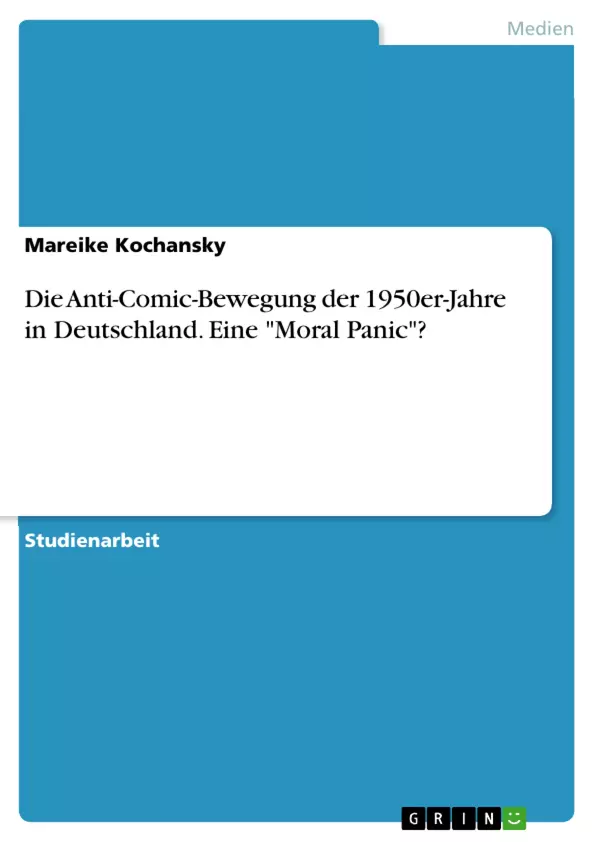Deutschland besitzt im Hinblick auf das bildtextuelle Medium "Comic" eine spezielle Geschichte. Obwohl Comics und insbesondere Manga heute ein kommerziell bedeutsames Segment des deutschen Buchmarktes sind und schon Anfang des 20. Jahrhunderts einige kommerziell erfolgreiche "Bildergeschichten" von deutschen Autoren distributiert wurden, so stand Deutschland - in Ost und West - dem Comic als Medium bis in die späten 1990er-Jahre eher kritisch gegenüber. Über die Lektüre dieser Literaturform existierten zahlreiche Vorurteile, den LeserInnen wurden zumeist Bildungsferne unterstellt.
In den 1950er- und 1960er-Jahren kummulierten diese Vorurteile, was in der DDR und der BRD jeweils spezifisch von statten ging. Handelte es sich dabei um eine Moral Panic nach Cohen (1972)?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Comic-Markt in Deutschland – von den 1920er- bis in die 1940er-Jahre
- 2.1 Die deutsche Comic-Landschaft bis zum Dritten Reich
- 2.2 Comics in der Nachkriegszeit
- 3. Die Entwicklung der Anti-Comic-Kampagne: Comics in den 1950er-Jahren
- 3.1 Deutschlandweit
- 3.2 International
- 3.3 In der BRD
- 3.4 In der DDR
- 4. Nationale und Internationale Akteure der Anti-Comic-Kampagne
- 4.1 Internationale Akteure
- 4.2 Deutschlandweit
- 4.3 In der BRD
- 4.4 In der DDR
- 5. Konzepte der Moral Panic und Media Panic
- 5.1 Das Konzept der Moral Panic nach Cohen (1972/2011) und Ben-Yehuda (2009)
- 5.2 Das Konzept der Media Panic nach Drotner (2006)
- 6. Welche Folge hatte die Ablehnung der Comics und ist diese als eine „Moral Panic“ zu definieren?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anti-Comic-Kampagne der 1950er Jahre in Deutschland und analysiert, ob diese als "Moral Panic" zu definieren ist. Die Arbeit beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Kontexte, die zur Ablehnung von Comics führten.
- Entwicklung des Comic-Marktes in Deutschland
- Die Entstehung und Ausbreitung der Anti-Comic-Kampagne
- Nationale und internationale Akteure der Kampagne
- Anwendung des Konzepts der Moral Panic
- Folgen der Kampagne für die deutsche Comic-Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den moralisch motivierten Faktoren und Akteuren, die zur Etablierung des Bildes der "Schund- und Schmutzliteratur" bezüglich Comics in Deutschland beitrugen, und ob dieses Vorgehen als "Moral Panic" zu definieren ist. Sie skizziert den Forschungsansatz, der historische Hintergründe, nationale und internationale Akteure sowie deren Motivationen betrachtet. Die Arbeit wird die Entwicklung von Comics in Deutschland, die Anti-Comic-Kampagne im In- und Ausland und die Anwendung von Moral Panic-Modellen untersuchen, um die Forschungsfrage zu beantworten.
2. Der Comic-Markt in Deutschland von den 1920er- bis in die 1940er-Jahre: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung des deutschen Comic-Marktes. Es zeigt, dass Comics im Gegensatz zu anderen Ländern wie den USA eine spärliche Produktion und eine zunächst ambivalente Rezeption erlebten. Während "Bildergeschichten" früh akzeptiert waren, wurden Comics oft als minderwertig und auf wenig gebildete Leser ausgerichtet angesehen. Die NS-Zeit führte zu Stagnation und Nutzung von Comics für Propaganda. Die Nachkriegszeit war durch materielle Engpässe gekennzeichnet, und Importe amerikanischer Comics, inklusive "Crime-", "Horror-" und "Romance-Comics", waren zunächst erfolglos.
3. Die Entwicklung der Anti-Comic-Kampagne: Comics in den 1950er-Jahren: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Anti-Comic-Kampagne in den 1950er Jahren. Es beleuchtet die kritische Haltung von Pädagogen, Kulturexperten und Funktionären gegenüber dem Medium Comic, insbesondere vor dem Hintergrund des wachsenden Schwarzmarktes für Comics in der BRD. Die Kampagne wird in ihren nationalen und internationalen Aspekten dargestellt, wobei die unterschiedlichen Entwicklungen in BRD und DDR hervorgehoben werden. Die Befürchtungen über die negative Beeinflussung der Jugend durch die "anspruchslosen" Comics, die angebliche Abstumpfung des Intellekts und die Förderung des Analphabetentums werden detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Anti-Comic-Kampagne, Moral Panic, Media Panic, Comics, Deutschland, 1950er Jahre, Jugendschutz, Medienwirkung, Bildgeschichten, Schundliteratur, BRD, DDR, nationale Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Anti-Comic-Kampagne in Deutschland der 1950er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anti-Comic-Kampagne in Deutschland während der 1950er Jahre und analysiert, ob diese als "Moral Panic" zu definieren ist. Sie beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Kontexte, die zur Ablehnung von Comics führten, und untersucht die beteiligten Akteure und deren Motivationen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Comic-Marktes in Deutschland von den 1920er bis in die 1940er Jahre, die Entstehung und Ausbreitung der Anti-Comic-Kampagne in den 1950er Jahren (national und international, BRD und DDR), die beteiligten nationalen und internationalen Akteure, die Anwendung der Konzepte "Moral Panic" und "Media Panic", und die Folgen der Kampagne für die deutsche Comic-Kultur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Entwicklung des Comic-Marktes in Deutschland (1920er-1940er Jahre), Entwicklung der Anti-Comic-Kampagne (1950er Jahre), nationale und internationale Akteure der Kampagne, Konzepte der Moral Panic und Media Panic, und die Folgen der Ablehnung von Comics. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen historisch-analytischen Ansatz. Sie untersucht die historischen Hintergründe der Anti-Comic-Kampagne, analysiert die beteiligten Akteure und deren Motivationen und wendet die theoretischen Konzepte der Moral Panic und Media Panic an, um die Kampagne zu interpretieren und die Forschungsfrage zu beantworten.
Welche Ergebnisse werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert eine detaillierte Analyse der Anti-Comic-Kampagne, beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Akteure und untersucht, inwieweit die Kampagne als "Moral Panic" zu verstehen ist. Die Ergebnisse zeigen die komplexen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Veränderungen, Medienrezeption und der Entstehung von moralischen Paniken auf.
Welche Akteure werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl nationale als auch internationale Akteure der Anti-Comic-Kampagne, darunter Pädagogen, Kulturexperten, Funktionäre und Medien. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Motivationen und Strategien dieser Akteure und deren Einfluss auf die Entwicklung der Kampagne.
Welche Rolle spielen die Konzepte "Moral Panic" und "Media Panic"?
Die Konzepte "Moral Panic" (nach Cohen und Ben-Yehuda) und "Media Panic" (nach Drotner) dienen als analytische Werkzeuge, um die Anti-Comic-Kampagne zu verstehen. Die Arbeit untersucht, ob die Kampagne den Kriterien dieser Konzepte entspricht und welche Aspekte der Kampagne durch diese Konzepte erklärt werden können.
Welche Folgen hatte die Anti-Comic-Kampagne?
Die Arbeit untersucht die Folgen der Anti-Comic-Kampagne für die deutsche Comic-Kultur. Es werden die langfristigen Auswirkungen der Kampagne auf die Produktion, Verbreitung und Rezeption von Comics in Deutschland diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anti-Comic-Kampagne, Moral Panic, Media Panic, Comics, Deutschland, 1950er Jahre, Jugendschutz, Medienwirkung, Bildgeschichten, Schundliteratur, BRD, DDR, nationale Identität.
- Citar trabajo
- Mareike Kochansky (Autor), 2017, Die Anti-Comic-Bewegung der 1950er-Jahre in Deutschland. Eine "Moral Panic"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449105